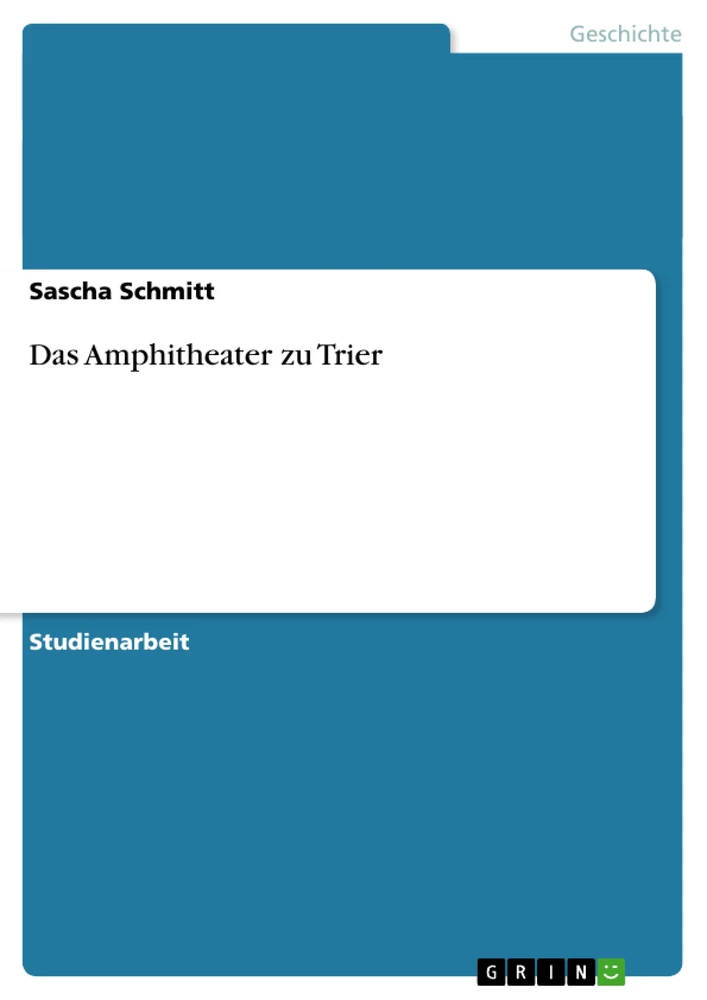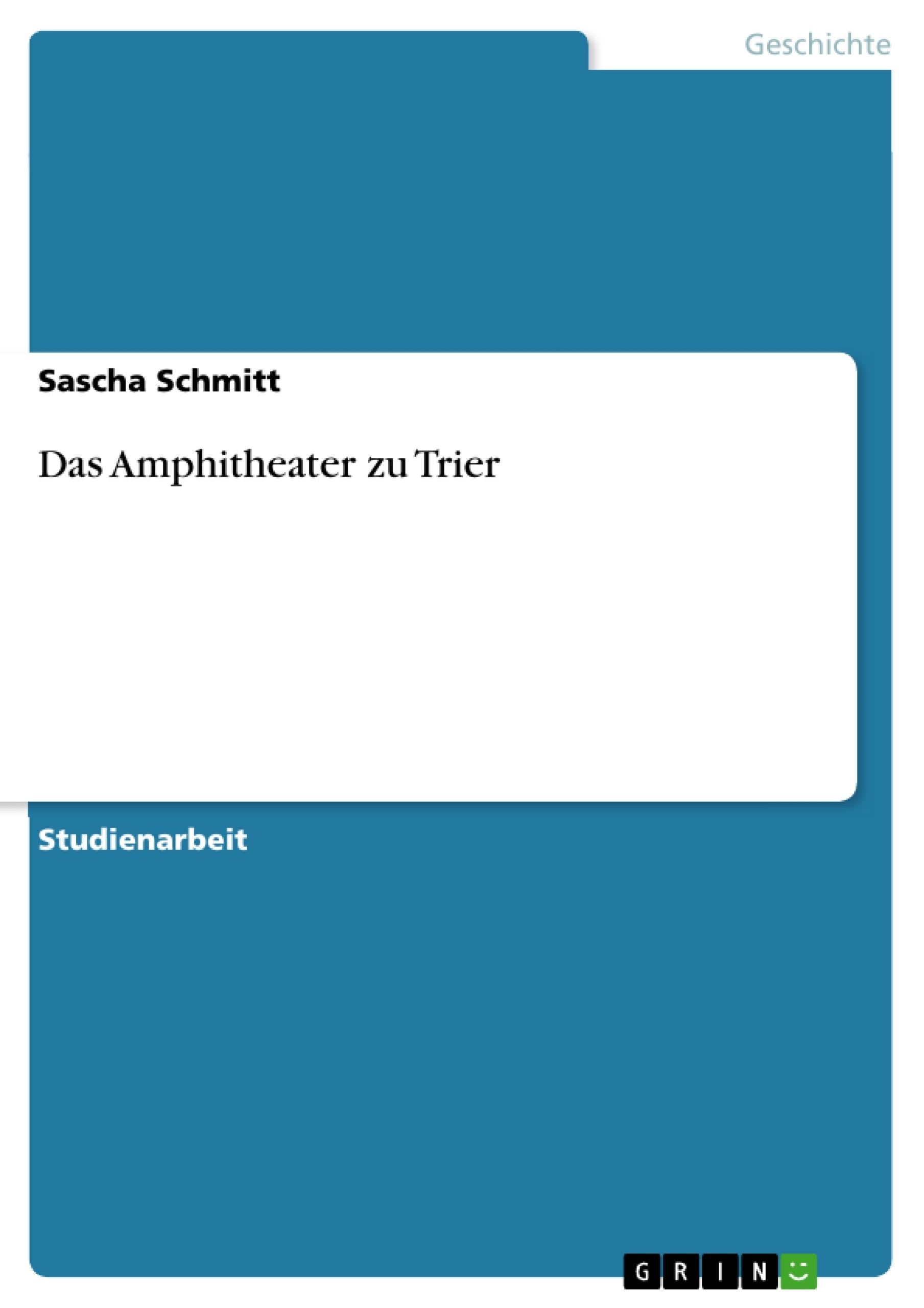Es wird eine Führung durch das Amphiteater in Trier nachgezeichnet. In die Darstellung sind auch dabei entstandene Fragen eingeflossen.
Am Beginn steht ein Überblick über den Bautypus und die Herkunft des antiken Amphiteaters. Im Mittelpunkt steht das Beispiel des Amphiteaters in Trier als eines der zehn größten bisher bekannten antiken Amphitheater. Dabei werden der Hintergrund des Baues der Anlage und ihrer einzelnen Teile sowie die Funktion näher erläutert.
Zum Abschluss wird über die Einbeziehung des Amphitheaters in die Stadtbefestigung und die Verwendung der Anlage nach Ende der römischen Herrschaft berichtet.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Amphitheater: Bautypus und Herkunft
- 3. Das Amphitheater zu Trier
- 3.1 Der Vorgängerbau
- 3.2 Die Hauptzugänge an der Nord- und Südseite
- 3.3 Die Arena
- 3.4 Die Kelleranlagen
- 3.5 Die Zuschauerränge
- 3.6 Größe und Fassungsvermögen der Anlage
- 3.7 Baudurchführung und Mauertechnik
- 3.8 Weitere Funde in der Umgebung der Anlage
- 4. Das Amphitheater als Teil der Stadtbefestigung
- 5. Spätere Nutzung: Fluchtburg, Steinbruch, Weinberg, Kulturdenkmal, Theaterbühne und Konzertarena
- 6. Literaturverzeichnis
- 7. Abbildungsnachweis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit bietet eine Führung durch das Trierer Amphitheater, die sich auf ein Referat vom 5. Juni dieses Jahres stützt und weitere Fragen und Anregungen beinhaltet. Der Text beleuchtet die Bezeichnung und Herkunft des Bautyps „Amphitheater“ und widmet sich anschließend dem spezifischen Beispiel Triers als eines der größten bekannten römischen Amphitheater.
- Der Bautypus „Amphitheater“: Herkunft und Merkmale
- Das Trierer Amphitheater: Hintergrund des Baus
- Die einzelnen Teile der Anlage: Arena, Keller, Zuschauerränge
- Die Einbeziehung des Amphitheaters in die Stadtbefestigung
- Die Nutzung des Amphitheaters nach der römischen Herrschaft
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt den Kontext der Arbeit vor und skizziert den Fokus auf das Trierer Amphitheater. Kapitel 2 befasst sich mit dem Bautypus „Amphitheater“ und erläutert die Bedeutung des Begriffs sowie die Entwicklung des Bauwerks von seinen griechischen Wurzeln bis zur römischen Epoche. Kapitel 3 konzentriert sich auf das Trierer Amphitheater und behandelt den Hintergrund des Baus, die einzelnen Teile der Anlage (Arena, Keller, Zuschauerränge) sowie die Größe und das Fassungsvermögen.
Schlüsselwörter
Amphitheater, Trier, Römische Antike, Bautypus, Stadtbefestigung, Arena, Zuschauerränge, Kelleranlagen, Nutzung, Spätantike.
Häufig gestellte Fragen
Wie groß war das Amphitheater in Trier?
Es gehörte zu den zehn größten antiken Amphitheatern und bot Platz für etwa 18.000 bis 20.000 Zuschauer.
Wann wurde das Trierer Amphitheater erbaut?
Die Anlage wurde Ende des 2. Jahrhunderts n. Chr. errichtet, wobei es Hinweise auf einen hölzernen Vorgängerbau gibt.
Welche Funktion hatten die Kelleranlagen?
Im Keller befand sich eine Hebebühne, mit der Tiere, Gladiatoren oder Dekorationen direkt in die Arena befördert werden konnten.
Wie wurde das Amphitheater nach der Römerzeit genutzt?
Es diente unter anderem als Fluchtburg, Steinbruch für andere Bauten und später sogar als Weinberg, bevor es zum Kulturdenkmal wurde.
War das Amphitheater Teil der Stadtmauer?
Ja, im Zuge der Befestigung Triers wurde das Amphitheater als östliches Stadttor in die römische Stadtmauer integriert.
- Quote paper
- Sascha Schmitt (Author), 2002, Das Amphitheater zu Trier, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/11716