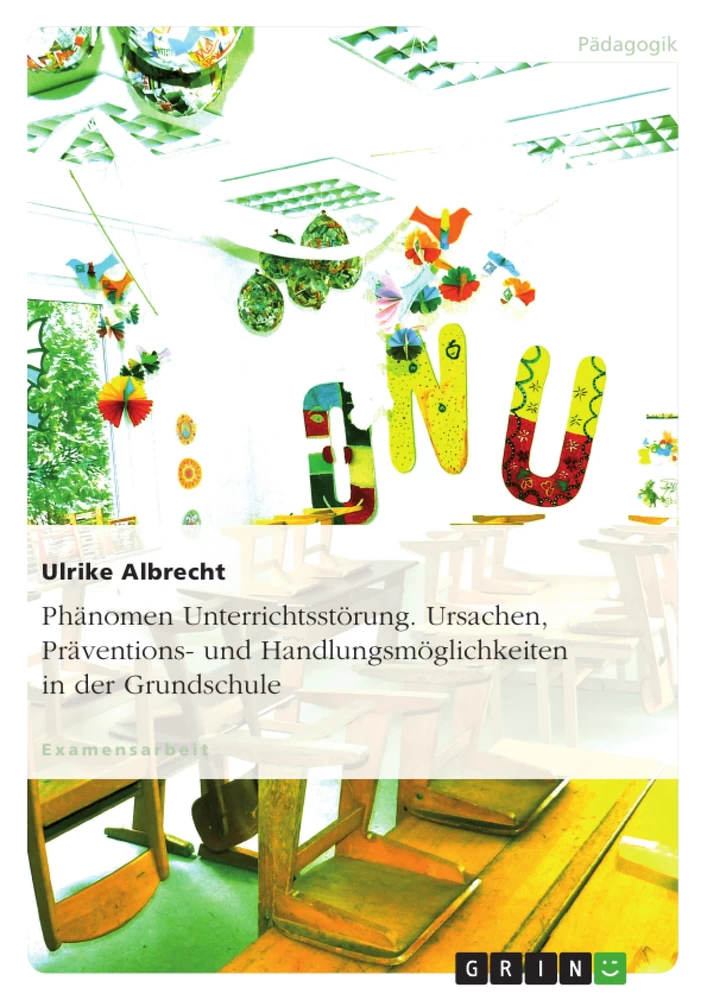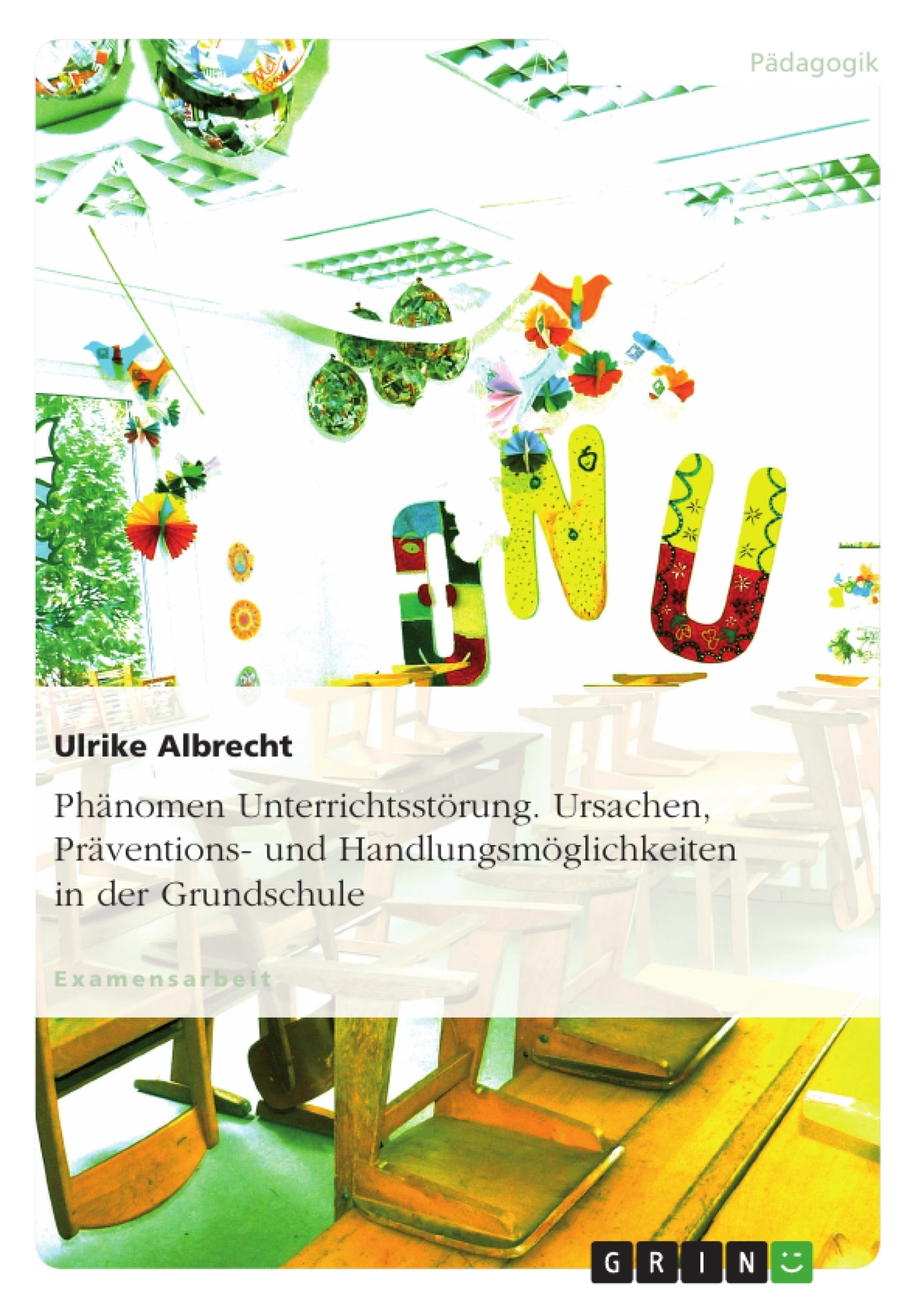Unterrichtsstörungen kommen in jeder noch so vorbildlichen Klasse bzw. Schule vor. Störungen sind Wesensbestandteile von Unterricht, aufgrund gegenseitigen Missverstehens von Schüler und Lehrer. Manche Störungen können reduziert werden, andere lösen sich von selbst oder sind unbehebbar.
In der Grundschule müssen die Schüler sich anfangs erst an bestimmte Regeln und Richtlinien gewöhnen und zusätzlich lernen, dauerhaft 45 Minuten im Klassenraum zu verbringen – meist sitzend auf dem eigenen Platz. Es ist naheliegend, dass dies nach einem turbulenten und bewegungsintensiven Kindergartenvormittag ungewohnt und neu erscheint. In der ersten Klassenstufe treten gewöhnlich Störungen auf, die sich alljährlich zutragen, wenn Neulinge in den Schulalltag starten. Dazu gehören unruhige Verhaltensweisen, „plötzliches Aufstehen“ oder „in die Klasse rufen“. Viele Regeln werden Schülern im Laufe des Schulalltages gelehrt, damit ihnen bewusst wird, dass für ein Zusammenleben in einer Klassengemeinschaft bestimmte Regeln vonnöten sind.
Inzwischen gibt es eine Reihe an Literatur , in der sich die Autoren mit diesem speziellen Thema auseinandergesetzt haben und verschiedene Ratschläge und Lösungen sowie Hinweise geben, bestimmte Unterrichtsstörungen zu vermeiden. Es sind allerdings keine Patentrezepte, die die sofortige Lösung hervorbringen, sondern Verbesserungsvorschläge und Möglichkeiten, Störungen zu verringern. Sie sollen primär zum Nachdenken anregen und nicht unbedingt eins zu eins umgesetzt werden. Es erfordert intensive Arbeit, mit Schülern ein positives Klassenklima herzustellen und dies auch beizubehalten. Man findet immer wieder Schüler mit individuellen Problemen und Niveaustufen. Einige langweilen sich oder sie finden es gerade viel spannender, sich mit ihren gerade neu gefundenen Klassenkameraden zu unterhalten, anstatt dem Unterricht zu folgen.
Allerdings gibt es nicht nur Störungen im Unterricht, die von Schülerseite produziert werden, ihre Gründe können auch anderer Natur sein. Oft stehen die Schüler im Mittelpunkt der Ursache, aber man sollte weitere mögliche Faktoren wie die Lehrkräfte oder soziale Komponenten nicht außer Acht lassen. Lehrer und Schüler können sich gegenseitig als Störfaktoren empfinden und sich demzufolge das Leben erschweren.
Inhaltsverzeichnis
- I Einführung und Aufbau des Themas
- 1 Unterrichtsstörungen in der Grundschule – ein beständiges Problem?
- 2 Struktur der vorliegenden Arbeit
- II „Unterrichtsstörungen“ – Ursachen, Präventionen, Handlungsmöglichkeiten
- 3 Phänomen Unterrichtsstörung
- 3.1 Zum Begriff Unterrichtsstörung
- 3.1.1 Definition nach Karlheinz Biller
- 3.1.2 Definition nach A. und R. Ortner
- 3.1.3 Definition nach Gerd Lohmann
- 3.1.4 Definition nach Rainer Winkel
- 3.2 Graduelle Unterschiede von Unterrichtstörungen
- 3.2.1 Leichte Störungen
- 3.2.2 Indirekte und direkte Störungen
- 3.2.3 Unbehebbare Störungen
- 3.2.4 Unvermeidbare Störungen
- 3.3 Erscheinungsformen von Unterrichtsstörungen
- 3.3.1 Die Clownerie
- 3.3.2 Despektierliches Verhalten
- 3.3.3 Die Provokation
- 3.3.4 Passives Verhalten
- 3.3.5 Zuspätkommen
- 3.3.6 Schülergespräche im Unterricht
- 3.3.7 Vernachlässigung der Hausaufgaben
- 3.3.8 Überziehen der Zeit
- 4 Mögliche Ursachen von Unterrichtsstörungen
- 4.1 Störungsursache „Schüler“
- 4.1.1 Differenzierte Sichtweise der Schüler
- 4.1.2 Veranlagte- und entwicklungsbedingte Störfaktoren
- 4.1.2.1 Konzentrationsschwächen
- 4.1.2.2 Aufmerksamkeitsdefizit-Syndrom (AD(H)S)
- 4.1.2.3 Hochbegabung
- 4.1.3 Bewegungsmangel
- 4.1.4 Langeweile
- 4.1.5 Mitteilungsbedürfnis
- 4.2 Störungsursache „Lehrer“
- 4.2.1 Unterrichtsplanung
- 4.2.2 Verhalten
- 4.2.2.1 Unruhiges Verhalten
- 4.2.2.2 Körpersprache
- 4.2.2.3 Aufmerksamkeit und Konzentration
- 4.2.2.4 Autorität
- 4.2.2.5 Geringe Fachkompetenzen
- 4.2.2.6 Unsicherheit
- 4.3 Störungsursache „Schulische Rahmenbedingungen“
- 4.3.1 Lärmbelästigung durch die Umgebung
- 4.3.2 Randstunden
- 4.3.3 Die Pausen
- 4.4 Störungsursache „Soziale Komponenten“
- 4.4.1 Familiäre Probleme
- 4.4.2 Persönliches Umfeld
- 5 Präventionsmaßnahmen
- 5.1 Präventionen auf Lehrerseite
- 5.1.1 Die Lehrerpersönlichkeit
- 5.1.2 Körpersprache
- 5.1.3 Weiterbildungen
- 5.1.4 Feedback
- 5.2 Schülerverhalten
- 5.2.1 Bewegung
- 5.2.2 Konzentrationsübungen
- 5.3 Rahmenbedingungen
- 5.3.1 Regeln und Richtlinien
- 5.3.2 Klassenraumgestaltung
- 5.3.3 Elternarbeit
- Definition und Erscheinungsformen von Unterrichtsstörungen
- Ursachen von Unterrichtsstörungen aus Schüler-, Lehrer- und Umfeldperspektive
- Präventionsmaßnahmen auf Lehrer-, Schüler- und Organisationsebene
- Analyse gradueller Unterschiede von Unterrichtsstörungen
- Bedeutung von schulischen Rahmenbedingungen und sozialen Komponenten
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht Ursachen, Präventions- und Handlungsmöglichkeiten von Unterrichtsstörungen in der Grundschule. Ziel ist es, ein umfassendes Verständnis für die Komplexität des Phänomens zu entwickeln und praktische Lösungsansätze aufzuzeigen.
Zusammenfassung der Kapitel
I Einführung und Aufbau des Themas: Dieses einleitende Kapitel beschreibt die Entstehung und den Hintergrund der Arbeit. Die Autorin erläutert ihre Motivation, sich mit dem Thema Unterrichtsstörungen auseinanderzusetzen, basierend auf persönlichen Erfahrungen während des Praktikums und akademischen Veranstaltungen. Sie skizziert die Struktur der Arbeit und dankt den beteiligten Schulen für ihre Mitarbeit.
II „Unterrichtsstörungen“ – Ursachen, Präventionen, Handlungsmöglichkeiten: Dieser zentrale Teil der Arbeit gibt eine Übersicht über verschiedene Ursachen, Präventions- und Handlungsmaßnahmen im Umgang mit Unterrichtsstörungen. Er legt den Grundstein für die detaillierte Auseinandersetzung mit dem Thema in den folgenden Kapiteln, indem er verschiedene Definitionen von Unterrichtsstörungen und deren Erscheinungsformen vorstellt und die Komplexität des Problems aufzeigt.
3 Phänomen Unterrichtsstörung: Das Kapitel analysiert das Phänomen der Unterrichtsstörung umfassend. Es beginnt mit verschiedenen Definitionen des Begriffs, die jeweils unterschiedliche Aspekte hervorheben. Anschließend werden graduelle Unterschiede von Störungen (leicht, indirekt, direkt, unbehebbar, unvermeidbar) und konkrete Erscheinungsformen (z.B. Clownerie, Provokation, Passivität) detailliert beschrieben und analysiert. Die unterschiedlichen Definitionsansätze ermöglichen ein differenziertes Verständnis der Vielschichtigkeit von Störverhalten.
4 Mögliche Ursachen von Unterrichtsstörungen: Dieses Kapitel befasst sich eingehend mit den Ursachen von Unterrichtsstörungen, indem es vier Hauptkategorien unterscheidet: Schüler, Lehrer, schulische Rahmenbedingungen und soziale Komponenten. Für jede Kategorie werden verschiedene Faktoren detailliert erörtert. Beispielsweise werden bei den Schülerfaktoren Konzentrationsschwächen, AD(H)S und Hochbegabung ebenso betrachtet wie Bewegungsmangel, Langeweile und das Mitteilungsbedürfnis. Die Lehrerpersönlichkeit, die Unterrichtsplanung und das Lehrerverhalten spielen bei den Lehrerfaktoren eine Rolle, während bei den schulischen Rahmenbedingungen Lärm, Randstunden und Pausen beleuchtet werden. Soziale Komponenten wie familiäre Probleme und das persönliche Umfeld des Schülers werden ebenfalls analysiert. Diese umfassende Betrachtung unterschiedlicher Störungsursachen verdeutlicht die Komplexität des Problems und unterstreicht den Bedarf an ganzheitlichen Lösungsansätzen.
5 Präventionsmaßnahmen: Dieses Kapitel präsentiert verschiedene Präventionsmaßnahmen, die auf Lehrerseite, Schülerseite und auf der Ebene der Rahmenbedingungen angesiedelt sind. Es werden Strategien wie die Förderung der Lehrerpersönlichkeit, die Verbesserung der Körpersprache und Weiterbildungen für Lehrer beschrieben, sowie Maßnahmen zur Förderung von Bewegung und Konzentration bei Schülern und die Bedeutung von Regeln, Klassenraumgestaltung und Elternarbeit hervorgehoben. Die Vielfältigkeit der vorgeschlagenen Maßnahmen unterstreicht den multifaktoriellen Charakter von Unterrichtsstörungen und den Bedarf an einem ganzheitlichen Ansatz in der Prävention.
Schlüsselwörter
Unterrichtsstörungen, Grundschule, Prävention, Handlungsmöglichkeiten, Schülerverhalten, Lehrerverhalten, schulische Rahmenbedingungen, soziale Komponenten, Konzentrationsschwäche, AD(H)S, Hochbegabung, Unterrichtsplanung, Elternarbeit.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Arbeit: Unterrichtsstörungen in der Grundschule
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Die Arbeit untersucht umfassend das Phänomen von Unterrichtsstörungen in der Grundschule. Sie befasst sich mit Definitionen, Erscheinungsformen, Ursachen und Präventionsmaßnahmen sowie Handlungsmöglichkeiten im Umgang mit diesen Störungen.
Welche Definitionen von Unterrichtsstörungen werden betrachtet?
Die Arbeit analysiert verschiedene Definitionen von Unterrichtsstörungen nach Karlheinz Biller, A. und R. Ortner, Gerd Lohmann und Rainer Winkel. Dadurch wird die Vielschichtigkeit des Begriffs und die unterschiedlichen Aspekte, die in den Definitionen betont werden, deutlich gemacht.
Welche Arten von Unterrichtsstörungen werden unterschieden?
Es werden graduelle Unterschiede von Unterrichtsstörungen beschrieben: leichte Störungen, indirekte und direkte Störungen, unbehebbare und unvermeidbare Störungen. Darüber hinaus werden konkrete Erscheinungsformen wie Clownerie, despektierliches Verhalten, Provokation, passives Verhalten, Zuspätkommen, Schülergespräche, Vernachlässigung der Hausaufgaben und Zeitüberschreitungen analysiert.
Welche Ursachen für Unterrichtsstörungen werden untersucht?
Die Arbeit differenziert die Ursachen von Unterrichtsstörungen in vier Hauptkategorien: Schüler (z.B. Konzentrationsschwächen, AD(H)S, Hochbegabung, Langeweile), Lehrer (z.B. Unterrichtsplanung, Verhalten, Kompetenz), schulische Rahmenbedingungen (z.B. Lärm, Randstunden, Pausen) und soziale Komponenten (z.B. familiäre Probleme, persönliches Umfeld).
Welche Präventionsmaßnahmen werden vorgeschlagen?
Die Arbeit präsentiert Präventionsmaßnahmen auf drei Ebenen: Lehrerseite (z.B. Lehrerpersönlichkeit, Körpersprache, Weiterbildungen, Feedback), Schülerseite (z.B. Bewegung, Konzentrationsübungen) und Rahmenbedingungen (z.B. Regeln, Klassenraumgestaltung, Elternarbeit). Der multifaktorielle Charakter von Unterrichtsstörungen wird betont, und ein ganzheitlicher Ansatz wird befürwortet.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einführung, ein Kapitel zum Phänomen Unterrichtsstörung mit Definitionen und Erscheinungsformen, ein Kapitel zu den Ursachen von Unterrichtsstörungen, und ein Kapitel zu Präventionsmaßnahmen. Die Einführung beschreibt den Aufbau und die Motivation der Arbeit. Die Zusammenfassung der Kapitel gibt einen detaillierten Überblick über den Inhalt jedes Kapitels.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Ziel der Arbeit ist es, ein umfassendes Verständnis für die Komplexität des Phänomens „Unterrichtsstörungen“ zu entwickeln und praktische Lösungsansätze aufzuzeigen. Die Arbeit möchte Ursachen, Präventions- und Handlungsmöglichkeiten von Unterrichtsstörungen in der Grundschule untersuchen.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Unterrichtsstörungen, Grundschule, Prävention, Handlungsmöglichkeiten, Schülerverhalten, Lehrerverhalten, schulische Rahmenbedingungen, soziale Komponenten, Konzentrationsschwäche, AD(H)S, Hochbegabung, Unterrichtsplanung, Elternarbeit.
- Citar trabajo
- Ulrike Albrecht (Autor), 2006, Phänomen Unterrichtsstörung. Ursachen, Präventions- und Handlungsmöglichkeiten in der Grundschule, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/117224