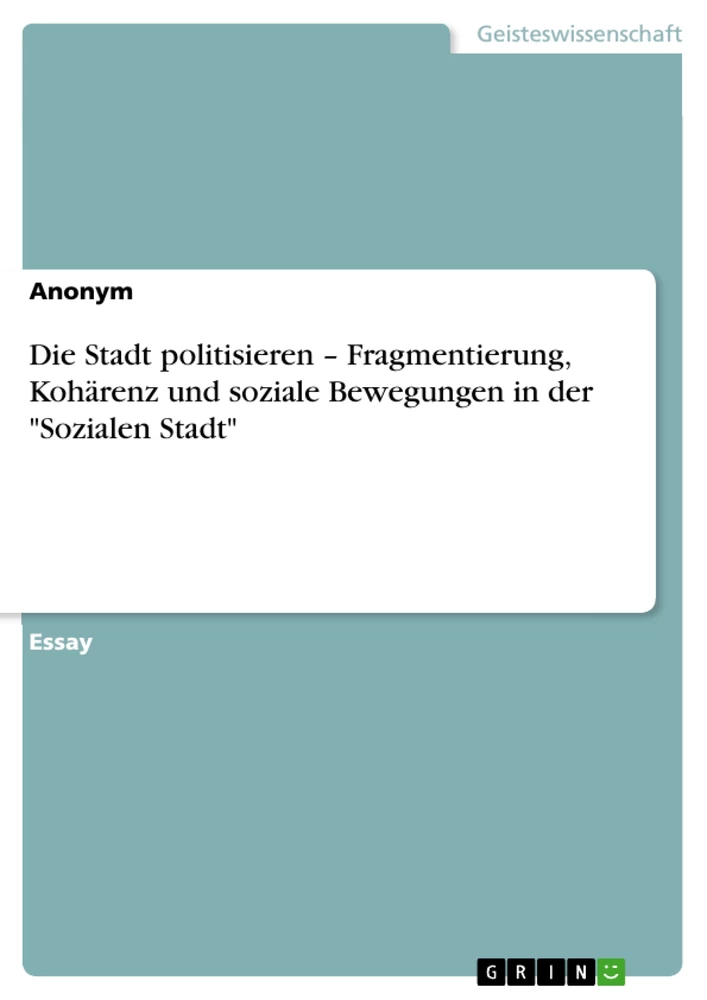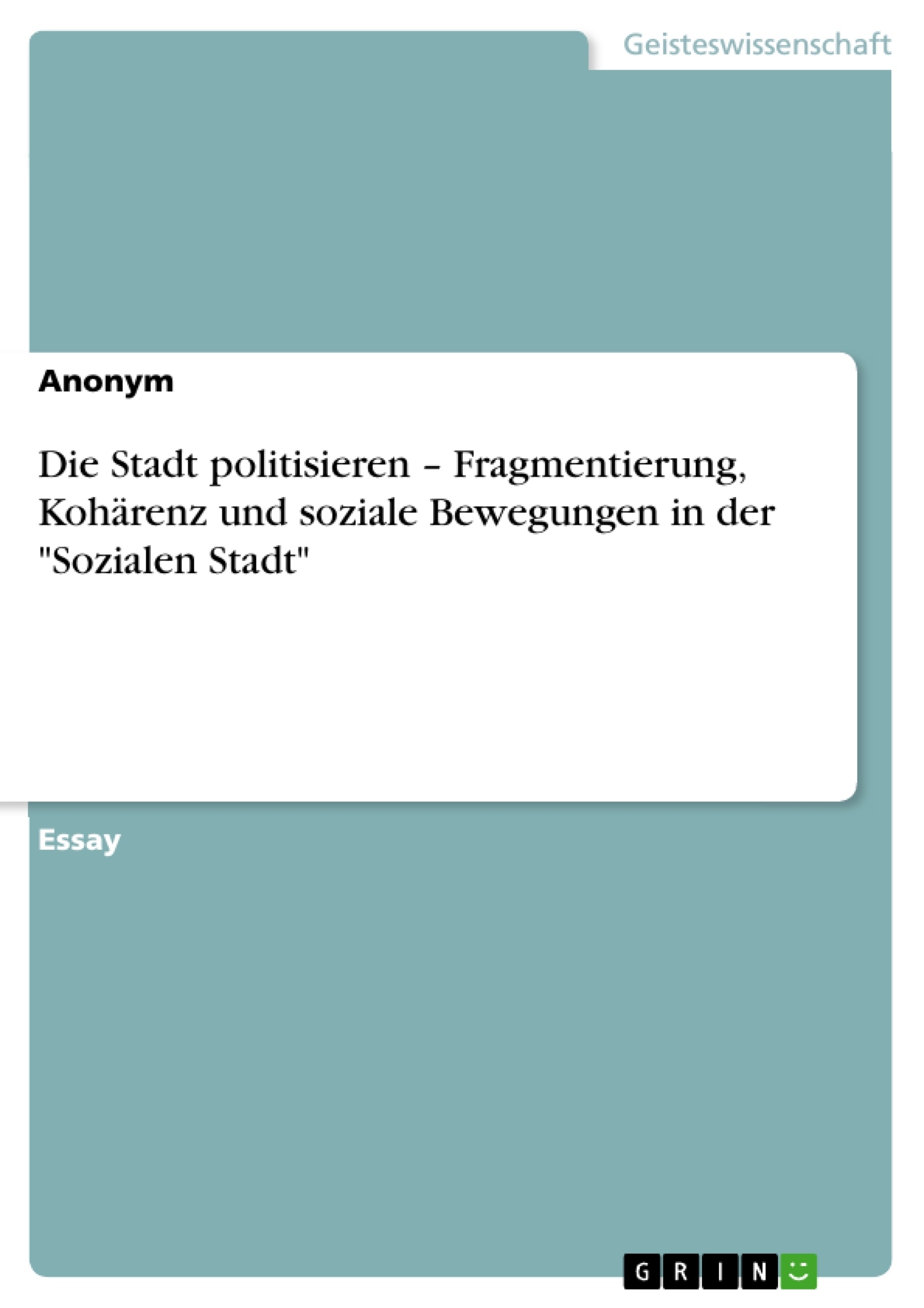Antworten auf die Fragen:
Wie kritisieren Holm und Lebuhn die Quartierspolitik im Rahmen der ‚Sozialen Stadt‘?
Wie begründen die Autoren das aus ihrer Sicht „problematische Verhältnis“ von Sozialen Bewegungen und deren Mobilisierungen und „Soziale-Stadt-Programme“?
Welche Perspektiven werden im Zusammenhang von Migration und Stadtpolitik diskutiert?
Inhaltsverzeichnis
- Wie kritisieren Holm und Lebuhn die Quartierspolitik im Rahmen der „Sozialen Stadt“?
- Wie begründen die Autoren das aus ihrer Sicht „problematische Verhältnis“ von Sozialen Bewegungen und deren Mobilisierungen und „Soziale-Stadt-Programme“?
- Welche Perspektiven werden im Zusammenhang von Migration und Stadtpolitik diskutiert?
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit analysiert die Kritik von Holm und Lebuhn an der Quartierspolitik im Rahmen des Programms „Soziale Stadt“ und untersucht das komplexe Verhältnis zwischen sozialen Bewegungen und diesen Programmen. Besonders wird der Fokus auf die Rolle von Migration in der Stadtpolitik gelegt.
- Kritik an der Quartierspolitik „Soziale Stadt“
- Das Verhältnis zwischen sozialen Bewegungen und „Soziale-Stadt-Programmen“
- Migration und Stadtpolitik
- Soziale Ungleichheit und Verdrängungsprozesse
- Bürgerbeteiligung und Partizipation
Zusammenfassung der Kapitel
Wie kritisieren Holm und Lebuhn die Quartierspolitik im Rahmen der „Sozialen Stadt“?: Holm und Lebuhn kritisieren die „Soziale Stadt“-Politik, da die quartiersbezogenen Interventionsprogramme oft mit Kürzungen in der Wohnungs- und Arbeitsmarktpolitik einhergehen. Sie sehen die Programme als postpolitisch, da sie konfliktträchtige Themen vermeiden und auf Konsens setzen. Die Beteiligung der Bevölkerung wird als selektiv kritisiert, da marginalisierte Gruppen nur schwer erreicht werden. Die Autoren heben die beschränkte Reichweite und den ungleichen Zugang zur Beteiligung hervor.
Wie begründen die Autoren das aus ihrer Sicht „problematische Verhältnis“ von Sozialen Bewegungen und deren Mobilisierungen und „Soziale-Stadt-Programme“?: Die Autoren analysieren das schwierige Verhältnis zwischen sozialen Bewegungen und den „Soziale Stadt“-Programmen, insbesondere im Kontext von Miet- und Migrationspolitik in Berlin. Sie zeigen auf, dass die Programme aufgrund von Ressourcenmangel, institutionellen Eigenlogiken und einer auf Aufwertung ausgerichteten Konzeption nur begrenzt soziale Bewegungen unterstützen können. Die Konzentration auf Imagewandel anstatt auf die Lösung gravierender Probleme wie Verdrängungsprozesse wird als zentraler Konfliktpunkt genannt. Die mangelnde Zusammenarbeit mit migrantischen Initiativen wird auf die Auswahl der Partner durch das Quartiersmanagement und die im Bundesprogramm festgelegte inhaltliche Dimension zurückgeführt.
Welche Perspektiven werden im Zusammenhang von Migration und Stadtpolitik diskutiert?: Am Beispiel Brasilien und Los Angeles zeigen die Autoren, wie städtische Programme und soziale Bewegungen gemeinsam zu Verbesserungen beitragen können. Sie plädieren für eine stärkere Berücksichtigung von Migration in der Stadtpolitik, fordern eine Abkehr von Konsensorientierung hin zu einer Politik, die soziale und politische Widersprüche und Forderungen ernst nimmt und Migranten als gleichberechtigte Akteure anerkennt. Nur so könne eine wirklich „soziale Stadt“ entstehen.
Schlüsselwörter
Soziale Stadt, Quartierspolitik, soziale Bewegungen, Migration, Stadtpolitik, soziale Ungleichheit, Verdrängung, Bürgerbeteiligung, Partizipation, soziale Kohäsion, Integration.
Holm & Lebuhn: Kritik an der Quartierspolitik „Soziale Stadt“ - FAQ
Was ist der Hauptfokus dieser Arbeit?
Die Arbeit analysiert die Kritik von Holm und Lebuhn an der Quartierspolitik im Rahmen des Programms „Soziale Stadt“, untersucht das Verhältnis zwischen sozialen Bewegungen und diesen Programmen und legt einen besonderen Fokus auf die Rolle von Migration in der Stadtpolitik.
Wie kritisieren Holm und Lebuhn die „Soziale Stadt“-Politik?
Holm und Lebuhn kritisieren die „Soziale Stadt“-Politik aufgrund der oft gleichzeitig stattfindenden Kürzungen in der Wohnungs- und Arbeitsmarktpolitik. Sie sehen die Programme als postpolitisch, da konfliktträchtige Themen vermieden und auf Konsens gesetzt wird. Die Beteiligung der Bevölkerung wird als selektiv kritisiert, da marginalisierte Gruppen nur schwer erreicht werden. Die beschränkte Reichweite und der ungleiche Zugang zur Beteiligung werden ebenfalls hervorgehoben.
Wie beschreiben die Autoren das Verhältnis zwischen sozialen Bewegungen und den „Soziale Stadt“-Programmen?
Die Autoren beschreiben ein schwieriges Verhältnis, besonders im Kontext von Miet- und Migrationspolitik in Berlin. Ressourcenmangel, institutionelle Eigenlogiken und eine auf Aufwertung ausgerichtete Konzeption der Programme behindern die Unterstützung sozialer Bewegungen. Der Fokus auf Imagewandel anstatt auf die Lösung gravierender Probleme wie Verdrängungsprozesse wird als zentraler Konfliktpunkt genannt. Die mangelnde Zusammenarbeit mit migrantischen Initiativen wird auf die Auswahl der Partner durch das Quartiersmanagement und die im Bundesprogramm festgelegte inhaltliche Dimension zurückgeführt.
Welche Perspektiven zur Migration und Stadtpolitik werden diskutiert?
Am Beispiel Brasilien und Los Angeles zeigen die Autoren, wie städtische Programme und soziale Bewegungen gemeinsam zu Verbesserungen beitragen können. Sie plädieren für eine stärkere Berücksichtigung von Migration in der Stadtpolitik, fordern eine Abkehr von Konsensorientierung hin zu einer Politik, die soziale und politische Widersprüche und Forderungen ernst nimmt und Migranten als gleichberechtigte Akteure anerkennt. Nur so könne eine wirklich „soziale Stadt“ entstehen.
Welche Schlüsselthemen werden in der Arbeit behandelt?
Schlüsselthemen sind Soziale Stadt, Quartierspolitik, soziale Bewegungen, Migration, Stadtpolitik, soziale Ungleichheit, Verdrängung, Bürgerbeteiligung, Partizipation, soziale Kohäsion und Integration.
Welche zentralen Kritikpunkte an der "Sozialen Stadt" werden genannt?
Zentrale Kritikpunkte sind die gleichzeitige Kürzung anderer wichtiger sozialpolitischer Maßnahmen, die Vermeidung von Konflikten und der Fokus auf Konsens anstatt auf die Bearbeitung sozialer Probleme, die selektive Beteiligung der Bevölkerung und die beschränkte Reichweite der Programme.
Wie wird die Rolle der Migration in der Stadtpolitik bewertet?
Die Autoren betonen die Notwendigkeit einer stärkeren Berücksichtigung von Migration in der Stadtpolitik und fordern eine Politik, die Migranten als gleichberechtigte Akteure anerkennt und soziale und politische Widersprüche ernst nimmt.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2020, Die Stadt politisieren – Fragmentierung, Kohärenz und soziale Bewegungen in der "Sozialen Stadt", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1172332