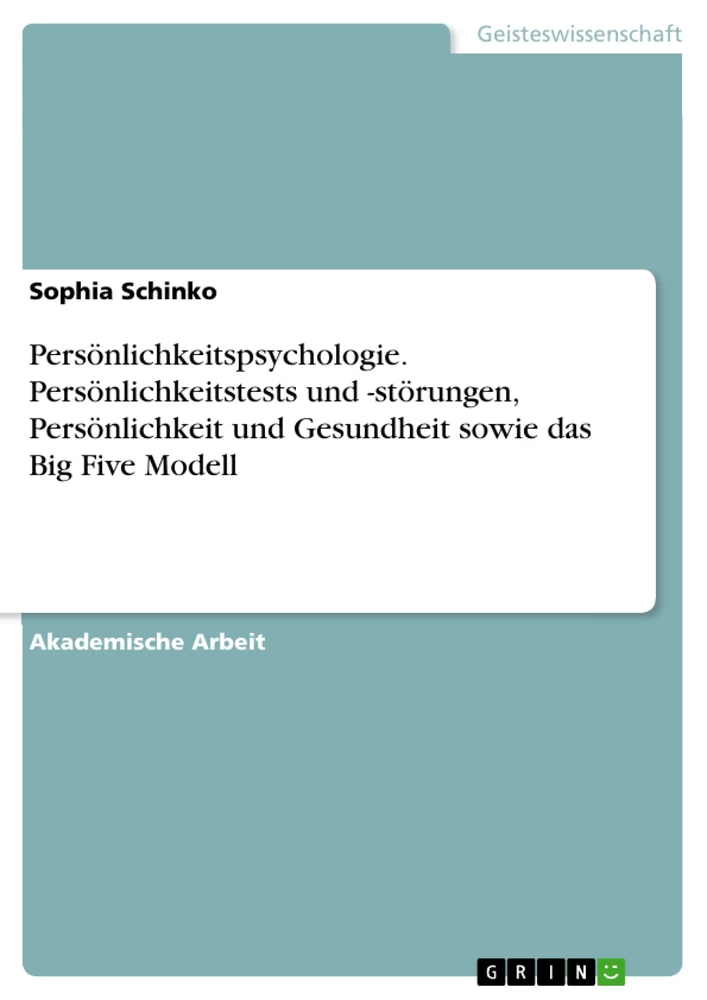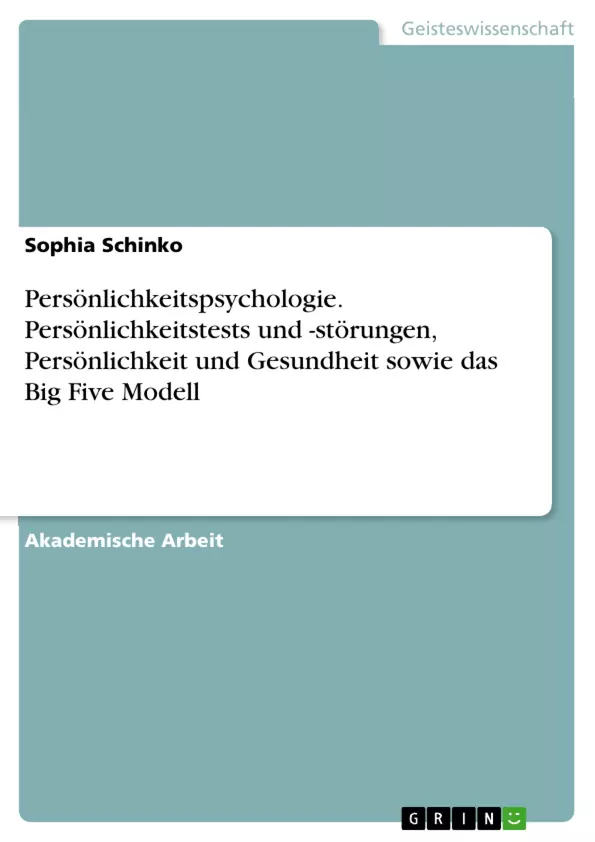Die Arbeit thematisiert die Themenbereiche Persönlichkeitstests und Persönlichkeitsstörungen, Persönlichkeit und Gesundheit sowie das Big Five Modell. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt gibt es keine allgemein anerkannte Definition des Begriffs Persönlichkeit in der Psychologie. Viele Definitionen haben jedoch gemeinsam, dass mit dem Begriff der Persönlichkeit die Einzigartigkeit und die über die Zeit und Situation hinweg relative Stabilität von Strukturen und Prozessen angesprochen wird, mit denen das Verhalten von Individuen beschrieben, erklärt und vorhergesagt werden kann.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Persönlichkeitstests und Persönlichkeitsstörungen
- 1.1 Definition der Persönlichkeit
- 1.2 Gütekriterien für Testverfahren am Beispiel von Persönlichkeitstests
- 1.2.1 Hauptgütekriterium Objektivität
- 1.2.2 Hauptgütekriterium Reliabilität
- 1.2.3 Hauptgütekriterium Validität
- 1.2.4 Nebengütekriterien
- 1.3 Persönlichkeitsstörung Borderline
- 1.3.1 Definition von Persönlichkeitsstörungen
- 1.3.2 Borderline Persönlichkeitsstörung (BPS)
- 1.3.3 Diagnose einer Borderline Persönlichkeitsstörung
- 2. Persönlichkeit und Gesundheit
- 2.1 Begriffserklärung Persönlichkeit und Gesundheit
- 2.2 Zusammenhang von Persönlichkeitsmerkmalen und Gesundheit/Krankheit
- 2.3 Gesundheitsrelevante Persönlichkeitsmerkmale
- 2.4 Salutogenese
- 2.5 Der Kohärenzsinn
- 2.6 Führung und Kohärenzsinn
- 3. Big Five Modell
- 3.1 Allgemeine Erläuterung
- 3.2 Die Big Five
- 3.3 Bedeutung in der Personalauswahl
- 3.4 Big Five Eigenschaften für die Auswahl von Juristen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit verschiedenen Aspekten der Persönlichkeitspsychologie. Ziel ist es, ein umfassendes Verständnis von Persönlichkeitstests, Persönlichkeitsstörungen, dem Zusammenhang zwischen Persönlichkeit und Gesundheit sowie dem Big Five Modell zu vermitteln. Der Fokus liegt auf der kritischen Auseinandersetzung mit den Gütekriterien von Persönlichkeitstests und der Bedeutung von Persönlichkeitsmerkmalen in verschiedenen Kontexten.
- Gütekriterien von Persönlichkeitstests (Objektivität, Reliabilität, Validität)
- Persönlichkeitsstörungen, insbesondere die Borderline-Persönlichkeitsstörung
- Zusammenhang zwischen Persönlichkeit und Gesundheit
- Das Big Five Modell der Persönlichkeit
- Anwendungsbeispiele in der Personalauswahl
Zusammenfassung der Kapitel
1. Persönlichkeitstests und Persönlichkeitsstörungen: Dieses Kapitel führt in die Thematik der Persönlichkeitspsychologie ein und diskutiert zunächst verschiedene Definitionen des Begriffs "Persönlichkeit". Im Anschluss werden die zentralen Gütekriterien für Testverfahren, Objektivität, Reliabilität und Validität, detailliert erläutert und anhand von Persönlichkeitstests veranschaulicht. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Beschreibung und Diagnose von Persönlichkeitsstörungen, wobei die Borderline-Persönlichkeitsstörung als Beispiel ausführlich behandelt wird. Der Abschnitt verbindet theoretische Grundlagen mit praktischen Aspekten der Testkonstruktion und -auswertung.
2. Persönlichkeit und Gesundheit: Dieses Kapitel untersucht den komplexen Zusammenhang zwischen Persönlichkeit und Gesundheit. Es definiert die Begriffe und beleuchtet den Einfluss von Persönlichkeitsmerkmalen auf die Entstehung und den Verlauf von Krankheiten. Der Fokus liegt auf gesundheitsrelevanten Persönlichkeitsmerkmalen und dem salutogenetischen Ansatz, insbesondere dem Kohärenzsinn, und dessen Bedeutung für die Gesundheit und Führungsstile. Das Kapitel verbindet verschiedene theoretische Modelle und empirische Befunde.
3. Big Five Modell: Das Kapitel widmet sich dem Big Five Modell der Persönlichkeit, beschreibt die fünf Faktoren und deren Bedeutung in der Personalauswahl. Besonders wird die Anwendbarkeit des Modells auf die Auswahl von Juristen thematisiert, unter Berücksichtigung der spezifischen Anforderungen dieses Berufsbildes. Die Bedeutung des Modells für die Personalpsychologie wird deutlich herausgearbeitet.
Schlüsselwörter
Persönlichkeit, Persönlichkeitstests, Persönlichkeitsstörungen, Borderline-Persönlichkeitsstörung, Gütekriterien, Objektivität, Reliabilität, Validität, Gesundheit, Krankheit, Salutogenese, Kohärenzsinn, Big Five Modell, Personalauswahl, Juristen.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Persönlichkeitstests, Persönlichkeitsstörungen und das Big Five Modell
Was ist der Inhalt dieses Dokuments?
Dieses Dokument bietet einen umfassenden Überblick über die Persönlichkeitspsychologie. Es behandelt Persönlichkeitstests, Persönlichkeitsstörungen (insbesondere die Borderline-Persönlichkeitsstörung), den Zusammenhang zwischen Persönlichkeit und Gesundheit, sowie das Big Five Modell der Persönlichkeit. Der Fokus liegt auf der kritischen Betrachtung der Gütekriterien von Persönlichkeitstests und der Anwendung von Persönlichkeitsmerkmalen in verschiedenen Kontexten, beispielsweise in der Personalauswahl.
Welche Themen werden im Einzelnen behandelt?
Die Arbeit gliedert sich in drei Hauptkapitel: Kapitel 1 behandelt Persönlichkeitstests und Persönlichkeitsstörungen, inklusive einer detaillierten Erklärung der Gütekriterien (Objektivität, Reliabilität, Validität) und einer Beschreibung der Borderline-Persönlichkeitsstörung. Kapitel 2 erörtert den Zusammenhang zwischen Persönlichkeit und Gesundheit, den salutogenetischen Ansatz und den Kohärenzsinn. Kapitel 3 widmet sich dem Big Five Modell, seinen fünf Faktoren und seiner Bedeutung in der Personalauswahl, insbesondere für Juristen.
Welche Gütekriterien werden bei Persönlichkeitstests betrachtet?
Die Hauptgütekriterien Objektivität, Reliabilität und Validität werden ausführlich erklärt und anhand von Beispielen aus der Praxis von Persönlichkeitstests veranschaulicht. Zusätzlich werden Nebengütekriterien erwähnt.
Welche Persönlichkeitsstörung wird im Detail behandelt?
Die Borderline-Persönlichkeitsstörung (BPS) wird als Beispiel für eine Persönlichkeitsstörung ausführlich beschrieben, inklusive Definition, Diagnose und relevanter Aspekte.
Wie wird der Zusammenhang zwischen Persönlichkeit und Gesundheit dargestellt?
Das Dokument untersucht den Einfluss von Persönlichkeitsmerkmalen auf Gesundheit und Krankheit. Es erläutert den salutogenetischen Ansatz und die Bedeutung des Kohärenzsinns für die Gesundheit und Führungsstile.
Was ist das Big Five Modell und welche Bedeutung hat es?
Das Big Five Modell beschreibt fünf grundlegende Persönlichkeitsdimensionen. Die Arbeit erläutert diese Dimensionen und ihre Bedeutung in der Personalauswahl, insbesondere im Kontext der Auswahl von Juristen, unter Berücksichtigung der spezifischen Anforderungen dieses Berufsfeldes.
Für wen ist dieses Dokument relevant?
Dieses Dokument richtet sich an Leser, die sich umfassend mit der Persönlichkeitspsychologie auseinandersetzen möchten. Es ist besonders relevant für Studierende der Psychologie, aber auch für alle, die sich für Persönlichkeitstests, Persönlichkeitsstörungen, den Zusammenhang von Persönlichkeit und Gesundheit sowie die Anwendung von Persönlichkeitsmodellen in der Personalauswahl interessieren.
Welche Schlüsselbegriffe werden in diesem Dokument verwendet?
Wichtige Schlüsselbegriffe sind: Persönlichkeit, Persönlichkeitstests, Persönlichkeitsstörungen, Borderline-Persönlichkeitsstörung, Gütekriterien (Objektivität, Reliabilität, Validität), Gesundheit, Krankheit, Salutogenese, Kohärenzsinn, Big Five Modell, Personalauswahl, Juristen.
- Citar trabajo
- Sophia Schinko (Autor), 2021, Persönlichkeitspsychologie. Persönlichkeitstests und -störungen, Persönlichkeit und Gesundheit sowie das Big Five Modell, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1172516