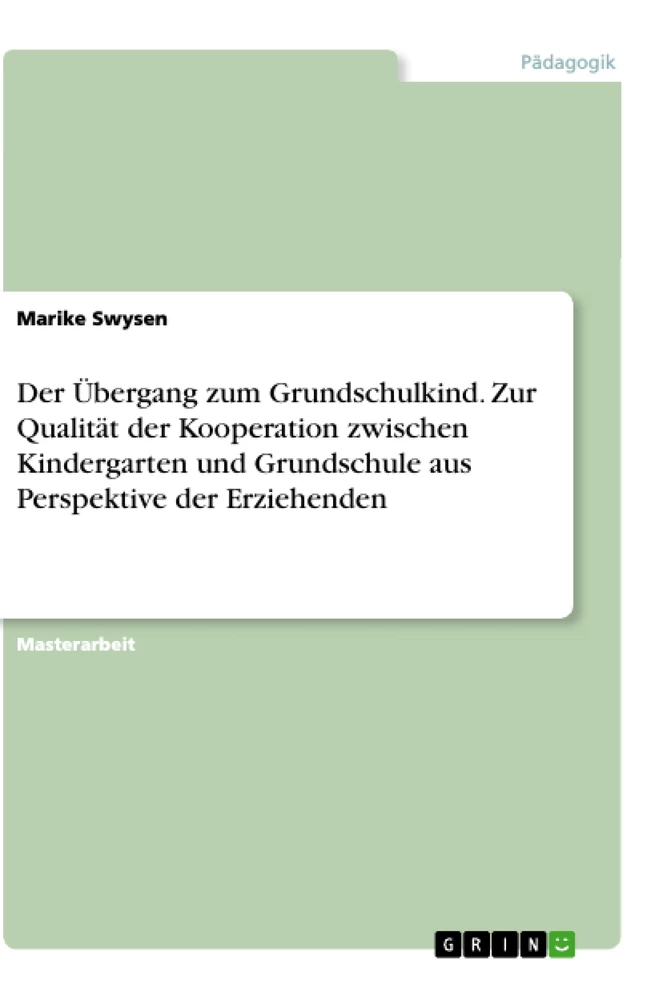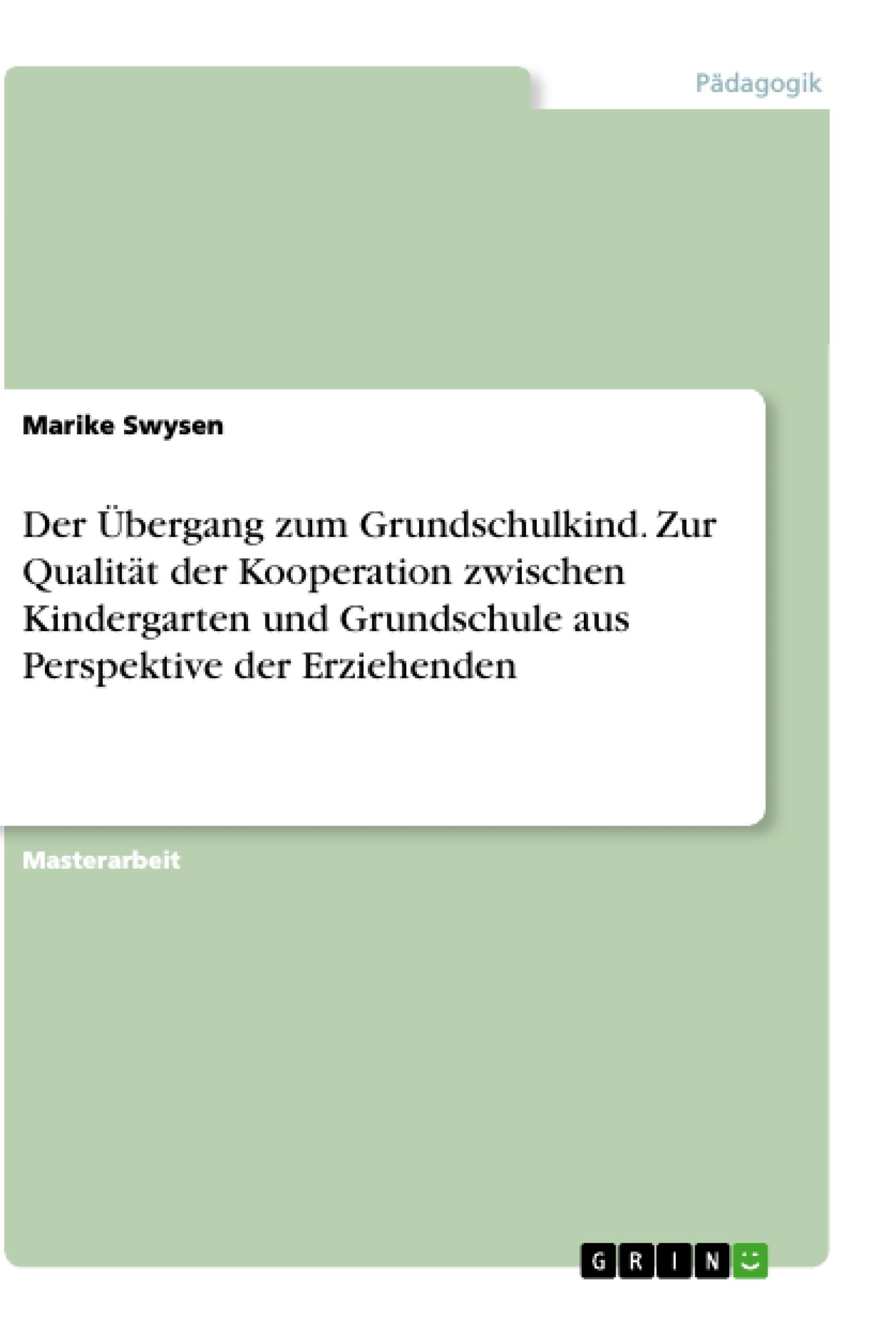Die vorliegende Arbeit gliedert sich formal in drei Hauptteile. In Kapitel zwei, der Übergang vom Kindergarten in die Grundschule werden zunächst die Modelle vorgestellt, welche als Grundlage für das beschriebene Transitionsmodell von Griebel und Niesel dienen. Wie aus dem Modell hervorgeht, hat jedes Kind beim Übergang unterschiedliche Anforderungen zu bewältigen. Da diese individuellen Anforderungen unter anderem die Kooperationsarbeit ausmachen, werden diese mit Blick auf die Temperamentseigenschaften und die Bedeutung der Resilienz dargestellt sowie die Faktoren für die Übergangskompetenz vorgestellt. Das Kapitel schließt mit einer Definition von Schulfähigkeit.
Das zweite Thema, welches im dritten Kapitel beginnt, beschäftigt sich mit dem theoretischen Hintergrund der Kooperation zwischen Kindergarten und Grundschule. Zunächst werden die Ziele der Kooperation (3.1) definiert und anschließend die Voraussetzungen für eine gelingende Kooperation erläutert (3.2). Danach werden die möglichen Anlässe zur Kooperation und Formen vorgestellt; dabei wird nach jenen Formen differenziert, die jeweils die Beteiligung zwischen aller beteiligten Akteure (Fachkräfte, Eltern, Kinder) in den Blick nimmt (3.3). Abschließend werden die
Herausforderungen beschrieben, die die Kooperation erschweren (können) (3.4).
Der empirische Rahmen gliedert sich in vier Kapitel. In Kapitel vier wird das Forschungsvorhaben und die Intension dazu erläutert. Danach werden in Kapitel fünf die Forschungsmethoden vorgestellt. Hierbei wird das problemorientierte Interview nach Witzel als Forschungsmethode näher erläutert. Da das subjektive Empfinden zentral für das Forschungsvorhaben ist, wird in diesem Kapitel auf einen der Grundsätze qualitativer Forschung, die Subjektivität, näher eingegangen sowie der Bezug zum symbolischen Interaktionismus hergestellt. Die Auswahl der Interviewpartner*innen wird begründet (5.1.4) und es erfolgt eine Reflexion des Datenerhebungsprozesses (5.1.5). In Kapitel 5.2 wird die inhaltlich strukturierte Inhaltsanalyse nach Kuckartz als Datenauswertungsmethode vorgestellt. Im sechsten
Kapitel wird das Vorgehen der Analyse vorgestellt und die Ergebnisse anschließend vorgestellt (6.3). Das Kapitel schließt mit einer Zusammenfassung der Ergebnisse ab. Im siebten Kapitel werden die Ergebnisse in Verbindung mit den theoretischen Erkenntnissen und den gesetzlichen Grundlagen zur Kooperation diskutiert.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Der Übergang vom Kindergarten in die Grundschule.....
- Transitionsforschung
- Das Familien-Transitionsmodell..\n
- Der ökopsychologische Ansatz von Bronfenbrenner.\n
- Stressansatz nach Lazarus
- Die Theorie der kritischen Ereignisse.\n
- Transition als Ko-konstruktiver Prozess\n
- Individuelle Anforderungen..\n
- Temperamentseigenschaften\n
- Die Bedeutung der Resilienz bei der Übergangsbewältigung\n
- Übergangskompetenz...\n
- Schulfähigkeit als soziale Kompetenz…......\n
- Kooperation zwischen Kindergarten und Grundschule.......\n
- Ziele interinstitutioneller Kooperation.......\n
- Voraussetzungen für eine gelingende Kooperation.\n
- Anlässe und Formen interinstitutioneller Kooperation.......\n
- Interaktionen zwischen Erzieher*innen und Lehrkräften..\n
- Interaktionen zwischen Fachkräften und Kita- & Grundschulkindern...31\n
- Interaktionen zwischen Fachkräften und den Eltern.\n
- Herausforderungen und Erschwernisse interinstitutioneller Kooperation ……………..\n
- Kindergarten und Grundschule als getrennte Organisationen\n
- Integrität des eigenen Bildungsauftrages..........\n
- Kommunikationsdefizite.\n
- Kooperation als Arbeitsbelastung.\n
- Intension und Forschungsziel\n
- Forschungsmethoden..\n
- Datenerhebungsmethode…...\n
- Subjektivität und Symbolischer Interaktionismus\n
- Das problemzentrierte Interview als Methode der Datenerhebung\n
- Transkription.\n
- Auswahl der Interviewpartner*innen.\n
- Reflexion der Datenerhebung ...\n
- Datenauswertungsmethode:\nDie inhaltlich strukturierende qualitative Inhaltsanalyse.\n
- Auswertung der erhobenen Daten.\n
- Soziodemografische Angaben der Befragten.\n
- Entwicklung des Kategoriensystems.\n
- Darstellung der Ergebnisse\n
- Kooperation …………………..\n
- Der Übergang aus Sicht der Erzieher*innen\n
- Herausforderungen....\n
- Wahrnehmung der Erzieher*innen\n
- Zusammenfassung der Ergebnisse.....\n
- Diskussion der Ergebnisse.......\n
- Fazit und Ausblick\n
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Masterarbeit befasst sich mit der Qualität der Kooperation zwischen Kindergarten und Grundschule aus der Perspektive der Erzieher*innen. Sie untersucht den Übergangsprozess vom Kindergarten in die Grundschule als eine bedeutsame Phase in der kindlichen Entwicklung und betrachtet die Herausforderungen und Chancen, die mit dieser Transition einhergehen.
- Die Bedeutung des Übergangs vom Kindergarten in die Grundschule für die Entwicklung des Kindes
- Die Rolle der Kooperation zwischen Kindergarten und Grundschule im Übergangsprozess
- Die Herausforderungen und Möglichkeiten der interinstitutionellen Zusammenarbeit
- Die Wahrnehmung des Übergangs durch die Erzieher*innen
- Die Bedeutung von Transitionen und deren Einfluss auf die Identität des Kindes
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, die die Ausgangslage und Problemstellung beleuchtet. Sie erläutert die Bedeutung des Übergangs vom Kindergarten in die Grundschule und die Relevanz einer gelingenden Kooperation zwischen den beiden Institutionen. Anschließend werden theoretische Grundlagen der Transitionsforschung vorgestellt, die unterschiedliche Perspektiven auf Transitionen beleuchten. Dabei werden verschiedene Ansätze betrachtet, darunter das Familien-Transitionsmodell, der ökopsychologische Ansatz von Bronfenbrenner, der Stressansatz nach Lazarus, die Theorie der kritischen Ereignisse und die Betrachtung der Transition als Ko-konstruktiver Prozess. Es werden auch individuelle Anforderungen im Übergangsprozess beleuchtet, die sich aus Temperamentseigenschaften, Resilienz, Übergangskompetenz und Schulfähigkeit als sozialer Kompetenz ergeben.
Im dritten Kapitel wird die Kooperation zwischen Kindergarten und Grundschule näher beleuchtet. Die Ziele interinstitutioneller Kooperation, die Voraussetzungen für eine gelingende Zusammenarbeit, die Anlässe und Formen der Kooperation sowie die damit verbundenen Herausforderungen werden analysiert. Dabei werden verschiedene Interaktionen zwischen Erzieher*innen, Lehrkräften, Kita- und Grundschulkindern sowie Eltern betrachtet. Es werden auch die Herausforderungen wie getrennte Organisationsstrukturen, Integrität des Bildungsauftrages, Kommunikationsdefizite und die Belastung durch Kooperation beleuchtet.
Das vierte Kapitel legt den Fokus auf die Intention und das Forschungsziel der Arbeit. Die Forschungsmethoden werden im fünften Kapitel vorgestellt. Dabei wird die Datenerhebungsmethode des problemzentrierten Interviews erläutert und die Auswahl der Interviewpartner*innen beschrieben. Die Datenauswertungsmethode, die inhaltlich strukturierende qualitative Inhaltsanalyse, wird ebenfalls vorgestellt.
Die Auswertung der erhobenen Daten im sechsten Kapitel umfasst die soziodemografischen Angaben der Befragten und die Entwicklung eines Kategoriensystems. Die Ergebnisse der Untersuchung werden im Anschluss präsentiert, wobei die Aspekte der Kooperation, der Übergang aus Sicht der Erzieher*innen, die Herausforderungen des Übergangs und die Wahrnehmung der Erzieher*innen beleuchtet werden.
Die Ergebnisse werden im siebten Kapitel diskutiert und in einen größeren Kontext gestellt. Dabei werden die Ergebnisse der Untersuchung mit den theoretischen Grundlagen der Transitionsforschung in Beziehung gesetzt und kritisch reflektiert.
Schlüsselwörter
Schlüsselwörter der Arbeit sind: Transition, Übergang, Kindergarten, Grundschule, Kooperation, Interinstitutionelle Zusammenarbeit, Erzieher*innen, Lehrkräfte, Schulfähigkeit, Resilienz, Entwicklung, Identität, Bildung, Chancen, Herausforderungen.
- Quote paper
- Marike Swysen (Author), 2021, Der Übergang zum Grundschulkind. Zur Qualität der Kooperation zwischen Kindergarten und Grundschule aus Perspektive der Erziehenden, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1174176