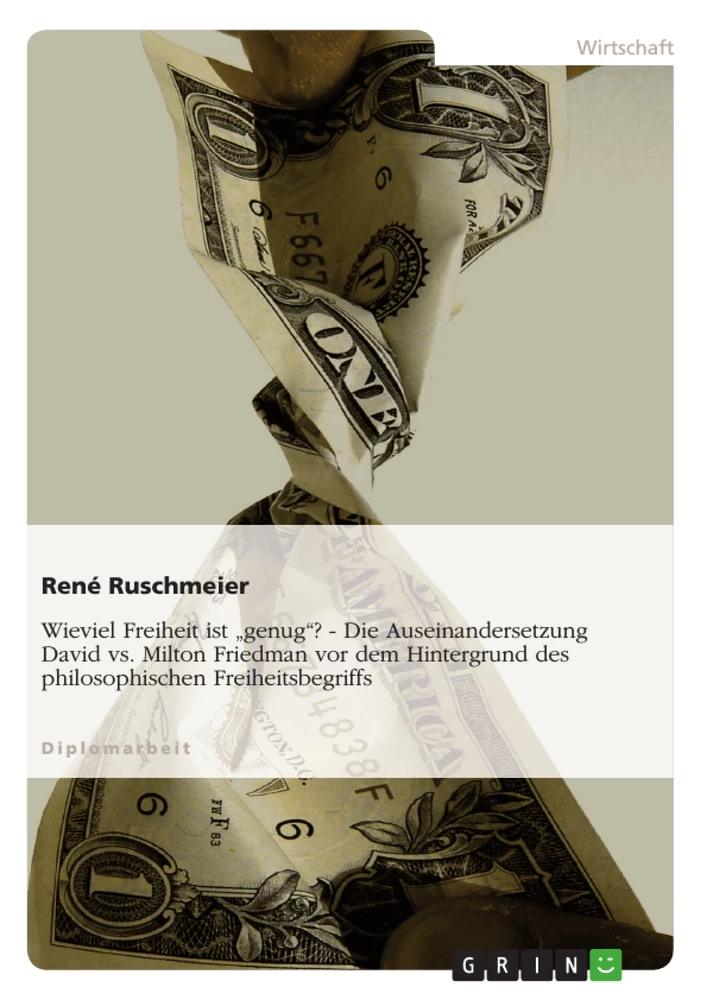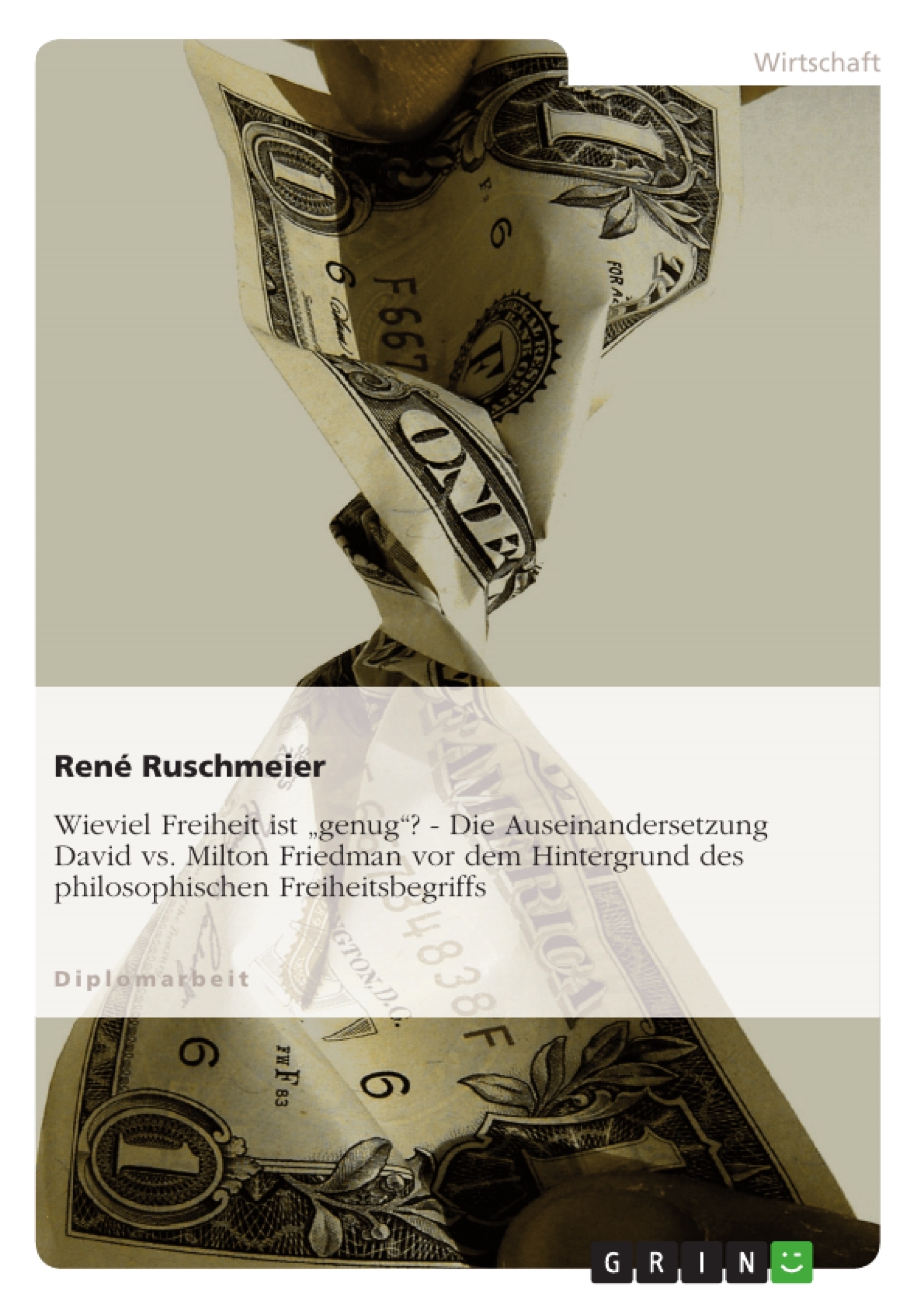Jedem wissenschaftlichem Schreiben geht das Denken voraus. Denken ist subjektiv, und jedem Subjekt ist eine Philosophie zu Eigen. Jedes Schreiben birgt somit die Philosophie des Autors in sich, gleichgültig, ob er sie explizit formuliert, oder sie nur durch die niedergeschriebenen Fakten durchscheint. Diese Arbeit wird die philosophischen Implikationen zweier Ökonomen herausarbeiten, von denen jeder auf seine Weise im Zentrum einer bestimmten wirtschaftswissenschaftlichen Ideologie stehen.
Der Reiz der Auseinandersetzung der beiden nährt sich vordergründig daraus, dass sie sich familiär sehr nahe stehen. David ist der Sohn von Milton Friedman. Wird Milton Friedman als Wirtschafts- Nobelpreisträger und Berater marktliberaler Regierender schon von linken und sozialistischen Wortführern für vermeintliche Ungerechtigkeiten wirtschaftlicher Entwicklung als Galionsfigur eines menschenverachtenden Kapitalismus verantwortlich gemacht, ist die ökonomische Theorie seines Sohnes – wenn auch nicht annähernd gleich bekannt – noch weit darüber hinaus gehend. Was an dieser Feststellung Ursache und was Wirkung ist, ist nicht klar auszumachen. Denn in den Augen der meisten – Ökonomen oder Intellektuelle – wird schon die oberflächliche Betrachtung der Grundkonzeption des Sohnes zur Ablehnung einer näheren Auseinandersetzung führen. Sie benehmen sich damit allerdings der Beschäftigung mit einer Philosophie, die erst durch ihre Radikalität Konsistenz erlangt. Erst von diesem radikalen Standpunkt aus jedoch kann sie Wirkung auf gegenwärtige Fragen der Wirtschaftsphilosophie ausüben.
Ziel der Arbeit ist die Gegenüberstellung eines konsequenten Liberalismus – der des Vaters, mit einem extremen Liberalismus – dem des Sohnes. Es wird zu erörtern sein, worauf sich die jeweiligen Ansichten gründen. Zunächst muss dazu die Grundlage des väterlichen Denkens erarbeitet werden (Abschnitt 3), um davon ausgehend darstellen zu können, was dem Sohn daran nicht weit genug gehend erscheint (Abschnitt 4).
Beide Autoren sind Ökonomen, d. h. nach ihrem eigenen Selbstverständnis, dass sie ihre Konzeptionen ausdrücklich nicht als Beitrag zur Philosophie verstanden sehen wollen. David Friedman beruft sich beispielsweise im I immer wieder auf den fehlenden moralphilosophischen Anspruch seines Schreibens an Stellen, an denen eben gerade mit philosophischen Ansätzen die Konsistenz der Argumentation zu hinterfragen ist.
Inhaltsverzeichnis
- Ökonomen und Philosophen - philosophische Implikationen ökonomischer Modelle
- Thomas Hobbes: wirtschaftliche Entwicklung und der philosophische Freiheitsbegriff seit der Aufklärung
- Milton Friedman - Freiheit in Zeiten der sozialistischen Alternative
- Kapitalismus und Freiheit
- J.S. Mill und A. Smith – Urväter des Individualismus, des Marktes und der Freiheit
- R. Nozick - Die Suche nach einer Grenze staatlicher Autorität
- Free to Choose
- Isaiah Berlin – Der Begriff der Freiheit im 20. Jahrhundert
- Determinismus - Wie frei sind wir eigentlich?
- David Friedman – Freiheit konsequent: Anarchismus
- Konzeption des Libertarismus in MF
- J. Locke - Freiheit und Eigentum
- J.C. Lester - Freiheit gleich Minimierung von Zwang
- Murray N. Rothbard – Eine Ethik der Freiheit
- Tyler Cowens Kritik an Friedman - Probleme der Stabilität und Monopolisierung
- Versuch einer Wertung – Das Zuwenig; das Zuviel; ein „Genug“?
- Das Zuwenig – Der optimistische Ansatz
- Das Zuviel – Der pessimistische Ansatz
- Das Genug – Existiert eine Goldlöckchen-Lösung?
- Siglenverzeichnis
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Gegenüberstellung des klassischen Liberalismus Milton Friedmans und dem extremen Liberalismus seines Sohnes David Friedman. Ziel ist es, die philosophischen Grundlagen beider Ansätze zu erforschen und die jeweiligen Argumente zu analysieren. Dabei werden die historischen Wurzeln des Denkens beider Autoren beleuchtet, sowie die Kritikpunkte, die an ihren Theorien geäußert werden.
- Die philosophischen Grundlagen des Liberalismus und Libertarismus
- Die Rolle des Staates in der Wirtschaft
- Die Bedeutung von Freiheit und Eigentum
- Die Auswirkungen des Kapitalismus auf Gesellschaft und Individuum
- Die Frage nach der optimalen Balance zwischen Freiheit und Ordnung
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einführung in die philosophischen Implikationen ökonomischer Modelle. Anschließend wird die Entwicklung des Freiheitsbegriffs seit der Aufklärung anhand von Thomas Hobbes dargestellt. Im dritten Kapitel wird Milton Friedmans Theorie der Freiheit im Kontext der sozialistischen Alternative beleuchtet. Dabei werden seine zentralen Argumente für den Kapitalismus und seine Kritik an staatlichen Eingriffen in die Wirtschaft erläutert. Im vierten Kapitel wird David Friedmans libertäre Philosophie vorgestellt, die eine konsequente Ausweitung des Freiheitsbegriffs auf alle Lebensbereiche fordert. Der Fokus liegt dabei auf der Kritik an staatlicher Autorität und der Betonung individueller Selbstbestimmung. Das fünfte Kapitel stellt verschiedene Perspektiven auf das Verhältnis von Freiheit und Ordnung dar und diskutiert die Frage nach einer optimalen Balance zwischen den beiden Polen.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den Schlüsselbegriffen Freiheit, Liberalismus, Libertarismus, Kapitalismus, Staat, Eigentum, Individualismus, Markt und Wirtschaftsphilosophie. Im Zentrum stehen die Gedanken von Milton Friedman und David Friedman, die sich mit den philosophischen Implikationen ihrer ökonomischen Modelle auseinandersetzen. Dabei werden zentrale Themen wie die Rolle des Staates in der Wirtschaft, die Bedeutung von Freiheit und Eigentum sowie die Auswirkungen des Kapitalismus auf Gesellschaft und Individuum diskutiert.
Häufig gestellte Fragen
Was unterscheidet den Liberalismus von Milton Friedman von dem seines Sohnes David?
Milton Friedman vertritt einen konsequenten klassischen Liberalismus mit staatlichen Rahmenbedingungen, während sein Sohn David einen extremen Libertarismus bis hin zum Anarchismus befürwortet.
Welche Rolle spielt der Staat in David Friedmans Theorie?
David Friedman geht über seinen Vater hinaus und stellt die Notwendigkeit staatlicher Autorität grundsätzlich infrage, indem er eine anarchistische Gesellschaftsordnung auf Basis des Libertarismus entwirft.
Auf welche philosophischen Wurzeln beruft sich Milton Friedman?
Milton Friedman knüpft an die Traditionen von Adam Smith und J.S. Mill an und setzt sich mit dem Freiheitsbegriff von Isaiah Berlin sowie den Grenzen staatlicher Autorität bei Robert Nozick auseinander.
Wie definiert David Friedman Freiheit?
Freiheit wird oft als die Minimierung von Zwang definiert, wobei David Friedman sich auf Denker wie John Locke (Eigentum) und Murray Rothbard bezieht.
Was ist die zentrale Fragestellung der Arbeit bezüglich der Freiheit?
Die Arbeit untersucht, wie viel Freiheit „genug“ ist und ob es eine optimale Balance (eine „Goldlöckchen-Lösung“) zwischen totaler Freiheit und staatlicher Ordnung gibt.
- Arbeit zitieren
- René Ruschmeier (Autor:in), 2008, Wieviel Freiheit ist "genug"? - Die Auseinandersetzung David vs. Milton Friedman vor dem Hintergrund des philosophischen Freiheitsbegriffs, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/117419