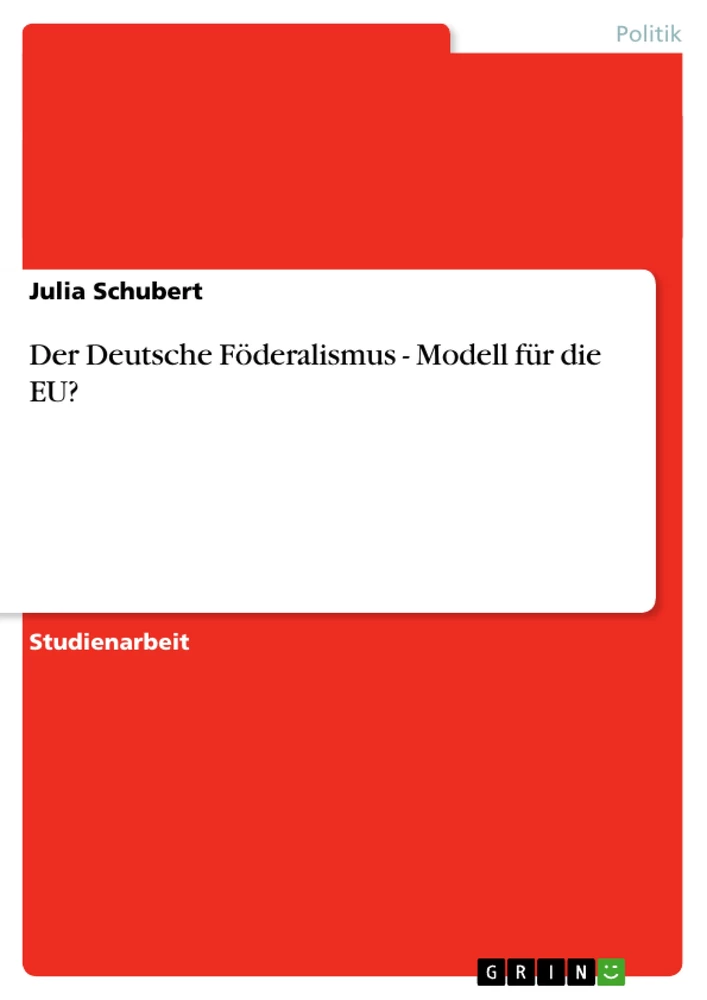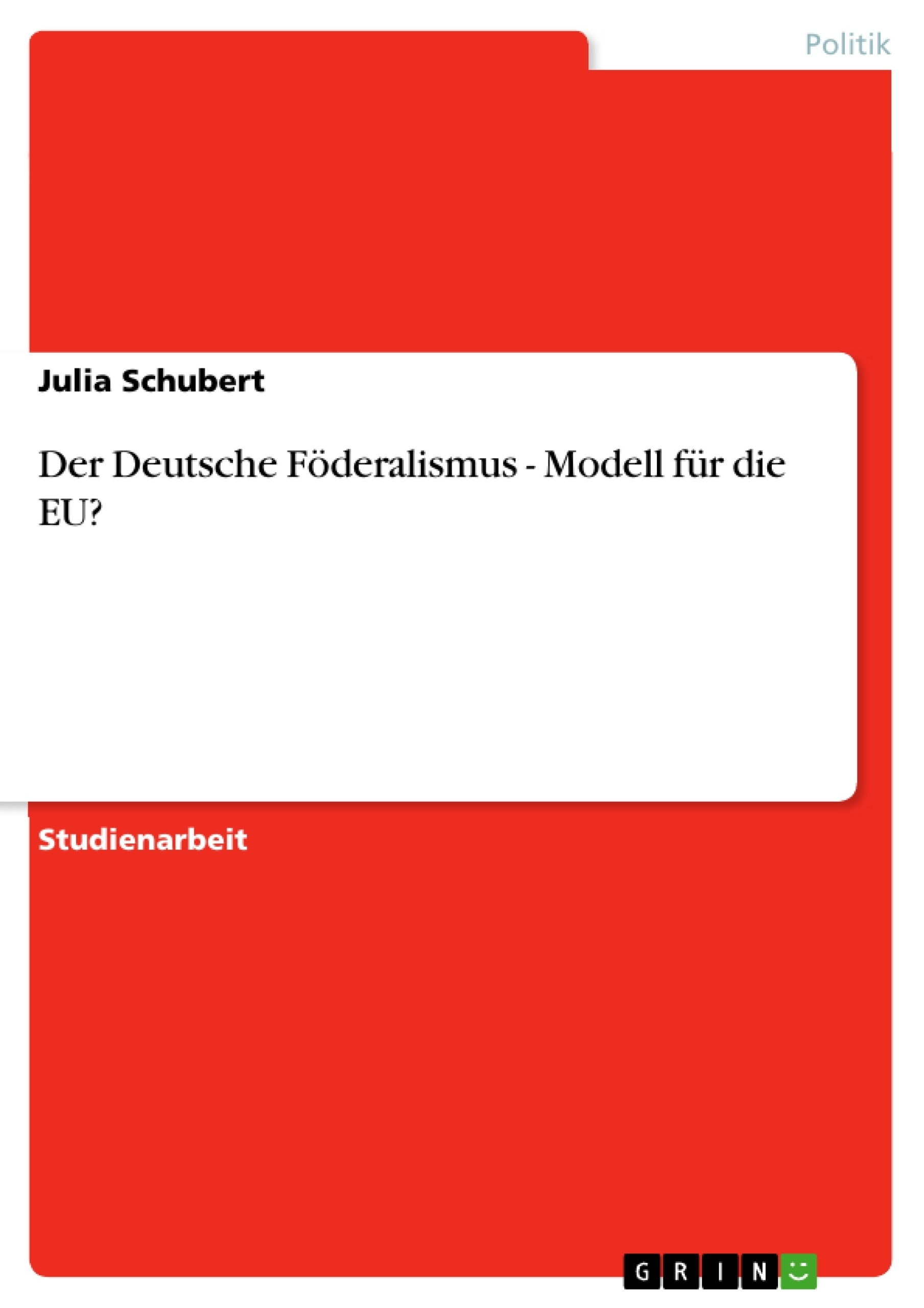Die heutige Europäische Union kann auf einen fast 50-jährigen Prozeß der Integration,
Vertiefung und Erweiterung zurücksehen. 1951 unterschrieben die 6 Gründerstaaten (Frankreich,
Italien, Belgien, Luxemburg, die Niederlande und die Bundesrepublik Deutschland) den
Vertrag über die Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl (EGKS). Im Jahre 1958
folgten dann die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft (EWG) sowie die Europäische
Atomgemeinschaft (EURATOM). Als Sammelbezeichnung für diese drei wurde später der
Begriff der Europäischen Gemeinschaft geprägt. Intensiviert wurde die Staatengemeinschaft
dann noch durch die Europäische Freihandelszone (EFTA) von 1960 und das Europäische
Währungssystem (EWS) von 1979 und die Vertragsänderungen der Römischen Verträge1.
Durch diese Zusammenschlüsse auf europäischem Raum sollten Frieden und Freiheit gesichert werden
und ein Schutz vor Übergriffen von Nationalstaaten, wie es in den 2 Weltkriegen zu Beginn des
Jahrhunderts geschehen war, geboten werden. Das Ziel war die Bildung einer starken wirtschaftlichen
und politischen Union der europäischen Staaten.
Mittlerweile ist durch den Beschluß über den Vertrag von Maastricht (1992) über die Europäische
Union (EUV) und dem ergänzenden Vertrag von Amsterdam (1997) und auch dem Start der
Wirtschafts- und Währungsunion ein Gebilde entstanden, das einen starken und konfliktreichen
Zusammenschluß von 15 europäischen Staaten darstellt.
Dieses „Gebilde“ besteht aus 3 Säulen unter dem Dach der EU:
- die Europäische Gemeinschaft (EG)
- die Gemeinsame Außen- u. Sicherheitspolitik (GASP)
- die Zusammenarbeit in der Innen- u. Rechtspolitik (ZJIP).2
Obwohl der EUV Richtlinien für die Ziele der EU, ihre Institutionen und Verfahrensweisen enthält,
wird die „Finalität“3 nicht klar definiert. In diesem Zusammenhang stellen sich somit vordergründig
die Fragen: Was ist die EU heute und wohin wird sie streben? Welche Modelle gibt es? [...]
1 Das sind die Verträge über die EWG und über EURATOM.
2 Vgl. Michael Matern, Zeittafel der europäischen Integration in Werner Weidenfeld/Wolfgang Wessels (Hrsg.), Europa von
A-Z, Bonn 2000, S. 439-448
3 Man verwendet den Begriff der Finalität, da der europäische Einigungsprozeß noch nicht abgeschlossen ist und somit noch
ständiger Dynamisierung bzw. Anpassung unterworfen ist, die endgültige politische Struktur ist nicht klar definiert.
Inhaltsverzeichnis
- 1. EINLEITUNG
- 2. DER DEUTSCHE FÖDERALISMUS
- 2.1 Historischer Hintergrund
- 2.2 Verfassungsrechtliche Grundlagen und Funktionsweisen des Föderalismus in der Bundesrepublik Deutschland
- 2.2.1 Bundesstaatlichkeit als unantastbares Verfassungsprinzip
- 2.2.2 Das Subsidiaritätsprinzip
- 2.2.3 Die Gewaltenteilung
- 2.2.4 Die bundesstaatliche Homogenität
- 2.2.5 Die Beschränkung der Landesherrschaft
- 2.2.6 Kooperation und gegenseitige Treue
- 2.2.7 Die Aufgabenverteilung zwischen Bund und Ländern.
- 2.2.8 Die Finanzordnung
- 2.2.9 Der Bundesrat
- 3. KRITIK AM DEUTSCHEN FÖDERALISMUS
- 3.1 Die Kompetenzverteilung
- 3.1.1 Die Politikverflechtung
- 3.1.2 Die Gesetzgebungskompetenzen
- 3.1.3 Finanzordnung und Finanzbeziehungen
- 4. MODELLCHARAKTER DES DEUTSCHEN FÖDERALISMUS FÜR DIE EUROPÄISCHE UNION?
- 5. FAZIT
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht die Übertragbarkeit des deutschen Föderalismus auf die Europäische Union. Sie beleuchtet den historischen Hintergrund, die verfassungsrechtlichen Grundlagen und die Funktionsweise des deutschen Föderalismus, um zu analysieren, ob er als Modell für die EU dienen kann. Im Zentrum stehen die Herausforderungen der Kompetenzverteilung, der Politikverflechtung und der Finanzordnung.
- Die Geschichte des deutschen Föderalismus
- Die Funktionsweise des deutschen Föderalismus
- Die Kritik am deutschen Föderalismus
- Die Übertragbarkeit des deutschen Föderalismus auf die EU
- Die zukünftige Struktur der EU
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 1: Einleitung
Die Einleitung führt in das Thema der Arbeit ein und stellt die zentrale Frage nach der Übertragbarkeit des deutschen Föderalismus auf die EU. Sie beleuchtet die Bedeutung des deutschen Föderalismus in der europäischen Integration und skizziert die Relevanz des Themas. - Kapitel 2: Der deutsche Föderalismus
Dieses Kapitel gibt einen umfassenden Überblick über den deutschen Föderalismus. Es behandelt den historischen Hintergrund, die verfassungsrechtlichen Grundlagen und die Funktionsweise des Systems, einschließlich der Aufgabenverteilung zwischen Bund und Ländern, der Finanzordnung und der Rolle des Bundesrats. - Kapitel 3: Kritik am deutschen Föderalismus
In diesem Kapitel werden die kritischen Punkte des deutschen Föderalismus beleuchtet. Es analysiert die Herausforderungen der Kompetenzverteilung, die Auswirkungen der Politikverflechtung und die Problemfelder der Finanzordnung und Finanzbeziehungen zwischen Bund und Ländern. - Kapitel 4: Modellcharakter des deutschen Föderalismus für die Europäische Union?
Dieses Kapitel untersucht die Übertragbarkeit des deutschen Föderalismus auf die EU. Es diskutiert die möglichen Vorteile und Herausforderungen einer föderalen Struktur für die Europäische Union und analysiert die Unterschiede und Gemeinsamkeiten zwischen beiden Systemen.
Schlüsselwörter
Deutscher Föderalismus, Europäische Union, Bundesstaat, Kompetenzverteilung, Politikverflechtung, Finanzordnung, Subsidiarität, Bundesrat, Integration, Einigungsprozeß.
Häufig gestellte Fragen
Kann der deutsche Föderalismus als Modell für die EU dienen?
Die Arbeit untersucht diese Möglichkeit kritisch und analysiert, ob die Strukturen der Bundesrepublik auf die komplexere Europäische Union übertragbar sind.
Was sind die drei Säulen der EU?
Die EU basiert auf der Europäischen Gemeinschaft (EG), der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik (GASP) sowie der Zusammenarbeit in der Innen- und Rechtspolitik (ZJIP).
Was bedeutet der Begriff „Finalität“ im EU-Kontext?
Er beschreibt das noch nicht klar definierte Ziel oder die endgültige politische Struktur des europäischen Einigungsprozesses.
Welche Rolle spielt das Subsidiaritätsprinzip?
Es besagt, dass Aufgaben auf der kleinstmöglichen Ebene gelöst werden sollten, was sowohl für den deutschen Bundesstaat als auch für die EU ein zentrales Prinzip ist.
Was wird am deutschen Föderalismus kritisiert?
Kritikpunkte sind vor allem die komplexe Politikverflechtung, die unübersichtliche Kompetenzverteilung und die Probleme der Finanzordnung zwischen Bund und Ländern.
- Arbeit zitieren
- Julia Schubert (Autor:in), 2001, Der Deutsche Föderalismus - Modell für die EU?, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/11741