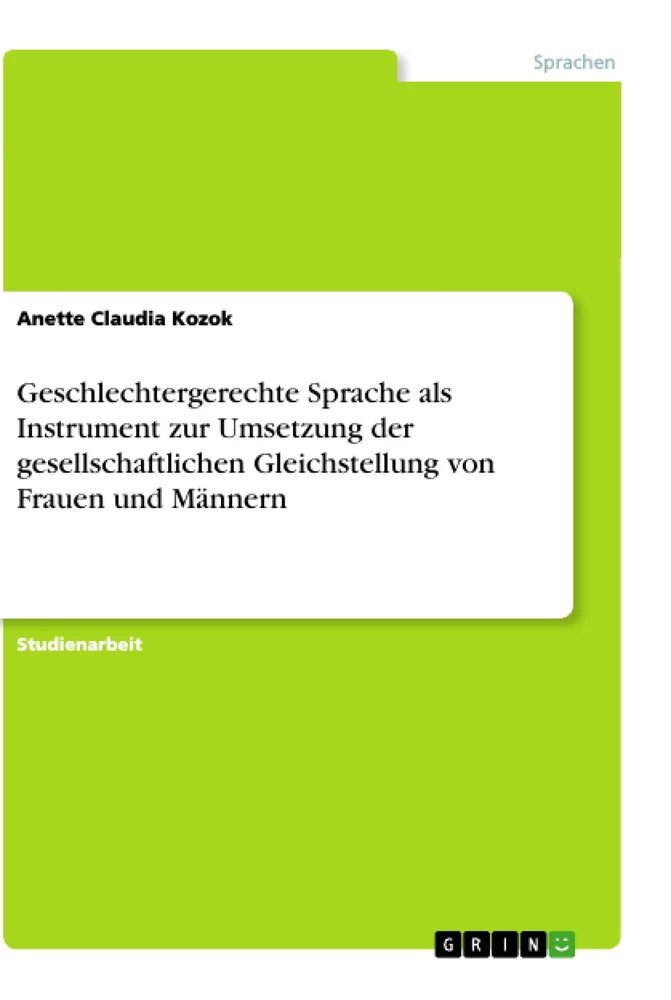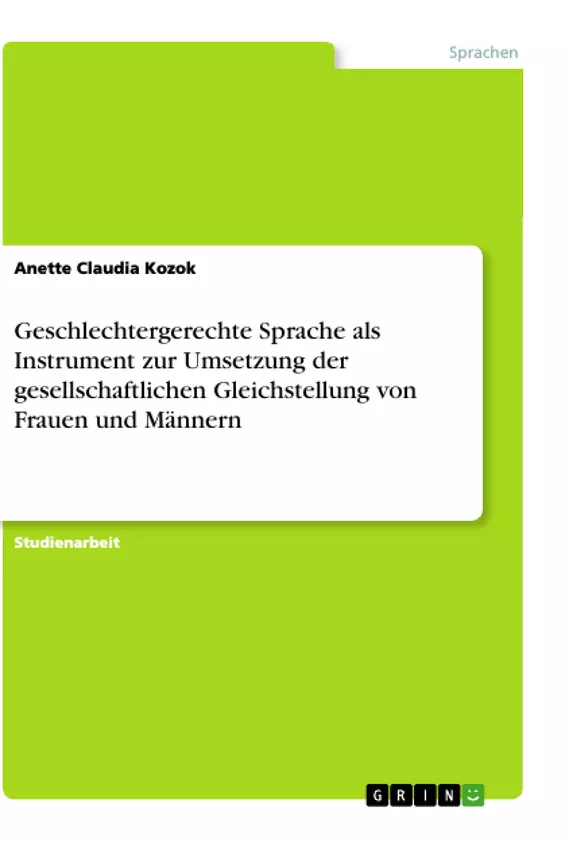Diese wissenschaftliche Arbeit untersucht die Bedeutung der écriture inclusive in der französischen Sprache und ihre psycholinguistischen Auswirkungen in der Gesellschaft. Ein kleiner Umriss der geschichtlichen Frauenbewegung in Frankreich soll die Bedeutung des Themas darstellen. Es waren nämlich die Frauen, die unterdrückt wurden und um ihre Rechte in der patriarchischen Gesellschaft kämpften. Aufbauend darauf wird eine Darstellung der geschlechtergerechten Sprache in Frankreich erörtert. Die Gender Fair Language (GFL) oder geschlechtergerechte Sprache zielt darauf ab, geschlechtsspezifische Vorurteile oder sogar Stereotypen gegenüber einem bestimmten Geschlecht und soziale Diskriminierungen abzubauen. Durch die intensive Feldarbeit der geschlechtsgerechten Sprachen in den Bereichen der (1) Sprachstruktur, (2) der Sprachpolitik und (3) des individuellen Sprachverhaltens ist es möglich, einen kritischen Überblick zu gewinnen, wie sich geschlechtergerechte Sprache in der französischen Gesellschaft auswirkt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Das Frauenbild in Europa
- Geschlechtergerechte Sprache in Frankreich
- Sprachstruktur
- Sprachpolitik
- Individuelles Sprachverhalten
- Auswirkung der geschlechtergerechten Sprache auf die Berufswahl
- Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Bedeutung der „écriture inclusive“ in der französischen Sprache und ihre psycholinguistischen Auswirkungen in der Gesellschaft. Die Arbeit beleuchtet die geschichtliche Frauenbewegung in Frankreich und die Bedeutung des Themas für die Gleichstellung der Geschlechter. Sie analysiert die geschlechtergerechte Sprache in Frankreich, insbesondere die Auswirkungen auf die Sprachstruktur, Sprachpolitik und das individuelle Sprachverhalten. Ziel ist es, einen kritischen Überblick über die Auswirkungen der geschlechtergerechten Sprache in der französischen Gesellschaft zu gewinnen.
- Die geschichtliche Frauenbewegung in Frankreich
- Die Entwicklung und Bedeutung der „écriture inclusive“
- Die Auswirkungen der geschlechtergerechten Sprache auf die Sprachstruktur
- Die Rolle der Sprachpolitik in der Förderung der geschlechtergerechten Sprache
- Die psycholinguistischen Auswirkungen der geschlechtergerechten Sprache auf das Individuum
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel führt in die Thematik ein und stellt die Relevanz der „écriture inclusive“ in der französischen Sprache dar. Es beleuchtet die aktuelle Debatte über die genderneutrale Schreibweise und die kontroversen Reaktionen darauf, wie z.B. den Erlass des französischen Bildungsministers Jean-Michel Blanquer im März 2021.
Das zweite Kapitel beschreibt die historische Situation der Frauen in Europa und die Entwicklung des Frauenbildes im Kontext der Französischen Revolution. Es analysiert die verschiedenen Phasen der Frauenbewegung und zeigt, wie die Frauen für ihre Rechte kämpften und die Gesellschaft veränderten.
Das dritte Kapitel widmet sich der geschlechtergerechten Sprache in Frankreich. Es analysiert die Auswirkungen der geschlechtergerechten Sprache auf die Sprachstruktur, die Sprachpolitik und das individuelle Sprachverhalten.
Das vierte Kapitel untersucht die Auswirkungen der geschlechtergerechten Sprache auf die Berufswahl französischer Schüler*innen und beleuchtet verschiedene Perspektiven und sprachliche Modelle.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den Themen „écriture inclusive“, geschlechtergerechte Sprache, feministische Sprachpolitik, Frauenrechte, Sprachstruktur, Sprachpolitik, individuelles Sprachverhalten, psycholinguistische Auswirkungen, Frankreich, Gleichstellung der Geschlechter, Frauenbewegung, gesellschaftliche Entwicklung, Berufswahl.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Ziel der „écriture inclusive“ in Frankreich?
Ziel ist es, geschlechtsspezifische Vorurteile und Stereotypen abzubauen und die gesellschaftliche Gleichstellung von Frauen und Männern sprachlich abzubilden.
Wie reagiert die französische Politik auf geschlechtergerechte Sprache?
Die Debatte ist kontrovers; so gab es beispielsweise 2021 einen Erlass des Bildungsministers Blanquer, der bestimmte Formen der genderneutralen Schreibweise einschränkte.
Welchen Einfluss hat Sprache auf die Berufswahl?
Die Arbeit untersucht, wie geschlechtergerechte Sprache die Wahrnehmung von Berufen bei Schülern beeinflussen und zur Aufbrechung von Geschlechterstereotypen beitragen kann.
Welche Bereiche der Sprache werden durch GFL (Gender Fair Language) beeinflusst?
Betroffen sind die Sprachstruktur (Grammatik), die Sprachpolitik (offizielle Richtlinien) und das individuelle Sprachverhalten im Alltag.
Welche historische Grundlage hat die Debatte in Frankreich?
Die Debatte wurzelt in der Frauenbewegung und dem Kampf gegen patriarchale Strukturen, die sich bereits seit der Französischen Revolution entwickelt haben.
- Arbeit zitieren
- Anette Claudia Kozok (Autor:in), 2021, Geschlechtergerechte Sprache als Instrument zur Umsetzung der gesellschaftlichen Gleichstellung von Frauen und Männern, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1174307