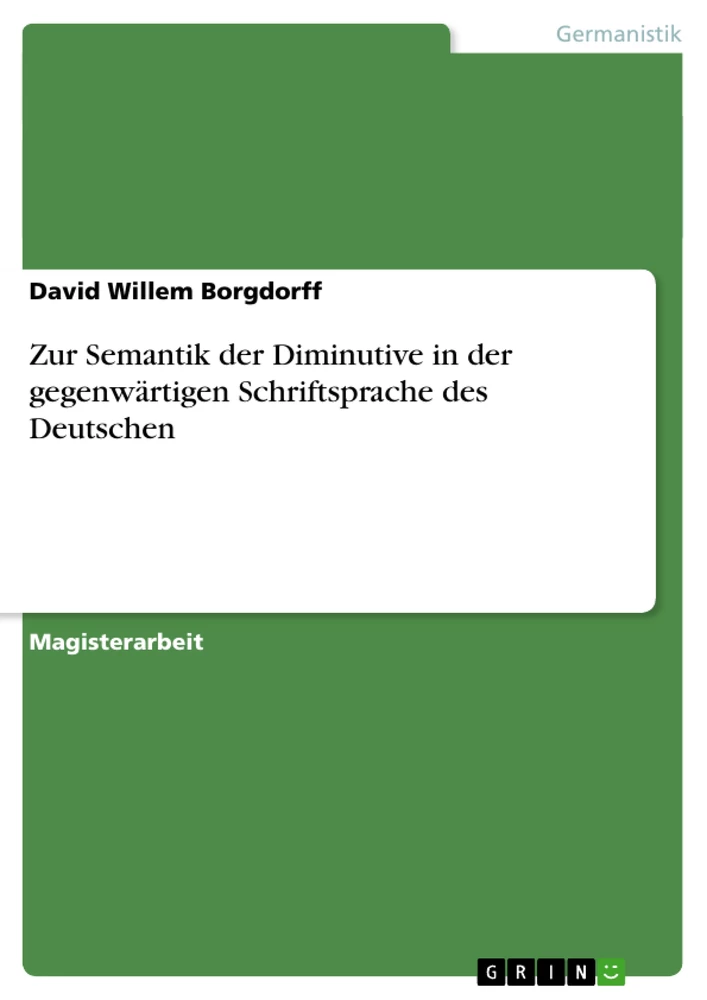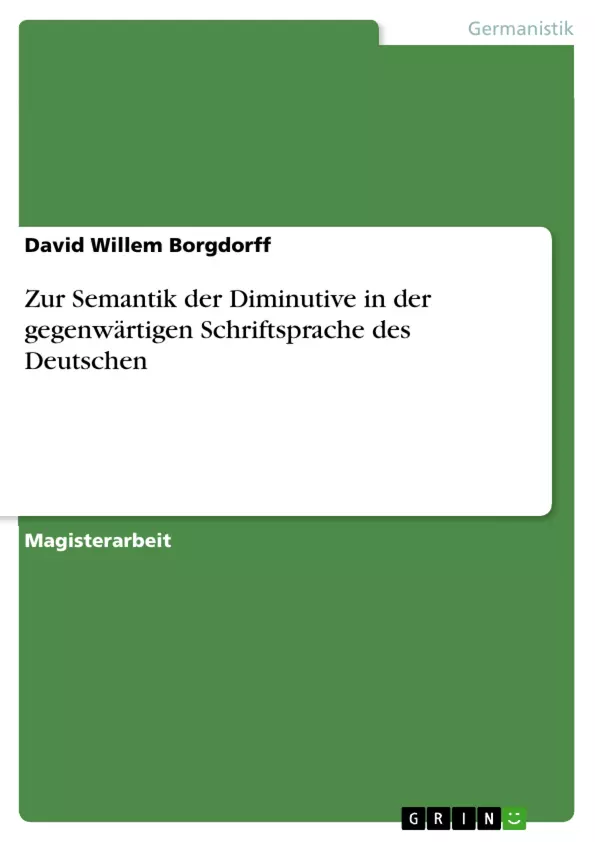„«Was 'n Wetterchen!» ruft ein Mädchen begeistert. «Ja, wunderbar!» erwidert ihre Freundin, während sie ein Fädchen von ihrem neuen Röckchen zupft. Sie sitzen auf einer Terrasse in der Sonne. Unter den Holztischchen tummeln sich Spätzchen. «Trinken wir noch ein Weinchen?» Die beiden Blondchen schauen sich schelmisch an. «Warum nicht, ein Stündchen haben wir ja noch.» Am Tischchen nebenan sitzt ein altes Mütterchen, das die Kellnerin mit der Anrede 'Fräulein' herbeiruft. Die Mädels schmunzeln. Nachdem sie nochmal bestellt haben, tauschen die beiden Anekdötchen über die Sommerferien aus. In einem Büchlein zeigt das eine Mädchen, wie putzig das französische Dörfchen war, in dem sie mit ihren Eltern Urlaub gemacht hat. Dann steht eins der Mädchen auf. «Na, wollen wir mal fahren?» «Wie fahren? Du hast doch getrunken!» «Ach, das waren doch nur zwei Gläschen!» «Naja, okay. Aber wenn's ein Knöllchen gibt, zahl ich nicht mit!»“1 Im oben stehenden Text haben die kursiven Wörter eins gemeinsam: sie werden in der Linguistik als 'Diminutive' bezeichnet. Als deutsches Wort dafür tritt – vor allem umgangssprachlich – 'Verkleinerungswort/-wörter' auf. Schon ein flüchtiger Blick auf die kursiven Wörter genügt jedoch um zu erkennen, dass es sich keineswegs in allen Fällen um bloße Verkleinerungen handelt. Nur bei Fädchen und (Holz-)tischchen liegen eindeutig Verkleinerungen vor, in einigen Fällen könnte die Bedeutungskomponente 'klein' eine Rolle spielen (Spätzchen, Röckchen, Dörfchen, Büchlein), aber in der überwiegenden Zahl der Fälle ist eine solche Komponente kaum (Mädchen, Mädels, Gläschen, Anekdötchen) oder nicht zu erkennen (Wetterchen, Weinchen, Stündchen, Knöllchen, Fräulein, Blondchen, Mütterchen).
Außerdem kommen Fragen auf wie: Von welchem Wort sollen Mädchen und Mädel Verkleinerungen sein? Handelt es sich bei den Spätzchen wirklich um ungewöhnlich kleine Spatzen? Wie hat man sich eine Verkleinerung des Wetters vorzustellen? Wären einige dieser Diminutive nicht treffender als 'Verniedlichung' zu bezeichnen? Spielen neben Kleinheit nicht auch emotionale Aspekte eine Rolle? Warum gibt es eigentlich gleich mehrere Suffixe (-chen, -el, -lein), mit denen man verkleinern kann? Gibt es einen Unterschied zwischen einem Heftchen und einem Heftlein? Diese kurzen Überlegungen enthalten bereits einige der wichtigen Fragestellungen zur Semantik der Diminutive.
Die vorliegende Untersuchung gibt anhand von empirischen Daten Antworten auf diese und andere Fragen.
Inhaltsverzeichnis
- 1 – Einführung
- 1.1 Diminutive
- 1.2 Zur Themenstellung und Zielsetzung der Arbeit
- 2 – Überblick über Diminution und ihre Erforschung
- 2.1 Diminution als Art der Modifikation
- 2.2 Forschungsstand zur Diminution im Deutschen
- 2.3 Forschungsstand zur Semantik der Diminutive
- 3 – Die Vorgehensweise
- 3.1 Ziel der Untersuchung
- 3.2 Struktur der Untersuchung
- 4 - Die Korpusrecherche
- 4.1 Die zu untersuchenden Suffixe
- 4.2 Die zu untersuchenden Diminutive
- 4.3 Das Korpus
- 4.4 Das gewählte Teilkorpus
- 4.5 Das Suchprogramm und die Suchanfrage
- 4.6 Die ersten Ergebnisse
- 4.7 Eine neue Suchmethode
- 4.8 Bereinigung der Ergebnislisten
- 5 – Theoretische Vorüberlegungen
- 5.1 Hin zu einem adäquaten Modell zur Analyse und Beschreibung
- 5.2 Suffixbedeutung und Assoziationen
- 5.3 Objektivität und Subjektivität
- 5.4 Der Ansatz von Draeger
- 5.5 Motivation für Diminution
- 5.6 Motiviertheit, Lexikalisierung, Idiomatisierung
- 5.7 Die Stellung der unmotivierten Diminutive in der Auswertung
- 5.8 Das Modell der semantischen Features
- 5.9 Zur Zuweisung der Features
- 6 – Die Analyse
- 6.1 Das Feature [KLEIN]
- 6.2 Das Feature [JUNG]
- 6.3 Das Feature [EINZELHEIT]
- 6.4 Das Feature [VERSCHLEIERND]
- 6.5 Das Feature [EMOT.POS]
- 6.6 Das Feature [EMOT.NEG]
- 6.7 Das Feature [FESTE.GRÖSSE]
- 6.8 Unmotivierte Diminutive
- 7 – Übersicht und Typologie
- 7.1 Zum Begriff 'Typologie'
- 7.2 Diminution in den germanischen Sprachen
- 7.3 Zwei produktive Diminutivsuffixe
- 7.4 Die Distribution von -chen und -lein
- 7.5 Zur Charakterisierung der Suffixleistungen
- 7.6 Die prototypischen Features von -chen
- 7.7 Die prototypischen Features von -lein
- 7.8 Vergleich der Distribution der Features von -chen und -lein
- 7.9 Die prototypischen Features der deutschen Diminutivsuffixe
- 7.10 Konfigurationen
- 7.11 Die prototypischen Konfigurationen von -chen
- 7.12 Die prototypischen Konfigurationen von -lein
- 7.13 Vergleich der Konfigurationen von -chen und -lein
- 7.14 Die prototypischen Konfigurationen der deutschen Diminutivsuffixe
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit hat zum Ziel, die Semantik von Diminutiven in der gegenwärtigen deutschen Schriftsprache empirisch zu untersuchen. Es soll festgestellt werden, welche Bedeutungen der Diminutivsuffixe am häufigsten vorkommen und somit als typisch für die Diminution im Deutschen gelten können. Methodische Herausforderungen, wie die Überschneidung von Bedeutungen, werden dabei adressiert.
- Häufigkeit und Typikalität der Bedeutungen von Diminutivsuffixen
- Methodische Probleme bei der Analyse von Diminutivbedeutungen
- Entwicklung eines geeigneten Modells zur Beschreibung der Diminutivsemantik
- Vergleich verschiedener Diminutivsuffixe (z.B. -chen, -lein)
- Untersuchung der Rolle von emotionalen Aspekten bei der Diminution
Zusammenfassung der Kapitel
1 – Einführung: Dieses einführende Kapitel legt den Grundstein der Arbeit, indem es den Begriff "Diminutive" erklärt und anhand eines Beispieltextes die vielschichtigen Bedeutungen dieser Wortbildungen illustriert. Es werden zentrale Forschungsfragen formuliert, die sich mit der Vielfältigkeit der Bedeutungen von Diminutivsuffixen und der Schwierigkeit ihrer eindeutigen Kategorisierung befassen. Die Arbeit zielt darauf ab, durch empirische Untersuchung die häufigsten und typischen Bedeutungen von Diminutiven im Deutschen zu identifizieren und ein adäquates Modell für deren Analyse zu entwickeln.
2 – Überblick über Diminution und ihre Erforschung: Dieses Kapitel bietet einen umfassenden Überblick über den Forschungsstand zur Diminution und der Semantik von Diminutiven im Deutschen. Es analysiert verschiedene theoretische Ansätze und diskutiert die methodischen Herausforderungen bei der Untersuchung dieses linguistischen Phänomens. Es werden unterschiedliche Interpretationen der Grundbedeutung von Diminutivsuffixen beleuchtet, zum Beispiel die Debatte um „Kleinheit“ versus „Zugehörigkeit/Vertrautheit“.
3 – Die Vorgehensweise: Das Kapitel beschreibt detailliert die Methodik der empirischen Untersuchung. Hier werden das Ziel der Untersuchung und die gewählte Struktur präzisiert, um die methodische Vorgehensweise transparent darzustellen und die Nachvollziehbarkeit der Ergebnisse zu gewährleisten. Es wird ein detaillierter Einblick in die einzelnen Schritte der Analyse gegeben.
4 - Die Korpusrecherche: Dieses Kapitel beschreibt die Durchführung der Korpusanalyse. Es erläutert die Auswahl der zu untersuchenden Suffixe und Diminutive, die Spezifikation des Korpus, die verwendeten Suchmethoden und die anschließende Bereinigung der Ergebnisse. Der Fokus liegt auf der Beschreibung der angewandten Methoden zur Datengewinnung und -aufbereitung.
5 – Theoretische Vorüberlegungen: Dieses Kapitel präsentiert die theoretischen Überlegungen, die die empirische Analyse leiten. Es werden Modelle zur Analyse und Beschreibung der Diminutivsemantik vorgestellt und diskutiert. Konzepte wie Suffixbedeutung, Assoziationen, Objektivität und Subjektivität, sowie der Ansatz von Draeger werden eingehend erläutert, ebenso die Rolle von Motiviertheit, Lexikalisierung und Idiomatisierung.
Schlüsselwörter
Diminutive, Diminution, Semantik, deutsche Schriftsprache, Suffixe (-chen, -lein), Korpuslinguistik, empirische Untersuchung, Bedeutungsanalyse, Features, Typologie, Motiviertheit, Lexikalisierung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Arbeit: Semantik von Diminutiven im Deutschen
Was ist das Thema der Arbeit?
Die Arbeit untersucht empirisch die Semantik von Diminutiven in der gegenwärtigen deutschen Schriftsprache. Im Fokus stehen die häufigsten Bedeutungen der Diminutivsuffixe und die Entwicklung eines geeigneten Modells zur Beschreibung dieser Bedeutungen.
Welche Diminutivsuffixe werden untersucht?
Die Arbeit konzentriert sich insbesondere auf die Suffixe "-chen" und "-lein", vergleicht aber auch deren Distribution mit anderen Diminutivsuffixen im Deutschen.
Welche Methode wird angewendet?
Die Arbeit verwendet eine korpuslinguistische Methode. Es wird ein Korpus analysiert, um die Häufigkeit und Typikalität verschiedener Bedeutungen der Diminutivsuffixe zu ermitteln. Die Ergebnisse werden dann mit Hilfe eines Modells semantischer Features analysiert.
Welche konkreten Forschungsfragen werden behandelt?
Die Arbeit untersucht unter anderem die Häufigkeit und Typikalität der Bedeutungen von Diminutivsuffixen, methodische Probleme bei der Analyse von Diminutivbedeutungen, die Entwicklung eines geeigneten Modells zur Beschreibung der Diminutivsemantik, den Vergleich verschiedener Diminutivsuffixe und die Rolle emotionaler Aspekte bei der Diminution.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in sieben Kapitel: Einleitung, Überblick über Diminution und ihre Erforschung, Vorgehensweise, Korpusrecherche, Theoretische Vorüberlegungen, Analyse und Übersicht und Typologie. Jedes Kapitel behandelt spezifische Aspekte der Diminutivsemantik, von der Einführung des Themas über die Methodik, die theoretischen Grundlagen bis hin zur Analyse und den Ergebnissen.
Welche theoretischen Modelle werden verwendet?
Die Arbeit diskutiert verschiedene theoretische Ansätze zur Analyse der Diminutivsemantik, darunter das Modell der semantischen Features und den Ansatz von Draeger. Konzepte wie Suffixbedeutung, Assoziationen, Objektivität und Subjektivität, Motiviertheit, Lexikalisierung und Idiomatisierung spielen eine wichtige Rolle.
Welche Ergebnisse werden präsentiert?
Die Arbeit präsentiert eine empirisch begründete Typologie der Bedeutungen von Diminutivsuffixen im Deutschen. Es werden die prototypischen Features von "-chen" und "-lein" sowie deren Distribution und Konfigurationen verglichen und analysiert.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Diminitive, Diminution, Semantik, deutsche Schriftsprache, Suffixe (-chen, -lein), Korpuslinguistik, empirische Untersuchung, Bedeutungsanalyse, Features, Typologie, Motiviertheit, Lexikalisierung.
Für wen ist diese Arbeit relevant?
Diese Arbeit ist relevant für Linguisten, Germanisten und alle, die sich für die Semantik der deutschen Sprache und die Methoden der Korpuslinguistik interessieren.
Wo finde ich den vollständigen Text?
Der vollständige Text der Arbeit ist nicht in diesem FAQ enthalten. Dieser FAQ bietet lediglich einen Überblick über den Inhalt.
- Quote paper
- David Willem Borgdorff (Author), 2008, Zur Semantik der Diminutive in der gegenwärtigen Schriftsprache des Deutschen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/117443