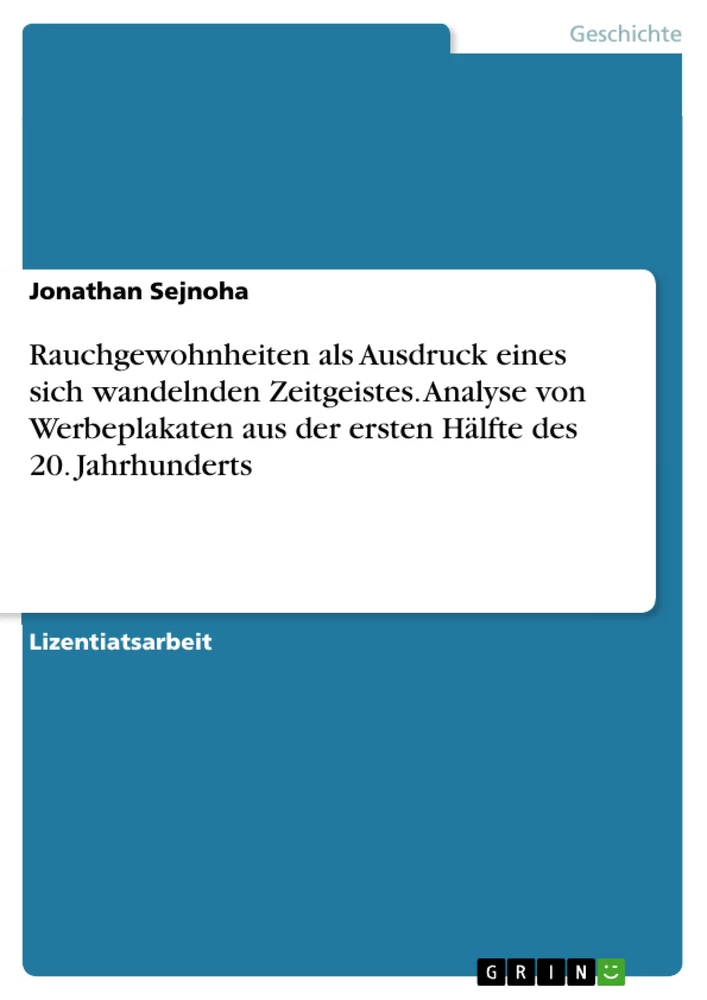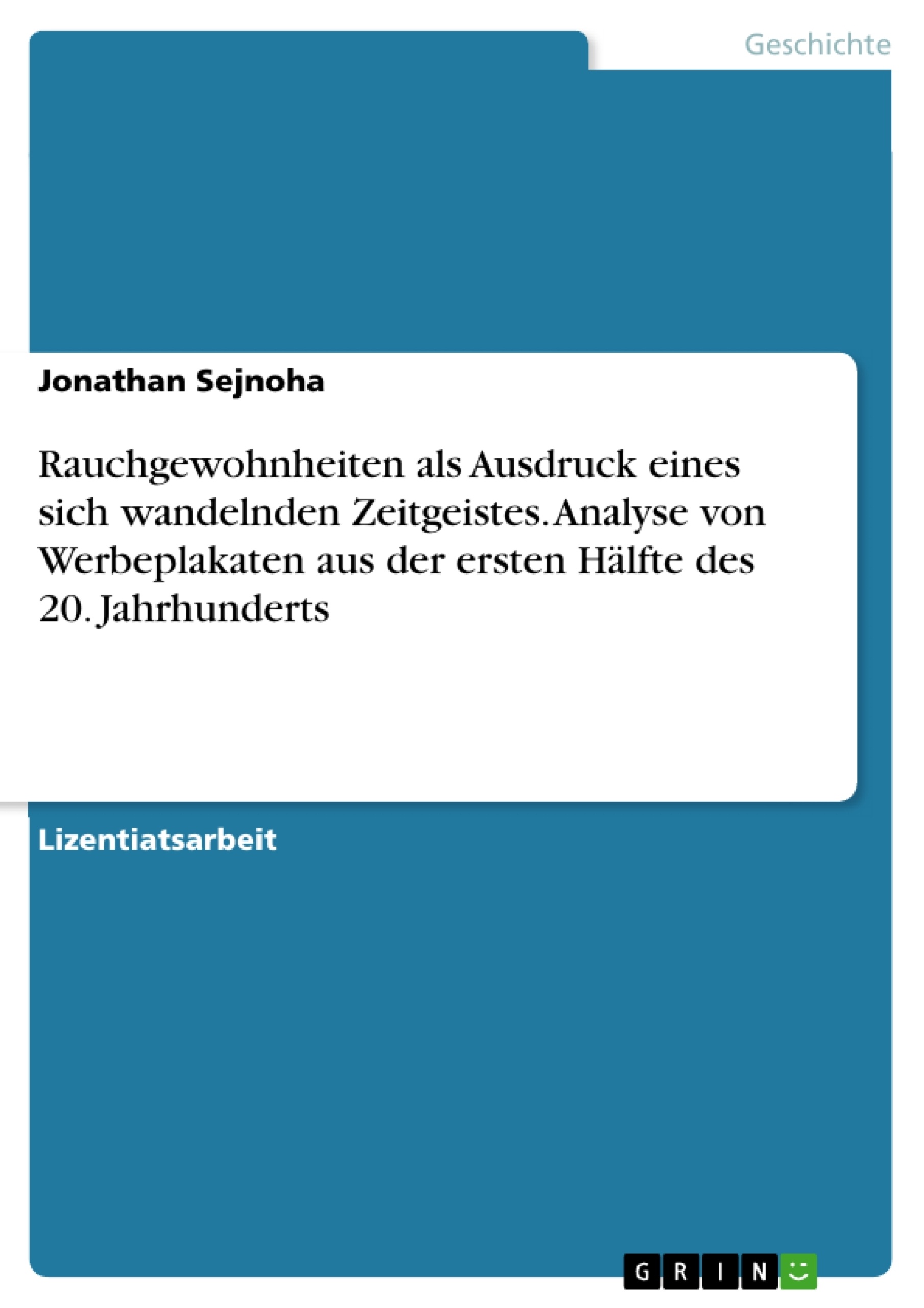Ich erinnere mich noch genau an meine erste Zigarette, es war eine Marlboro, ich versuchte sie zu inhalieren und wunderte mich nach dem ersten Zug über das intensive Kratzen im Hals. Trotz der Tatsache, dass ich keinen Genuss verspürte, ja sogar gegen Übelkeit ankämpfen musste, war es nicht meine letzte Zigarette. Ähnlich erging es vermutlich den ersten Europäern, die gegen Ende des 15. Jahrhunderts auf ihren Entdeckungsreisen das erste Mal mit der Sitte des Tabakrauchens konfrontiert wurden.
Es ist deshalb umso erstaunlicher, dass der Tabak sich innerhalb von 300 Jahren rund um den Globus verbreitete und heute das am weitesten verbreitete Genussmittel der Welt darstellt. Obwohl das Rauchen in den westlichen Ländern zumindest leicht abgenommen hat, nimmt der Tabakkonsum weltweit immer noch zu. In der Schweiz rauchten im Jahr 2002 rund 31 % der über 15 jährigen Bevölkerung; im Vergleich zum europäischen Mittel ist der Anteil der rauchenden Bevölkerung zwar kleiner, dennoch raucht durchschnittlich jeder dritte Schweizer und gefährdet dadurch seine Gesundheit.
Obwohl die Raucherquote seit 1997 abnehmend ist, blieb der Tabakkonsum bei Jugendlichen konstant und hat bei jungen Frauen sogar zugenommen. Es wäre ziemlich blauäugig, die ausserordentliche Beliebtheit des Tabaks alleine auf seine physikalischen Eigenschaften – respektive auf seine suchtfördernde Wirkung zu reduzieren, es steckt nämlich weit mehr dahinter.
Die Nicotiana, wie der Tabak im Folgenden auch genannt werden soll, ist schon seit geraumer Zeit als ein wichtiges Kulturgut zu verstehen, dessen Eigenheiten nicht nur auf den individuellen Gebrauch beschränkt bleiben sondern in einem breiteren gesellschaftlichen Umfeld betrachtet werden müssen. So ist das Rauchen nicht einfach eine schlechte Angewohnheit, es ist ebenso ein wichtiges Kommunikationsmittel, ein genussvoller Moment oder ein Attribut, das den eigenen Charakter unterstreicht.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Tabakforschung im kulturhistorischen Rahmen
- Gegenstandsbestimmung und zur Forschungsstand
- Tabakkonsum als soziokulturelles Konstrukt: Gesellschaftliche Bewertungsmuster und sozialpsychologische Funktionen
- Man ist was man raucht - vom symbolischen Sinngehalt zu polaren Bewertungsmustern
- Zu den sozialpsychologischen Funktionen: Tabakforschung aus der Makroperspektive
- Medizinische Funktion: Ein krebserregendes Heilmittel
- Zur (alltags-)rituellen Funktion des Tabaks: Vom Schamanismus zur Zigarette danach
- Integrative Funktion: Vom Raucherabteil zur goldenen Tabakdose
- Das mehrdimensionale Betrachtungsmodell als integrativer Ansatz in der kulturhistorischen Tabakforschung
- Plakatwerbung als Gegenstand der Visual History
- Strukturen einer Bilderflut - zur Quellenorganisation
- Ikonographie und Historik - zur Quelleninterpretation
- Nicotiana Helvetica: Rauchformen und kulturelle Praxis in der Schweiz
- Vom Acker an die Uni: Pfeifenraucher in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts
- Zigarren und Stumpen: Aufstieg & Fall einer Rauchkultur
- Zur Zigarette: Von der exotischen Rauchmode zum Massenkonsumgut
- Rauchgewohnheiten in der „Übergangszeit“ - von Relikten aus der Belle Epoque zu modernen Konsumformen der Nachkriegsgesellschaft
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der soziokulturellen Bedeutung des Rauchens in der Schweiz zwischen 1900 und 1950. Der Fokus liegt dabei auf dem Tabakkonsum als Ausdruck der zeitgenössischen Alltagskultur. Die Arbeit untersucht die gesellschaftliche Durchdringung verschiedener Konsumarten, die soziodemographischen Merkmale der Konsumenten und die Rolle der Nicotiana in der kulturellen Praxis der Bevölkerung. Dabei wird der Werdegang der Rauchgewohnheiten mit einem tiefgreifenden sozialen Wandel in Beziehung gesetzt.
- Die Entwicklung der Rauchgewohnheiten in der Schweiz in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts
- Die gesellschaftliche Bewertung des Rauchens und die Entstehung von polaren Bewertungsmustern
- Die sozialpsychologischen Funktionen des Tabaks auf individueller und gesellschaftlicher Ebene
- Die Bedeutung der Plakatwerbung für die Visualisierung und Verbreitung von Rauchgewohnheiten
- Der Einfluss des Tabaks auf die Alltagskultur und die kulturellen Praktiken in der Schweiz
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik ein und beschreibt die Motivation für die Forschungsarbeit. Sie stellt den Tabak als ein wichtiges Kulturgut vor, dessen Eigenheiten nicht nur auf den individuellen Gebrauch beschränkt bleiben, sondern in einem breiteren gesellschaftlichen Umfeld betrachtet werden müssen.
Das zweite Kapitel behandelt die Tabakforschung im kulturhistorischen Rahmen und definiert den Forschungsgegenstand. Es wird ein Überblick über den Forschungsstand gegeben und die methodischen Ansätze, mit denen sich das Tabakrauchen als soziokulturelles Konstrukt beschreiben lässt, erläutert.
Das dritte Kapitel beleuchtet den Tabakkonsum als soziokulturelles Konstrukt. Es untersucht die gesellschaftlichen Bewertungsmuster und die sozialpsychologischen Funktionen des Tabaks. Das Kapitel geht auf die symbolische Bedeutung des Rauchens, die medizinischen Funktionen, die (alltags-)rituellen Funktionen und die integrative Funktion des Tabaks ein.
Das vierte Kapitel befasst sich mit der Plakatwerbung als Gegenstand der Visual History. Es analysiert die Strukturen der Plakatwerbung und die Bedeutung der Ikonographie und Historik für die Quelleninterpretation.
Das fünfte Kapitel konzentriert sich auf die Rauchformen und kulturelle Praxis in der Schweiz. Es behandelt die Entwicklung des Pfeifenrauchens, der Zigarren und der Zigarette und analysiert deren Einfluss auf die schweizerische Alltagskultur.
Das sechste Kapitel untersucht die Rauchgewohnheiten in der „Übergangszeit“ von der Belle Epoque zur Nachkriegsgesellschaft. Es betrachtet den Wandel der Rauchgewohnheiten und den Einfluss von sozialen und kulturellen Veränderungen auf den Tabakkonsum.
Schlüsselwörter
Tabakkonsum, Rauchgewohnheiten, Kulturgeschichte, Schweiz, 20. Jahrhundert, soziokulturelle Bedeutung, Plakatwerbung, Visual History, gesellschaftliche Bewertungsmuster, sozialpsychologische Funktionen, Alltagskultur, Nicotiana Helvetica, Pfeifenraucher, Zigarren, Zigarette, Belle Epoque, Nachkriegsgesellschaft.
Häufig gestellte Fragen
Wie entwickelten sich die Rauchgewohnheiten in der Schweiz zwischen 1900 und 1950?
Die Zeit war geprägt von einem Wandel traditioneller Formen wie dem Pfeifen- und Zigarrenrauchen hin zum Massenkonsumgut Zigarette.
Welche Rolle spielt die Plakatwerbung in dieser Untersuchung?
Werbeplakate dienen als Quelle der Visual History, um gesellschaftliche Bewertungsmuster und die Ikonographie des Rauchens im 20. Jahrhundert zu analysieren.
Was sind die sozialpsychologischen Funktionen des Tabakkonsums?
Tabak fungiert als Kommunikationsmittel, Genussmoment, rituelles Element („Zigarette danach“) und als Attribut zur Unterstreichung des eigenen Charakters.
Inwiefern wurde Tabak früher als „Heilmittel“ betrachtet?
Die Arbeit beleuchtet die medizinische Funktion des Tabaks in der Geschichte, bevor seine krebserregende Wirkung wissenschaftlich in den Vordergrund rückte.
Was versteht man unter „Nicotiana Helvetica“?
Dieser Begriff bezieht sich auf die spezifisch schweizerische Ausprägung der Rauchkultur und deren Einbettung in die nationale Alltagskultur.
- Arbeit zitieren
- Jonathan Sejnoha (Autor:in), 2007, Rauchgewohnheiten als Ausdruck eines sich wandelnden Zeitgeistes. Analyse von Werbeplakaten aus der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/117479