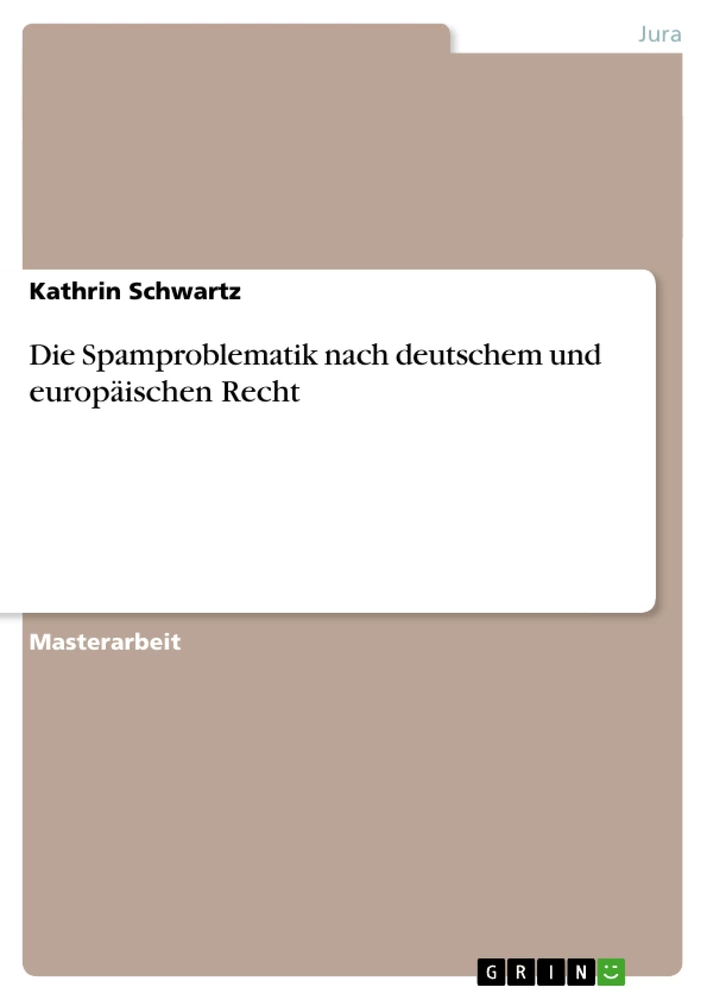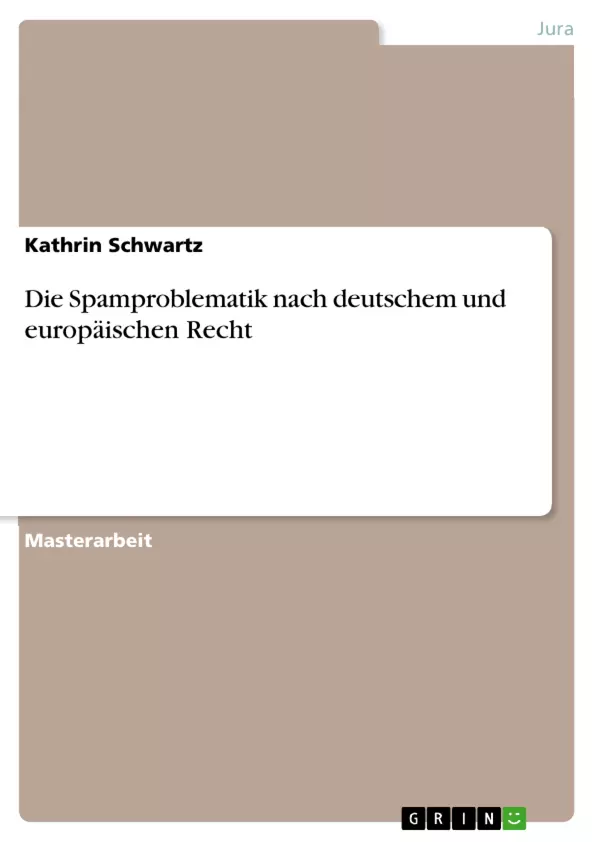Das Medium E-Mail wird jeden Tag von Millionen Menschen in der
ganzen Welt genutzt. Mit dem Siegeszug der E-Mail in den letzten
zehn Jahren ging aber auch eine steigende Zahl von Missbrauchsfällen
einher. Was als kleines Ärgernis begann, ist heute ein großes und sehr
teures Problem, das die Verfügbarkeit dieses Dienstes gefährdet.
Werbemail und andere unerwünschte E-Mails (Spam1), kosten jeden
einzelnen Zeit und die Gesellschaft jedes Jahr viele Milliarden Euro.
Das tägliche Spam-Aufkommen hat die Zahl der erwünschten E-Mails
bei weitem überschritten. Die Anzahl der Werbe-E-Mails hat
somit kontinuierlich zugenommen, in Deutschland beträgt der Anteil
an Spam-Mails 2006 inzwischen rund 80% aller gesendeten
Nachrichten. 2005 betrug der Spam-Anteil noch rund 60%2; 2001
dagegen lediglich 7%.
Ein Großteil der störenden elektronischen Post kommt aus den USA
und China.
In den letzten Jahren wurden viele Verfahren im Internet entwickelt,
die helfen, Spam zu vermeiden oder zumindest den Empfänger davor
zu schützen. Umfangreiche Filtersysteme untersuchen eingehende E-Mail
und trennen Unerwünschtes von Erwünschtem. Die Kosten dafür
sind enorm, aber ohne Maßnahmen gegen Spam wäre E-Mail für viele
nicht mehr nutzbar.
In den letzten Jahren wurde sowohl auf der europäischen als auch der
deutschen Gesetzesebene verschiedene Regelungen erlassen, um diese
Flut unverlangter E-Mails einzudämmen.
Inhaltsverzeichnis
- A. Einleitung
- I. Teil 1: Begriff der Werbung und Zulässigkeit von Spam
- 1. Begriff der Werbung
- a) Europäische Vorgaben
- b) Deutsche Vorgaben
- 2. Begriff „Spam“
- a) Entstehungsgeschichte
- b) Definition
- c) Spamtypen
- 3. Zulässigkeit von Spam
- a) Europäische Vorgaben
- b) Deutsche Vorgaben
- II. Teil 2: Sammeln/ Verwenden von E- Mail- Adressen und das Transparenzgebot nach dem TMG
- 1. Sammeln und Verwenden von E-Mail-Adressen
- a) Allgemeine Zulässigkeitsvoraussetzungen für die Anwendbarkeit der Datenschutzregelungen nach TMG und BSDG
- b) Anwendungsbereich des TMG und des BDSG
- c) Spezielle Zulässigkeitsvoraussetzungen nach dem TMG
- d) Spezielle Zulässigkeitsvoraussetzungen nach dem BDSG
- e) Beurteilung der rechtlichen Zulässigkeit nach dem TMG und dem BDSG
- 2. Transparenzgebot nach dem TMG
- a) Allgemeines
- b) § 6 Abs. 2 TMG
- c) Zusammenfassung
- B. Fazit
- C. Anhänge
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit der rechtlichen Problematik von Spam-Mails im deutschen und europäischen Recht. Sie analysiert den Begriff der Werbung und die Zulässigkeit von Spam unter Berücksichtigung relevanter Rechtsvorschriften. Darüber hinaus untersucht sie die rechtlichen Rahmenbedingungen für das Sammeln und Verwenden von E-Mail-Adressen sowie das Transparenzgebot nach dem Telemediengesetz (TMG).
- Begriff und Definition von Spam
- Rechtliche Zulässigkeit von Spam im deutschen und europäischen Recht
- Datenschutzrechtliche Aspekte des Sammelns und Verwendens von E-Mail-Adressen
- Transparenzgebot nach dem TMG
- Ansprüche und Sanktionen bei Verstößen gegen die rechtlichen Vorgaben
Zusammenfassung der Kapitel
- Teil 1: Begriff der Werbung und Zulässigkeit von Spam
- Kapitel 1: Begriff der Werbung - Definition und Abgrenzung im europäischen und deutschen Recht
- Kapitel 2: Begriff „Spam“ - Entstehungsgeschichte, Definition und Arten von Spam
- Kapitel 3: Zulässigkeit von Spam - Analyse der relevanten Rechtsvorschriften im europäischen und deutschen Recht
- Teil 2: Sammeln/ Verwenden von E- Mail- Adressen und das Transparenzgebot nach dem TMG
- Kapitel 1: Sammeln und Verwenden von E-Mail-Adressen - Rechtliche Rahmenbedingungen nach TMG und BDSG
- Kapitel 2: Transparenzgebot nach dem TMG - Analyse der rechtlichen Vorgaben und deren Bedeutung für die Praxis
Schlüsselwörter
Spam, Werbung, Datenschutz, Telemediengesetz (TMG), Bundesdatenschutzgesetz (BDSG), elektronische Kommunikation, Opt-In, Opt-Out, Transparenzgebot, kommerzielle Kommunikation, E-Mail-Adressen, rechtliche Zulässigkeit, Ansprüche, Sanktionen.
Häufig gestellte Fragen
Was ist die Definition von Spam im rechtlichen Sinne?
Spam bezeichnet unverlangte elektronische Nachrichten, meist zu Werbezwecken, die ohne vorherige Einwilligung des Empfängers versendet werden.
Welche Gesetze regeln den Umgang mit E-Mail-Werbung in Deutschland?
Maßgeblich sind das Telemediengesetz (TMG), das Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) sowie das Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG).
Was besagt das Transparenzgebot nach dem TMG?
Kommerzielle Kommunikationen müssen klar als solche erkennbar sein, und der Absender muss eindeutig identifizierbar sein (Impressumspflicht).
Ist das Sammeln von E-Mail-Adressen für Marketingzwecke erlaubt?
Dies ist nur unter strengen datenschutzrechtlichen Voraussetzungen zulässig, in der Regel ist eine ausdrückliche Einwilligung (Opt-In) des Betroffenen erforderlich.
Welche Sanktionen drohen bei Verstößen gegen Anti-Spam-Regelungen?
Es können Abmahnungen durch Wettbewerber oder Verbraucherschutzverbände sowie empfindliche Bußgelder durch Aufsichtsbehörden drohen.
- Arbeit zitieren
- Kathrin Schwartz (Autor:in), 2008, Die Spamproblematik nach deutschem und europäischen Recht, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/117490