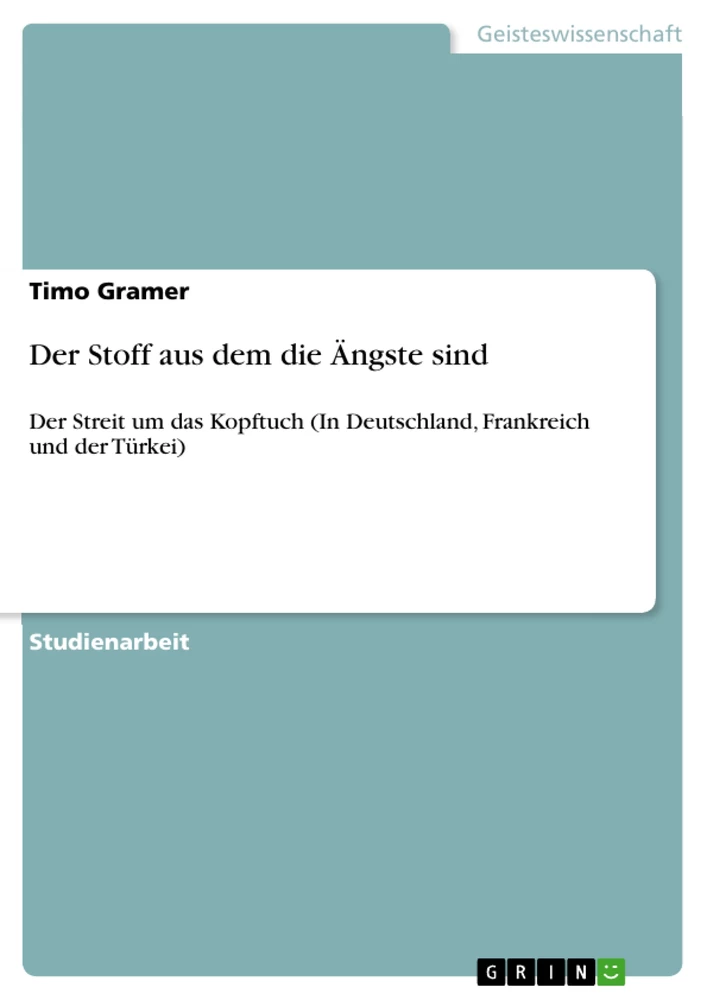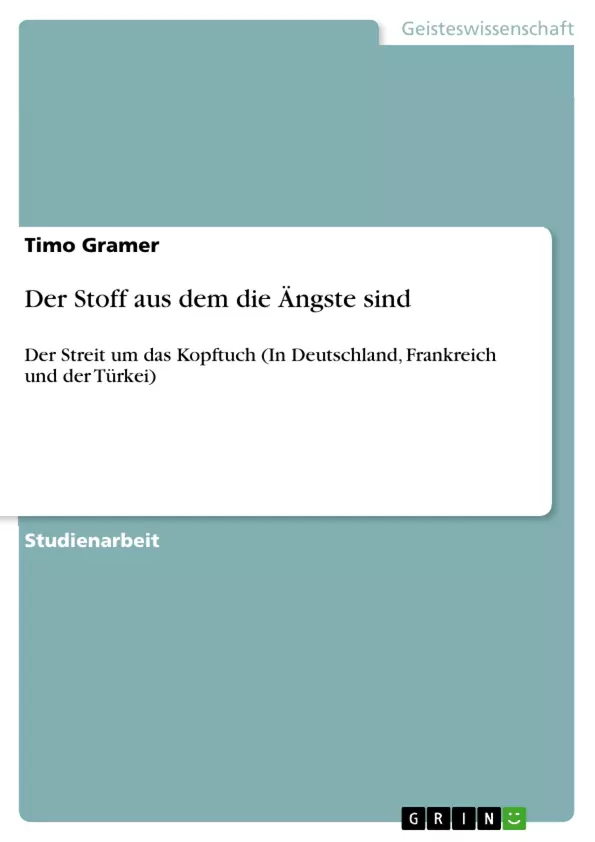„Gerade weil es so schwer ist, seine religiösen von seinen kulturellen und politischen Bedeutungen zu scheiden, setzt es so mächtige Emotionen frei“, schreibt die Soziologin und Islamforscherin Nilüfer Göle über das Kopftuch . Gerade solche Differenzierungen scheinen aber unverzichtbar ob des undurchsichtigen Konglomerates an Zuschreibungen für ebendieses. Deshalb stellt diese Arbeit im Folgenden die Selbst- und Fremdwahrnehmung muslimischer Frauen mit Kopftuch in den Mittelpunkt. Dabei sollen die unterschiedlichen Ebenen auf denen das Kopftuch diskutiert wird, historisch eingeordnet und abseits medialer Aufwertungen sachlich kategorisiert werden. So stellt die Arbeit zunächst einen kurzen Abriss historischer Islam-Quellen vor, welche sowohl Kopftuchkritiker als auch Befürworter des Öfteren rezitieren. Auch auf dieser Grundlage werden exemplarisch die öffentlichen Kopftuchdebatten der vergangenen Jahre in Deutschland, Frankreich und der Türkei an gewissen „Präzedenzfällen“ skizziert. Hinzu kommen aktuelle Studien und Statistiken über den Islam im Allgemeinen sowie über das Kopftuch im Speziellen. Abschließend fasst der Kommentar die gemachten Aussagen auch im Sinne eines Ausblickes zusammen und setzt sich kritisch mit dem Begriff der Symbolik auseinander.
Inhaltsverzeichnis
- I Einleitung: Symbolik von Kleidung
- I.I Mode nach Façon des Staates
- I.II Die Symbolkraft des Kopftuches
- II Historische Bedeutung / Kopftuch im Koran
- II.I Koran und Sunna
- II.II Verschleierung im Koran
- II.III Das Tuch als historische Sozialverfassung
- III. Das Kopftuch in der öffentlichen Debatte
- III.I Testobjekt für nationale Freiheit
- III.II Der Fall Fereshta Ludin in der BRD
- III.III Diskret oder ostentativ?
- IV Kopftuch-Debatten in laizistischen Staaten
- IV.I „Nouvelle Laicite“ in Frankreich
- IV.II Kemalistische Elite und Schleier in der Türkei
- V Muslime in Deutschland – Ein Spiegelbild der Statistiken?
- VI Fazit / Kommentar
- VI.I Islamophobie in modernen Gesellschaften
- VI.II Deutschland und sein „rotes Tuch“
- VI.III Einbahnstraße Symbolik
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit analysiert die Symbolik des Kopftuches und seine Rolle in der öffentlichen Debatte, insbesondere in Deutschland, Frankreich und der Türkei. Sie untersucht die historische Bedeutung des Kopftuches im Islam und die verschiedenen Interpretationen, die ihm in modernen Gesellschaften zugeschrieben werden.
- Die Symbolkraft des Kopftuches als Ausdruck von Religion, Politik und Emanzipation
- Die Rolle des Kopftuches in der öffentlichen Debatte um Integration und kulturelle Identität
- Die staatliche Regulierung von Kleidungsvorschriften und deren Auswirkungen auf individuelle Freiheit
- Die unterschiedlichen Perspektiven auf das Kopftuch in verschiedenen Ländern und Kulturkreisen
- Die Bedeutung von Medienberichten und öffentlichen Diskursen für die Wahrnehmung des Kopftuches
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung beleuchtet die Symbolik von Kleidung im Allgemeinen und die besondere Bedeutung des Kopftuches als Ausdruck von Identität und Zugehörigkeit. Das zweite Kapitel analysiert die historische Bedeutung des Kopftuches im Islam, wobei der Koran und die Sunna als zentrale Quellen betrachtet werden. Das dritte Kapitel befasst sich mit der öffentlichen Debatte um das Kopftuch in Deutschland, insbesondere mit dem Fall Fereshta Ludin. Das vierte Kapitel untersucht die Kopftuchdebatten in laizistischen Staaten wie Frankreich und der Türkei.
Schlüsselwörter
Kopftuch, Islam, Symbolik, Identität, Integration, Laizismus, Islamophobie, öffentliche Debatte, Kulturwissenschaften, Deutschland, Frankreich, Türkei, Medien, Religion, Politik, Emanzipation, Staat, Gesellschaft, Kultur, Geschichte.
Häufig gestellte Fragen
Was symbolisiert das Kopftuch in der öffentlichen Debatte?
Es wird als komplexes Symbol für Religion, politische Gesinnung, kulturelle Identität, aber auch für Unterdrückung oder Emanzipation diskutiert.
Wie wird das Kopftuch im Koran begründet?
Die Arbeit untersucht historische Quellen aus Koran und Sunna, die sowohl von Befürwortern als auch Kritikern zur Rechtfertigung ihrer Positionen herangezogen werden.
Was war der Fall Fereshta Ludin?
Ein bekannter Präzedenzfall in Deutschland, bei dem es um das Recht einer muslimischen Lehrerin ging, im Schuldienst ein Kopftuch zu tragen.
Wie unterscheidet sich die Kopftuchdebatte in Frankreich und der Türkei?
In Frankreich steht der Begriff der 'Nouvelle Laicite' im Fokus, während in der Türkei der Konflikt zwischen kemalistischer Elite und religiöser Tradition prägend war.
Welchen Einfluss haben Medien auf die Wahrnehmung des Kopftuches?
Medienberichte führen oft zu einer emotionalen Aufwertung oder Stigmatisierung des Symbols, was eine sachliche Diskussion erschwert.
- Arbeit zitieren
- Timo Gramer (Autor:in), 2008, Der Stoff aus dem die Ängste sind, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/117505