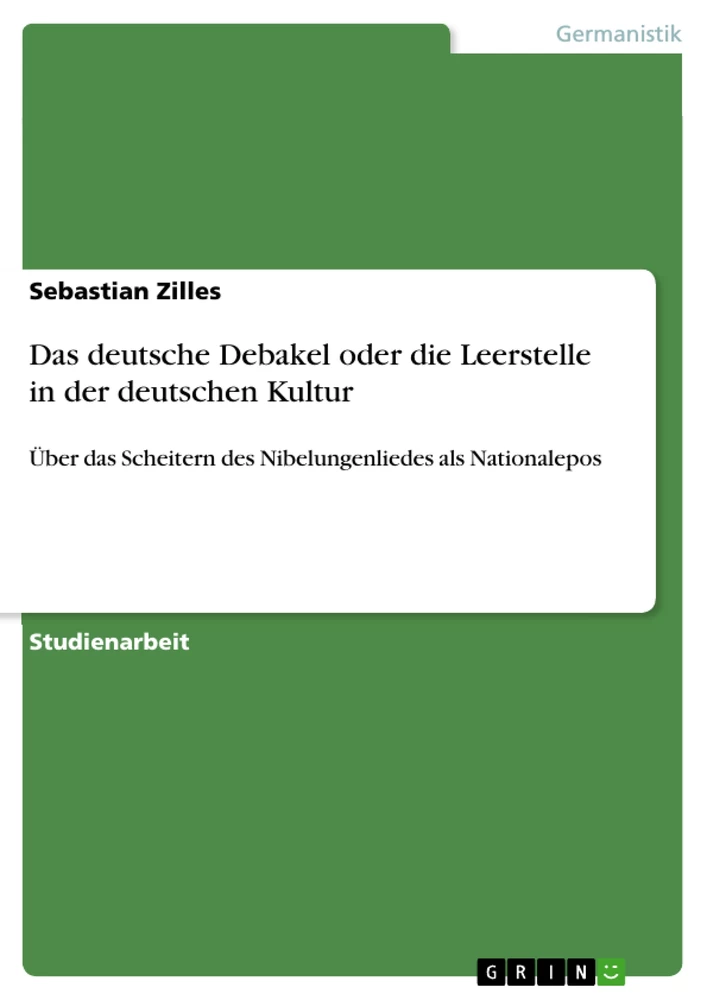Am 29. Juni des Jahres 1755 entdeckt der Lindauer Arzt Jakob Hermann Obereit in der Bibliothek des Grafen von Hohenems die später mit Sigle C versehene Handschrift des Nibelungenliedes. Bis zu diesem Zeitpunkt wurde das Nibelungenlied über zweieinhalb Jahrhunderte hinweg nur gelegentlich von einem Gelehrten als historische Quelle benutzt; seine letzte handfeste Überlieferung findet sich in den ersten Jahren des sechzehnten Jahrhunderts mit dem Eintrag in das Ambrasser Heldenbuch des Kaiser Maximilians. Seinen bedeutenden Fund teilt Obereit dem Schriftsteller und Literaturkritiker Johann Jakob Bodmer in einem eilends geschriebenen Brief mit und kündigt ihm diesen als „zwei alte eingebundene pergamentene Codices von altschwäbischen Gedichten“ an, „darvon der einte sehr schön deutlich geschrieben, einen mittelmäßig dicken Quartband ausmacht, und ein aneinanderhangend weitläufig Heldengedichte zu enthalten scheint, von der burgondischen Königin oder Princessin Chriemhild, der Titel aber ist Adventure von den Gibelungen.“ Nach intensivem Studium der Lektüre ordnet Bodmer das Nibelungenlied der Gattung des Heldenepos zu und bemerkt, dass es „eine Art von Ilias, und wenigstens etwas, so die Grundlage einer Ilias in sich enthält.“ Dieser Vergleich mit dem Nationalepos der Griechen eröffnet nicht nur eine kontroverse Debatte um den Status des Nibelungenliedes als deutsches Nationalepos, sondern damit beginnt auch die „moderne Erfolgsgeschichte [des Epos], die zugleich eine Unheilsgeschichte ist.“
Die vorliegende Arbeit zeichnet sowohl die 'Erfolgsgeschichte', als auch die 'Unheilsgeschichte' des Nibelungenliedes nach. Von dem Hintergrund dieses Spannungsverhältnisses aus betrachtet, ist folgende leitende Fragestellung Gegenstand der Untersuchung: Warum kann das Nibelungenlied nicht als das deutsche Nationalepos bezeichnet werden?
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Nation, Patriotismus, Nationalepos: theoretische Grundgedanken
- Die Rezeptionsgeschichte des Nibelungenliedes
- Das Zeitalter der Aufklärung: ästhetisch motivierte Rezeptionsansätze
- Die Romantik: die zunehmende Politisierung des Nibelungenliedes
- Der Weg ins zwanzigste Jahrhundert: propagandistischer Missbrauch
- Fazit
- Die Leerstelle der deutschen Kultur: das Scheitern des Nibelungenliedes auf Textebene
- 'uns ist in alten mæren...' - Der Aufbau eines kollektiven Gedächtnisses
- Zwischen Ambiguität und Widersprüchlichkeit: das Problem der nibelungischen Figuren
- Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht, warum das Nibelungenlied nicht als deutsches Nationalepos betrachtet werden kann. Sie verfolgt dazu einen zweifachen Ansatz: die Rezeptionsgeschichte des Epos wird im Kontext der jeweiligen politischen und gesellschaftlichen Situation analysiert, und gleichzeitig werden textinterne Aspekte beleuchtet, die gegen eine Einstufung als Nationalepos sprechen. Das Ziel ist es, zu zeigen, dass das Nibelungenlied sowohl rezeptionsgeschichtlich als auch auf Textebene dem Anspruch eines Nationalepos nicht genügt.
- Die Definition von Nation, Patriotismus und Nationalepos
- Die Rezeptionsgeschichte des Nibelungenliedes in der Aufklärung, Romantik und im 20. Jahrhundert
- Die Analyse des Nibelungenliedes auf der Textebene hinsichtlich seiner Eignung als Nationalepos
- Die Rolle des Nibelungenliedes im Prozess der nationalen Identitätsbildung
- Das Scheitern des Nibelungenliedes als Nationalepos
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung beschreibt die Entdeckung des Nibelungenliedes im Jahr 1755 und den Beginn der Debatte um seinen Status als deutsches Nationalepos. Sie führt die zentrale Forschungsfrage ein: Warum kann das Nibelungenlied nicht als deutsches Nationalepos bezeichnet werden? Die Arbeit verfolgt einen doppelten Ansatz: die Rezeptionsgeschichte und die textuelle Analyse. Der Vergleich mit der Ilias wird als Ausgangspunkt der Diskussion um das Nibelungenlied als Nationalepos hervorgehoben.
Nation, Patriotismus, Nationalepos: theoretische Grundgedanken: Dieses Kapitel klärt die Begriffe Nation, Patriotismus und Nationalepos. Es wird Goethes Aussage zitiert, dass eine Nation ein Nationalepos benötigt, um zu bestehen. Der Unterschied zwischen Patriotismus und Nationalismus wird herausgestellt, wobei der Nationalismus als Gefahr für den Patriotismus beschrieben wird. Die unterschiedliche Instrumentalisierung des Nibelungenliedes durch patriotische und nationalistische Bewegungen wird angedeutet. Die Charakteristika eines nationalistischen Textes werden vorgestellt.
Die Rezeptionsgeschichte des Nibelungenliedes: Dieses Kapitel behandelt die Rezeptionsgeschichte des Nibelungenliedes, unterteilt in die Aufklärung, die Romantik und das 20. Jahrhundert. Die Aufklärung wird als Beginn der "Erfolgsgeschichte" des Nibelungenliedes dargestellt, während die Romantik eine zunehmende Politisierung des Werkes zeigt. Das 20. Jahrhundert ist geprägt von einem propagandistischen Missbrauch des Epos. Das Kapitel analysiert die jeweiligen historischen und politischen Kontexte und ihre Auswirkungen auf die Interpretation des Nibelungenliedes.
Die Leerstelle der deutschen Kultur: das Scheitern des Nibelungenliedes auf Textebene: Dieses Kapitel untersucht, warum das Nibelungenlied textuell betrachtet kein Nationalepos sein kann. Es analysiert den Aufbau eines kollektiven Gedächtnisses im Epos und die Problematik der ambivalenten und widersprüchlichen Figuren. Die Analyse konzentriert sich auf den Beginn und das Ende des Epos sowie auf die Charakterisierung der Figuren, um die These vom Scheitern des Nibelungenliedes als Nationalepos zu untermauern.
Schlüsselwörter
Nibelungenlied, Nationalepos, Nation, Patriotismus, Nationalismus, Rezeptionsgeschichte, Aufklärung, Romantik, 20. Jahrhundert, kollektives Gedächtnis, Figurenkonzeption, Ambiguität, deutsche Identität, politische Instrumentalisierung.
Häufig gestellte Fragen zum Nibelungenlied als deutsches Nationalepos
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht, warum das Nibelungenlied trotz seiner Popularität nicht als deutsches Nationalepos betrachtet werden kann. Sie analysiert sowohl die Rezeptionsgeschichte des Epos im Kontext der jeweiligen politischen und gesellschaftlichen Situationen als auch textinterne Aspekte, die gegen eine solche Einstufung sprechen.
Welche Methode wird angewendet?
Die Arbeit verfolgt einen zweifachen Ansatz: eine Analyse der Rezeptionsgeschichte des Nibelungenliedes in verschiedenen Epochen (Aufklärung, Romantik, 20. Jahrhundert) und eine textuelle Analyse des Epos selbst. Der Vergleich mit der Ilias wird als Ausgangspunkt der Diskussion herangezogen.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel zur Definition von Nation, Patriotismus und Nationalepos, ein Kapitel zur Rezeptionsgeschichte des Nibelungenliedes, ein Kapitel zur textlichen Analyse des Epos und eine Schlussbetrachtung. Die einzelnen Kapitel werden jeweils zusammengefasst.
Wie wird Nation, Patriotismus und Nationalepos definiert?
Das Kapitel "Nation, Patriotismus, Nationalepos: theoretische Grundgedanken" klärt diese Begriffe. Es zitiert Goethes Aussage über die Notwendigkeit eines Nationalepos für eine Nation und differenziert zwischen Patriotismus und Nationalismus, wobei letzterer als Gefahr für ersteren dargestellt wird. Die unterschiedliche Instrumentalisierung des Nibelungenliedes durch patriotische und nationalistische Bewegungen wird thematisiert.
Wie wird die Rezeptionsgeschichte des Nibelungenliedes dargestellt?
Die Rezeptionsgeschichte wird in drei Phasen unterteilt: Aufklärung (Beginn der "Erfolgsgeschichte"), Romantik (zunehmende Politisierung) und 20. Jahrhundert (propagandistischer Missbrauch). Der jeweilige historische und politische Kontext und seine Auswirkungen auf die Interpretation des Nibelungenliedes werden analysiert.
Welche textinternen Aspekte werden untersucht?
Die textuelle Analyse konzentriert sich auf den Aufbau eines kollektiven Gedächtnisses im Epos und die Problematik der ambivalenten und widersprüchlichen Figuren. Der Beginn und das Ende des Epos sowie die Charakterisierung der Figuren werden analysiert, um die These vom Scheitern des Nibelungenliedes als Nationalepos zu untermauern.
Welche Schlussfolgerung zieht die Arbeit?
Die Arbeit kommt zu dem Schluss, dass das Nibelungenlied sowohl rezeptionsgeschichtlich als auch auf Textebene dem Anspruch eines Nationalepos nicht genügt. Es scheitert sowohl aufgrund seiner ambivalenten Figuren und seiner Textstruktur als auch aufgrund seiner unterschiedlichen und oft widersprüchlichen Interpretationen in verschiedenen Epochen.
Welche Schlüsselwörter sind relevant?
Die Schlüsselwörter umfassen: Nibelungenlied, Nationalepos, Nation, Patriotismus, Nationalismus, Rezeptionsgeschichte, Aufklärung, Romantik, 20. Jahrhundert, kollektives Gedächtnis, Figurenkonzeption, Ambiguität, deutsche Identität, politische Instrumentalisierung.
- Quote paper
- Sebastian Zilles (Author), 2008, Das deutsche Debakel oder die Leerstelle in der deutschen Kultur, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/117518