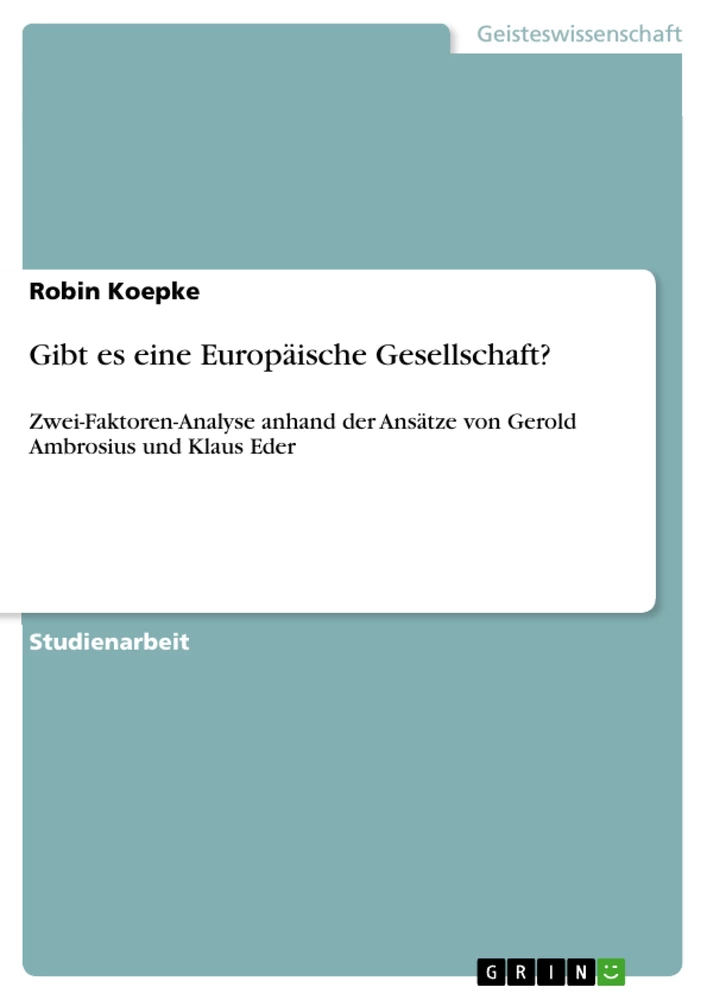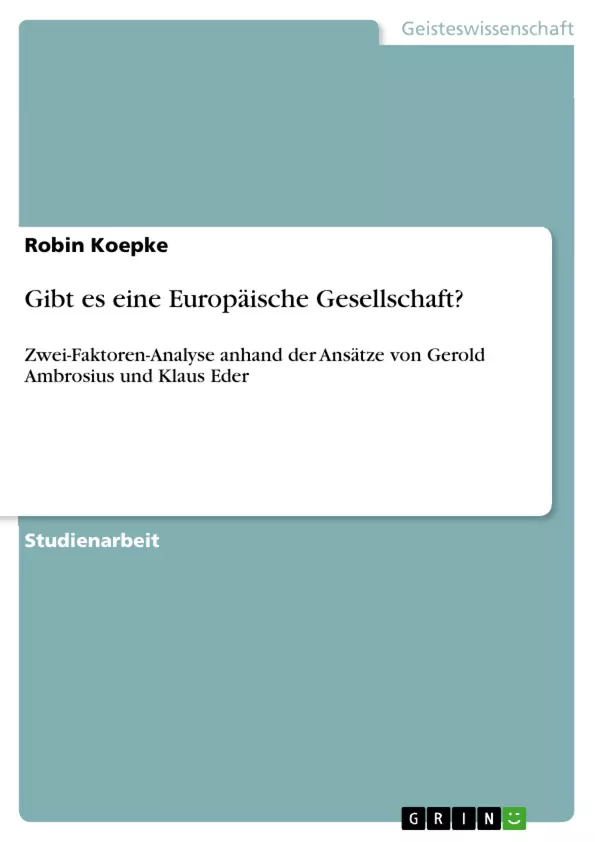Der Vorliegende Aufsatz soll den Beitrag leisten, die Bedeutung dieses Mangels an Gemeinsamkeiten aufzuzeigen und zu erklären. Dabei werde ich argumentieren, dass die Mechanismen der europäischen Einigung sich auf den Abbau von Unterschieden konzentriert - und dabei den Aufbau von Gemeinsamkeiten vernachlässigt. Diese auf den ersten Blick spitzfindige Unterscheidung steht im Zentrum der vorliegenden Untersuchung. Um diese Differenzierung erkenntnisbringend anwenden zu können, werde ich die Zwei-Faktoren-Analyse nach Frederick Herzberg verwenden. Anhand dieses heuristischen Modells werde ich Einflussfaktoren der europäischen Integration zwei Kategorien zuordnen. Zum einen sollen Faktoren identifiziert werden, die Unterschiede abbauen, zum anderen solche, die Gemeinsamkeiten aufbauen. Zentrales Anliegen dieser Arbeit ist es, zu zeigen, dass die Faktoren dieser beiden Kategorien eine vollkommen unterschiedliche Integrationswirkung haben. Aus methodischen Gründen halte ich es für wichtig, den Bezugsrahmen und das Analyseziel der vorliegenden Arbeit vorab klar abzustecken. Daher werde ich zunächst den Gesellschaftsbegriff definieren, der in der Folge Verwendung finden soll. Sodann werde ich das herzbergsche Zwei-Faktoren-Modell erläutern. Anhand zweier exemplarisch behandelter europasoziologischer Ansätze, dem Zentrum-Peripherie-Modell von Gerold Ambrosius und dem Modell Transnationaler Kommunikationsräume Klaus Eders, soll ein im Wandel begriffenes Europa auf seine „Gesellschaftsfähigkeit“ untersucht werden. Beide Ansätze werden zunächst erläutert und dann anhand des Zwei-Faktoren-Modells auf ihre integrationstechnische Wirkung untersucht. Abschließend werde ich zusammenfassen, welche Implikationen sich daraus bezüglich der Existenz oder Entstehung einer europäischen Gesellschaft ergeben.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Zum Begriff der Gesellschaft
- Heuristisches Modell der Zwei-Faktoren-Analyse nach Herzberg
- Zentrum-Peripherie-Ansatz nach Gerold Ambrosius
- Zentrum-Peripherie als Dissatisfaktor
- Modell der Transnationalen Kommunikationsräume nach Klaus Eder
- Erinnerungskommunikation als Satisfaktor
- Schlussfolgerungen und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit untersucht die Frage, ob es eine europäische Gesellschaft gibt. Sie analysiert die Mechanismen der europäischen Einigung und argumentiert, dass diese sich auf den Abbau von Unterschieden konzentrieren, während der Aufbau von Gemeinsamkeiten vernachlässigt wird. Die Arbeit verwendet die Zwei-Faktoren-Analyse nach Frederick Herzberg, um Einflussfaktoren der europäischen Integration in zwei Kategorien zu ordnen: Faktoren, die Unterschiede abbauen, und Faktoren, die Gemeinsamkeiten aufbauen.
- Analyse der Integrationsprozesse in Europa
- Untersuchung der Unterschiede und Gemeinsamkeiten in Europa
- Anwendung der Zwei-Faktoren-Analyse auf die europäische Integration
- Bewertung der Integrationswirkung von Faktoren, die Unterschiede abbauen und Gemeinsamkeiten aufbauen
- Diskussion der Implikationen für die Existenz oder Entstehung einer europäischen Gesellschaft
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Problematik des Begriffs „europäische Gesellschaft“ dar und erläutert die Zielsetzung und den methodischen Ansatz der Arbeit. Kapitel II definiert den Begriff „Gesellschaft“ im Kontext der europäischen Integration. Kapitel III stellt das Zwei-Faktoren-Modell nach Herzberg vor. Kapitel IV und V analysieren den Zentrum-Peripherie-Ansatz von Gerold Ambrosius und interpretieren ihn im Kontext der Zwei-Faktoren-Analyse. Kapitel VI und VII befassen sich mit dem Modell Transnationaler Kommunikationsräume von Klaus Eder und untersuchen die Bedeutung von Erinnerungskommunikation als Integrationsfaktor.
Schlüsselwörter
Europäische Gesellschaft, Zwei-Faktoren-Analyse, Zentrum-Peripherie, Transnationale Kommunikationsräume, Erinnerungskommunikation, Integration, Unterschiede, Gemeinsamkeiten, europäische Einigung.
Häufig gestellte Fragen
Gibt es eine europäische Gesellschaft?
Die Arbeit argumentiert, dass die EU zwar Unterschiede abbaut, aber noch zu wenige echte Gemeinsamkeiten aufbaut, um von einer vollendeten Gesellschaft zu sprechen.
Was ist die Zwei-Faktoren-Analyse nach Herzberg?
Dieses Modell unterscheidet zwischen Faktoren, die Unzufriedenheit verhindern (Unterschiede abbauen), und Faktoren, die echte Zufriedenheit bzw. Integration stiften (Gemeinsamkeiten aufbauen).
Was besagt das Zentrum-Peripherie-Modell von Ambrosius?
Es beschreibt die wirtschaftlichen und politischen Abhängigkeiten zwischen den starken Zentren Europas und den strukturschwächeren Randgebieten.
Was sind transnationale Kommunikationsräume?
Nach Klaus Eder sind dies Räume, in denen über Grenzen hinweg kommuniziert wird, was eine Voraussetzung für die Entstehung einer europäischen Identität ist.
Welche Rolle spielt die Erinnerungskommunikation?
Das gemeinsame Gedenken und die Aufarbeitung der Geschichte dienen als "Satisfaktor", um eine tiefere gesellschaftliche Bindung in Europa zu schaffen.
- Arbeit zitieren
- M.A. Candidate Robin Koepke (Autor:in), 2008, Gibt es eine Europäische Gesellschaft?, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/117525