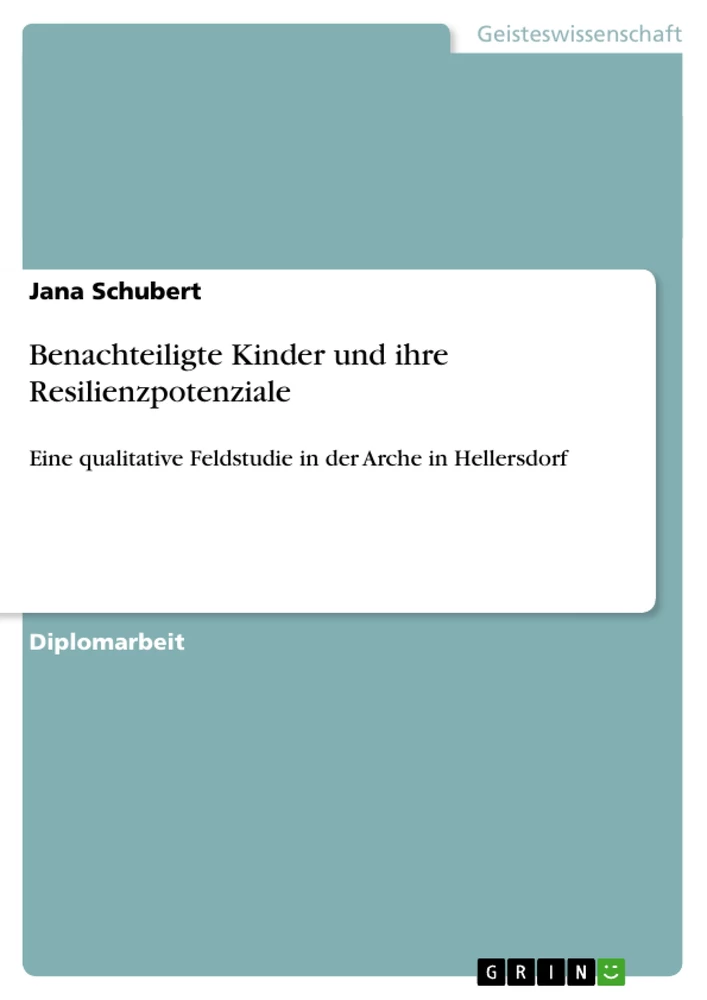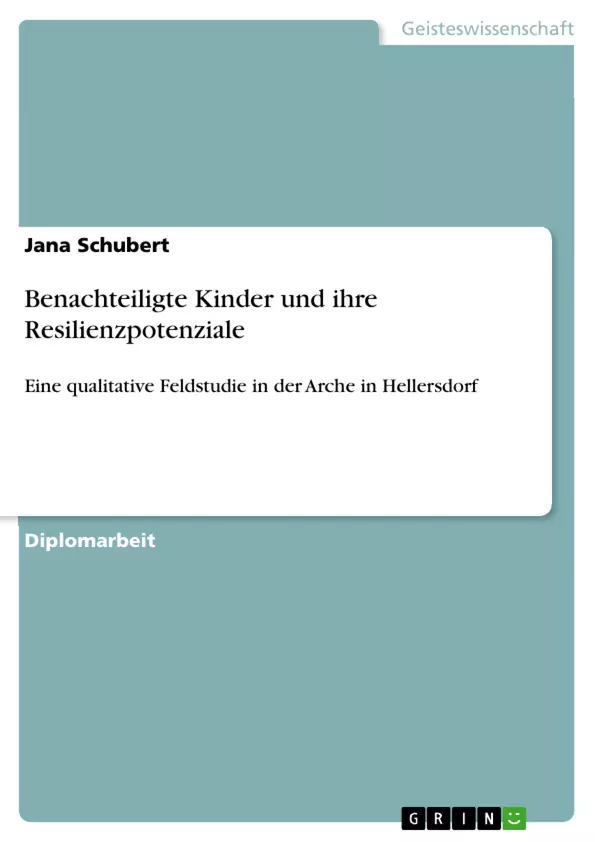Wieso kann ein Mensch ertragen, was den anderen verstört oder zerstört? Wie wirken sich schwierige, teils aussichtslose Lebenslagen und Lebenssituationen auf Kinder aus? Welchen Schutz erfahren Eltern und Kinder aus benachteiligten Verhältnissen durch staatliche Institutionen? Mit diesen Fragen werde ich mich in der vorliegenden Arbeit beschäftigen. Seit den 1990er Jahren wird die Armut von Kindern und Jugendlichen im Kontext von Armuts- und Sozialberichterstattung in der Fachöffentlichkeit zunehmend zur Kenntnis genommen. Auch aktuell wird das Thema Kinderarmut in den Medien diskutiert. Anlass ist das vermehrte Bekanntwerden von Vernachlässigungsfällen und Gewalt gegen Kinder. Als Ursachen werden elterliche Überforderung, mangelnde elterliche Anteilnahme und Unterstützungsfähigkeit deklariert.
Inhaltsverzeichnis
- I. EINLEITUNG
- II. KONZEPTUELLER RAHMEN
- II. 1 Kindheit
- II. 1. 1. gesellschaftstheoretische Ansätze
- II. 1. 2 sozialisationstheoretische Ansätze und das Kind als sozialer Akteur
- II. 1. 3. strukturelle Ansätze
- Kindheit in der Generationenbeziehung (Leena Alanen)
- Kinder als ökonomische Generation (Jens Qvortrup)
- II. 1. 4 biographietheoretischer Ansatz und Kindheit als Teil des Lebenslaufes
- II. 2 Familie
- II. 2. 1 Begriff
- II. 2. 2 Familie als Sozialisationsinstanz
- II. 2. 3 Familie als Schutz- und Schonraum
- II. 3 Armut
- II. 3. 1 Ressourcenansatz
- Absolute Armut
- Relative Einkommensarmut
- II. 3. 2 Lebenslagenansatz
- II. 3. 3 Lebenslagen von Kindern/Kinderarmut
- II. 3. 1 Ressourcenansatz
- II. 4. Resilienz
- II. 4. 1 Was ist Resilienz?
- II. 4. 2 Forschungsstand
- II. 4. 3 Charakteristika
- II. 4. 4 Konzepte von Resilienz
- Konzept der Bewältigung von Krisen (Oevermann)
- Das Moderatorkonzept/Puffer-Modell (Rutter)
- Konzept der Resilienz von Familien (Walsh)
- Rahmenmodell von Resilienz (Kumpfer)
- II. 4. 5 Kritik an den Konzepten von Resilienz
- II. 4. 6 Schlussfolgerungen
- III. DAS KINDER- UND JUGENDPROJEKT: DIE ARCHE
- III. 1 Das Projekt
- III. 2 Intentionen und Ziele
- III. 3 Visionen
- III. 4 Das Kinder- und Jugendwerk „Die Arche“ e. V. in Hellersdorf
- IV. DIE FELDSTUDIE: DESIGN UND METHODISCHES VORGEHEN
- IV. 1 Qualitative Sozialforschung als Ansatz
- IV. 2 Grounded Theory (Glaser/Strauss)
- IV. 3 Objektive Hermeneutik (Oevermann)
- IV. 4 Dokumentarische Methode (Bohnsack)
- IV. 5 Interview
- IV. 5. 1 biographische Methode
- IV. 5. 2 Das narrativ-biographische Interview
- IV. 5. 3 Interviews mit Kindern
- IV. 6 Fallauswahl
- IV. 7 Datenerhebung
- IV. 7. 1 Vorgehensweise
- IV. 7. 2 Leitfadeninterview
- IV. 7. 3 Memos
- IV. 8 Transkription
- IV. 9 Datenauswertung
- IV. 9. 1 Datenanalyse im Rahmen der Grounded Theory
- IV. 9. 2 Kodierparadigma
- IV. 9. 3 Objektive Hermeneutik
- IV. 9. 4 Analyse narrativer Interviews
- IV. 9. 5 Dokumentarische Textinterpretation
- IV. 10 Fallrekonstruktion/Fallkontrastierung
- V. ERGEBNISSE
- V. 1 Fall 1 Annika
- V. 1. 1 Interviewsituation
- Hintergrund
- Das Interview - Melanie und Christian
- Das Interview - Annika
- V. 1. 2 Biographie der Familie
- Melanie
- Christian
- Elternbeziehung
- Eltern-Kind-Beziehung
- V. 1. 3 Portrait Annika
- Persönliche Merkmale
- Lebensumwelt
- V. 1. 4 Deutungsmuster
- Melanie
- Christian
- Annika
- V. 1. 5 Hypothese zum Fall Annika: Krise als Möglichkeit zur Entwicklung
- V. 1. 1 Interviewsituation
- V. 2 Fall 2 Anna
- V. 2. 1 Interviewsituation
- Hintergrund
- Das Interview - Jens
- Das Interview - Anna
- V. 2. 2 Biographie der Familie
- Jens
- Marion
- Elternbeziehung
- Eltern-Kind-Beziehung
- V. 2. 3 Portrait Anna
- Persönliche Merkmale
- Lebensumwelt
- V. 2. 4 Deutungsmuster
- Jens
- Anna
- V. 2. 5 Hypothese zum Fall Anna: Krise als Gefahr für die Entwicklung
- V. 2. 1 Interviewsituation
- V. 3 Fall 3 Daniel
- V. 3. 1 Interviewsituation
- Hintergrund
- Das Interview - Andre und Kerstin
- Das Interview - Daniel
- V. 3. 2 Biographie der Familie
- Andre
- Kerstin
- Elternbeziehung
- Eltern-Kind-Beziehung
- V. 3. 3 Portrait Daniel
- Persönliche Merkmale
- Lebensumwelt
- V. 3. 4 Deutungsmuster
- Andre und Kerstin
- Daniel
- V. 3. 5 Hypothese zum Fall Daniel: Krisen als Chance
- V. 3. 1 Interviewsituation
- V. 1 Fall 1 Annika
- VI. FALLVERGLEICH UND FALLKONTRASTIERUNG
- VI. 1 Krisen und Wendepunkte
- VI. 2 Potenziale der Kinder an Resilienz
- VI. 3 Typenbildung
- VII. SCHLUSS
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit dem Thema benachteiligter Kinder und ihren Resilienzpotenzialen. Sie untersucht, wie Kinder in schwierigen Lebenslagen mit Herausforderungen umgehen und welche Faktoren ihre Widerstandsfähigkeit und Entwicklung fördern.
- Kindheit und soziale Entwicklung in unterschiedlichen Lebenslagen
- Die Rolle der Familie als Sozialisationsinstanz und Schutzraum
- Armut und ihre Auswirkungen auf Kinder und ihre Resilienz
- Resilienz als Konzept und seine Bedeutung für die Bewältigung von Krisen
- Die Arbeit des Kinder- und Jugendprojekts "Die Arche" und seine Unterstützung für benachteiligte Kinder
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, die das Thema und die Forschungsfrage einführt. Kapitel II stellt den konzeptionellen Rahmen der Arbeit vor, indem es verschiedene theoretische Ansätze zu Kindheit, Familie, Armut und Resilienz beleuchtet. Kapitel III widmet sich dem Kinder- und Jugendprojekt "Die Arche" und erläutert seine Intentionen, Ziele und Visionen. Kapitel IV beschreibt die methodische Vorgehensweise der Feldstudie, die qualitative Sozialforschung mit verschiedenen Methoden wie Grounded Theory, Objektiver Hermeneutik und Dokumentarischer Methode kombiniert. Kapitel V präsentiert die Ergebnisse der Fallstudien, die detaillierte Einblicke in die Lebenswelten und Resilienzstrategien von drei Kindern aus "Die Arche" geben. Kapitel VI vergleicht die Fallstudien und analysiert die Gemeinsamkeiten und Unterschiede in den Krisenerfahrungen und Resilienzpotenzialen der Kinder. Schließlich bietet Kapitel VII eine abschließende Zusammenfassung der Ergebnisse und Diskussion der Erkenntnisse.
Schlüsselwörter
Benachteiligte Kinder, Resilienz, Kindheit, Familie, Armut, Sozialisation, Lebenslagen, "Die Arche", qualitative Sozialforschung, Grounded Theory, Objektive Hermeneutik, Dokumentarische Methode, Fallstudien, Krisen, Wendepunkte, Entwicklungspotenziale.
Häufig gestellte Fragen
Was versteht man unter Resilienz bei Kindern?
Resilienz ist die psychische Widerstandsfähigkeit von Kindern, die es ihnen ermöglicht, trotz schwieriger Lebenslagen wie Armut gesund aufzuwachsen.
Wie wirkt sich Kinderarmut auf die Entwicklung aus?
Armut kann zu Bildungsbenachteiligung, sozialer Ausgrenzung und gesundheitlichen Risiken führen, fordert aber auch spezifische Bewältigungsstrategien heraus.
Was leistet das Projekt „Die Arche“?
Die Arche bietet benachteiligten Kindern Mahlzeiten, Hausaufgabenhilfe und Freizeitangebote, um ihre sozialen Potenziale und ihre Resilienz zu stärken.
Welche Rolle spielt die Familie als Schutzraum?
Eine stabile Eltern-Kind-Beziehung kann als Puffer gegen äußere Krisen wirken und ist ein zentraler Faktor für die Resilienzförderung.
Können Krisen auch Entwicklungschancen sein?
Ja, das Konzept der Resilienz zeigt, dass erfolgreich bewältigte Krisen zur Stärkung der Persönlichkeit und zum Erwerb neuer Kompetenzen führen können.
- II. 1 Kindheit
- Quote paper
- Dipl.-Soz. Jana Schubert (Author), 2008, Benachteiligte Kinder und ihre Resilienzpotenziale, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/117534