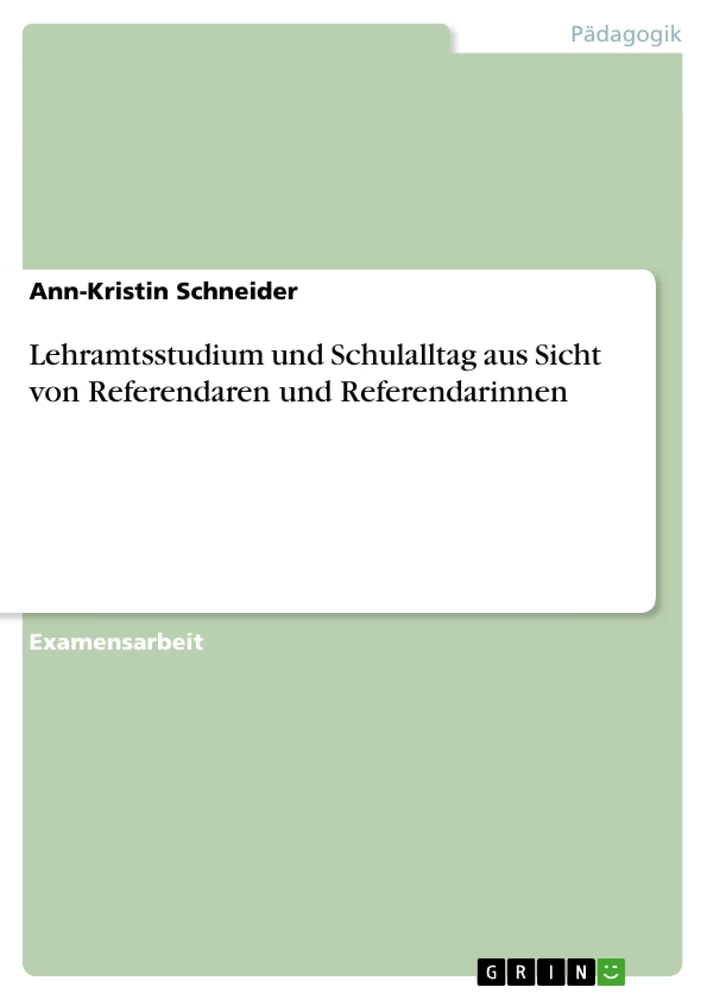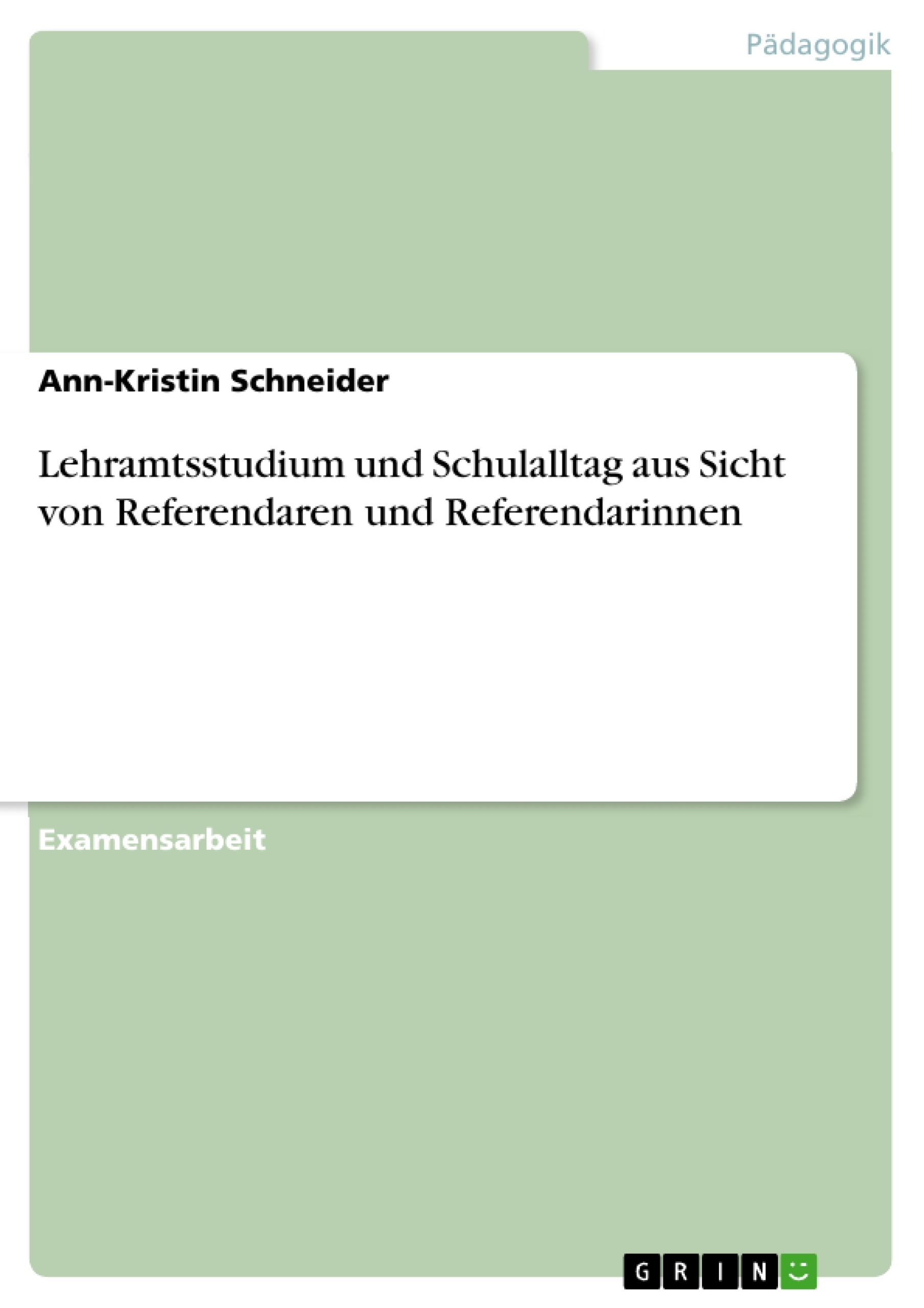„Die Leistungen des deutschen Schulsystems werden aktuell wieder heftig diskutiert. Da ein Schulsystem aber nicht besser sein kann, als die darin Unterrichtenden, stehen im Zuge dieser Diskussion auch die professionelle Kompetenzen der Lehrerschaft wieder auf dem Prüfstand.“ (http://bildungsklick.de 08.03.2008 um 12:16 Uhr).
Während früher Lehrer als Respektspersonen angesehen wurden, die mit einer umfassenden Allgemeinbildung beeindruckten, vor denen die Eltern Hochachtung und die Kinder Respekt hatten, werden heute Lehrer und ihre Arbeit in der Öffentlichkeit zunehmend in Frage gestellt. Vor allem auf Grund der Ergebnisse der verschiedenen PISA-Studien wurden in Massenmedien, in der Politik und auch in der Bevölkerung die Institution Schule sowie die darin tätigen Lehrer öffentlich kritisiert und ihre Arbeit hinterfragt.
Andererseits haben unter anderem Schaarschmidt und Terhart erkannt, dass an den Lehrerberuf heute zunehmend mehr und vielfältigere Anforderungen gestellt werden als früher. Neben den damaligen Hauptaufgaben Wissensvermittlung und Erziehung steht der Lehrer heute durch den schnellen gesellschaftlichen Wandel vor neuen großen Herausforderungen.
„Die Pluralisierung von Lebens- und Familienformen, die Liberalisierung der familiären Erziehungspraktiken und der vermehrte Einfluss von Medien aller Art auf Kinder und Jugendliche zwingen den Lehrer in seinem Schulalltag zu einer ständigen Auseinandersetzung und Reaktion auf diese Phänomene. Das heute geforderte „Allroundtalent“ Lehrer sollte neben dem üblichen fachlichen und didaktischen Wissen auch über Know-how im Krisenmanagement verfügen, um die fehlenden finanziellen Mittel der Schulen durch Kreativität und Zusammenarbeit mit Kollegen und Eltern aufzufangen. Es sollte pädagogisch-psychologische Kompetenzen ebenso mitbringen wie solche für den Umgang mit verhaltensgestörten und lernbehinderten Kindern. Daneben wird von Lehrern erwartet, dass sie sich über die Weiterentwicklung der pädagogischen Forschung informieren, um neue pädagogische Maßnahmen im eigenen Unterricht umsetzen zu können.“ (http://bildungsklick.de 08.03.2008 um 12:37 Uhr).
Daneben kommen zusätzliche Aufgaben in der Schulsozialarbeit, Drogen- und Suchtprävention, der Ausgleich von Erziehungsfehlern im Elternhaus, die Integration von behinderten Kindern in die Regelschule, Migrationsprobleme usw. auf den Lehrer zu.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Relevanz des Themas
- Ziel der Arbeit
- Aufbau der Arbeit
- Theorie
- Was ist Schulalltag?
- Die Lehrerausbildung
- Erste Phase: Das Lehramtsstudium
- Zweite Phase: Vom Student zum Lehrer
- Stand der Forschung
- Methodisches Design
- Planung
- Stichprobe
- Leitfadeninterview
- Leitfaden
- Auswertung
- Durchführung der Studie
- Darstellung der Ergebnisse
- Einzelfalldarstellung
- Interview 1
- Ausgewählte biographische Daten
- Analyse des Interviews
- Fazit des ersten Interviews
- Interview 2
- Ausgewählte biographische Daten
- Analyse des Interviews
- Fazit des zweiten Interviews
- Interview 3
- Ausgewählte biographische Daten
- Analyse des Interviews
- Fazit des dritten Interviews
- Interview 4
- Ausgewählte biographische Daten
- Analyse des Interviews
- Fazit des vierten Interviews
- Interview 5
- Ausgewählte biographische Daten
- Analyse des Interviews
- Fazit des fünften Interviews
- Interview 6
- Ausgewählte biographische Daten
- Analyse des Interviews
- Fazit des sechsten Interviews
- Vergleichende Zusammenfassung
- Wie reagiert die Universität auf die Kritik der Livs?
- Die Komplexität des Schulalltags und die Erwartungen an Referendarinnen und Referendare
- Die Diskrepanz zwischen Theorie und Praxis in der Lehrerausbildung
- Die Rolle der Universität in der Ausbildung von Lehrkräften
- Die Herausforderungen der Integration in den Schulalltag
- Die Bedeutung von Unterstützung und Begleitung während des Referendariats
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese wissenschaftliche Hausarbeit befasst sich mit den Erfahrungen und Herausforderungen, denen Referendarinnen und Referendare im Lehramtsstudium und im Schulalltag gegenüberstehen. Ziel dieser Arbeit ist es, ein tieferes Verständnis für die Sichtweise von Referendarinnen und Referendaren zu entwickeln und die Herausforderungen, die sie während ihrer Ausbildung und im Schulalltag erleben, zu beleuchten.
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung legt die Relevanz des Themas dar und erläutert das Ziel der Arbeit. Sie stellt den Aufbau der Arbeit vor und führt in die Thematik ein. Der zweite Abschnitt widmet sich der Theorie und beleuchtet den Begriff des Schulalltags sowie die Lehrerausbildung in ihren verschiedenen Phasen. Im Anschluss wird der Stand der Forschung zu den Erfahrungen von Referendarinnen und Referendaren präsentiert.
Das methodische Design der Arbeit wird im vierten Kapitel vorgestellt. Hier werden die Planung, die Stichprobe, das Leitfadeninterview und die Auswertungsmethode erläutert. Im fünften Kapitel werden die Ergebnisse der durchgeführten Interviews dargestellt, wobei die Einzelfalldarstellung der Interviews 1 bis 6 im Fokus steht.
Der sechste Abschnitt widmet sich der vergleichenden Zusammenfassung der Ergebnisse. In den folgenden Kapiteln werden die Reaktionen der Universität auf die Kritik der Livs beleuchtet und ein Fazit gezogen.
Schlüsselwörter
Lehrerausbildung, Referendariat, Schulalltag, Lehrerberuf, Theorie und Praxis, Herausforderungen, Erfahrungen, Interviews, Universität, Kritik, Unterstützung, Begleitung.
Häufig gestellte Fragen
Vor welchen Herausforderungen stehen Referendare heute?
Referendare müssen neben der Wissensvermittlung auch Krisenmanagement, pädagogisch-psychologische Kompetenzen und den Umgang mit Diversität (Inklusion, Migration) bewältigen.
Gibt es eine Diskrepanz zwischen Studium und Schulalltag?
Ja, viele Referendare kritisieren die mangelnde Praxisorientierung der universitären Ausbildung und die harte Landung in der komplexen Realität des Schulalltags.
Wie wurde die Sicht der Referendare in dieser Arbeit untersucht?
Die Arbeit nutzt ein methodisches Design mit qualitativen Leitfadeninterviews von sechs Referendaren (Einzelfalldarstellungen).
Welche Rolle spielt die Universität in der Kritik der Referendare?
Die Arbeit untersucht, wie die Universität auf die Kritik der 'Lehrer im Vorbereitungsdienst' (Livs) reagiert und ob Anpassungen in der Ausbildung vorgenommen werden.
Wie hat sich das Bild des Lehrers in der Öffentlichkeit gewandelt?
Früher als unantastbare Respektspersonen angesehen, stehen Lehrer heute durch PISA-Studien und gesellschaftlichen Wandel unter ständiger öffentlicher Beobachtung und Kritik.
Was ist unter dem 'Allroundtalent' Lehrer zu verstehen?
Es beschreibt die Erwartung, dass Lehrer gleichzeitig Erzieher, Psychologen, Sozialarbeiter und Fachspezialisten sein sollen.
- Quote paper
- Ann-Kristin Schneider (Author), 2008, Lehramtsstudium und Schulalltag aus Sicht von Referendaren und Referendarinnen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/117541