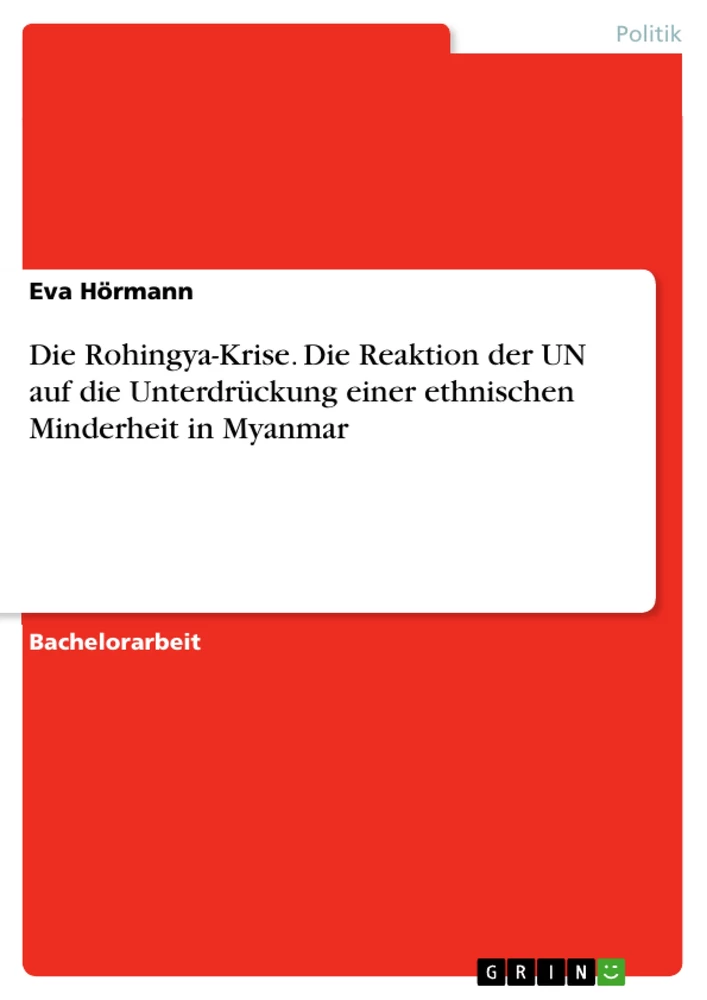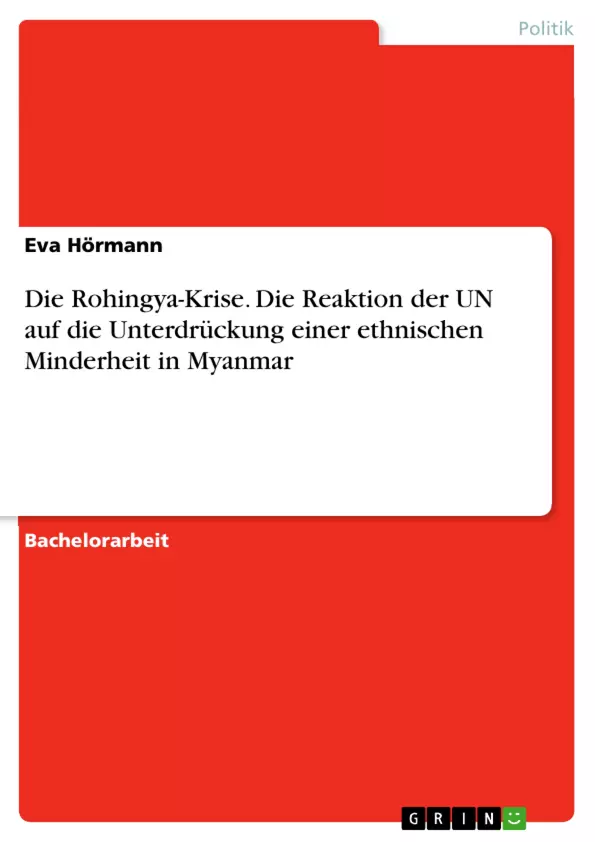In dieser Bachelorarbeit geht es um die Reaktion der UN auf die Menschenrechtsverletzungen an den Rohingya-Muslimen in Myanmar. Dabei wird die Theorie des Transnationalen Konstruktivismus beziehungsweise das Spiralmodell als analytisches Instrument verwendet.
Mithilfe theoretischer Annahmen des Transnationalen Konstruktivismus nach der Forschungsgruppe Menschenrechte um Thomas Risse von 1998 soll die Reaktion der UN hinsichtlich der Rohingya-Krise erklärt werden. Im Rahmen dieser Arbeit werden zunächst die Grundzüge der Theorie dargestellt, wobei zunächst auf die Ausgangsbedingungen zur Internalisierung von Menschenrechtsnormen in einem Staat eingegangen wird. Weiterhin wird die Rolle internationaler Akteure wie der UN in diesem Prozess betrachtet. Danach wird das von der Forschungsgruppe entworfene Spiralmodell der Menschenrechte
untersucht und die Bildung von Hypothesen anhand der Theorie vorgenommen. Diese Hypothesen werden bezüglich der Reaktion der UN auf die Rohingya-Krise seit 2017 getestet. Schließlich werden die Ergebnisse zusammengefasst, wobei untersucht wird, welche Defizite der theoretische Ansatz aufweist.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einführung
- 2. Theoretische Einordnung: Der Transnationale Konstruktivismus
- 2.1. Grundannahmen des Transnationalen Konstruktivismus
- 2.2. Das Spiralmodell der Menschenrechte
- 2.3. Hypothesenformulierung
- 3. Deskription: Der Rohingya-Konflikt
- 3.1. Überblick des Konfliktes
- 3.2. Die Reaktion der UN-Hauptorgane
- 4. Analyse: Die Menschenrechtsverletzungen an den Rohingya
- 4.1. Scheitern des Aufbaus von advocacy coalitions in Myanmar
- 4.2. Das Spiralmodell in Bezug auf die Rohingya-Krise
- 4.3. Überprüfung der Hypothesen
- 5. Resümee
- 6. Kritische Reflexion
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht die Reaktion der Vereinten Nationen (UN) auf die Menschenrechtsverletzungen an den Rohingya-Muslimen in Myanmar seit 2017. Dabei wird die Frage beleuchtet, wie die verhaltene Reaktion der UN im Kontext des Transnationalen Konstruktivismus erklärt werden kann. Die Arbeit fokussiert sich auf die Hauptorgane der UN, insbesondere die Generalversammlung, den Sicherheitsrat, den Generalsekretär und den Internationalen Gerichtshof.
- Analyse der Reaktion der UN auf die Rohingya-Krise
- Anwendung des Transnationalen Konstruktivismus zur Erklärung der UN-Reaktion
- Untersuchung der Bedeutung von Menschenrechtsnormen und deren Internalisierung in Myanmar
- Bewertung des Spiralmodells der Menschenrechte im Kontext der Rohingya-Krise
- Identifizierung von Defiziten im theoretischen Ansatz
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einführung in die Rohingya-Krise, die die Situation der Rohingya-Muslime in Myanmar und die Rolle der UN im Schutz der Menschenrechte beschreibt. Das zweite Kapitel stellt den Transnationalen Konstruktivismus als theoretisches Framework vor, das die Internalisierung von Menschenrechtsnormen in einem Staat untersucht. Das dritte Kapitel widmet sich der Beschreibung des Rohingya-Konflikts und der Reaktion der UN-Hauptorgane. Im vierten Kapitel werden die Menschenrechtsverletzungen an den Rohingya analysiert und die Anwendung des Spiralmodells der Menschenrechte im Kontext der Krise untersucht. Die Arbeit endet mit einem Resümee und einer kritischen Reflexion.
Schlüsselwörter
Die Arbeit konzentriert sich auf die Themen Menschenrechte, Transnationaler Konstruktivismus, Rohingya-Krise, UN-Reaktion, Spiralmodell der Menschenrechte, Myanmar, Advocacy Coalitions, Staatsbürgerschaft, ethnische Minderheiten, Völkermord, Menschenrechtsverletzungen, Friedensmission, Internationaler Gerichtshof.
Häufig gestellte Fragen
Wie reagierte die UN auf die Rohingya-Krise?
Die Arbeit untersucht die Reaktionen der Hauptorgane (Sicherheitsrat, Generalversammlung, IGH) auf die Menschenrechtsverletzungen in Myanmar seit 2017.
Was ist das Spiralmodell der Menschenrechte?
Ein theoretisches Modell des Transnationalen Konstruktivismus, das erklärt, wie internationale Normen in nationales Recht und Verhalten internalisiert werden.
Warum war die Reaktion der UN eher verhalten?
Die Arbeit analysiert dies anhand des Scheiterns von „Advocacy Coalitions“ und Defiziten bei der Internalisierung von Menschenrechtsnormen in Myanmar.
Welche Rolle spielt der Transnationale Konstruktivismus?
Er dient als analytisches Instrument, um das Verhalten staatlicher und internationaler Akteure im Bereich der Menschenrechte zu erklären.
Welche UN-Organe werden in der Analyse betrachtet?
Die Untersuchung umfasst die Generalversammlung, den Sicherheitsrat, den Generalsekretär und den Internationalen Gerichtshof.
- Citation du texte
- Eva Hörmann (Auteur), 2021, Die Rohingya-Krise. Die Reaktion der UN auf die Unterdrückung einer ethnischen Minderheit in Myanmar, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1175544