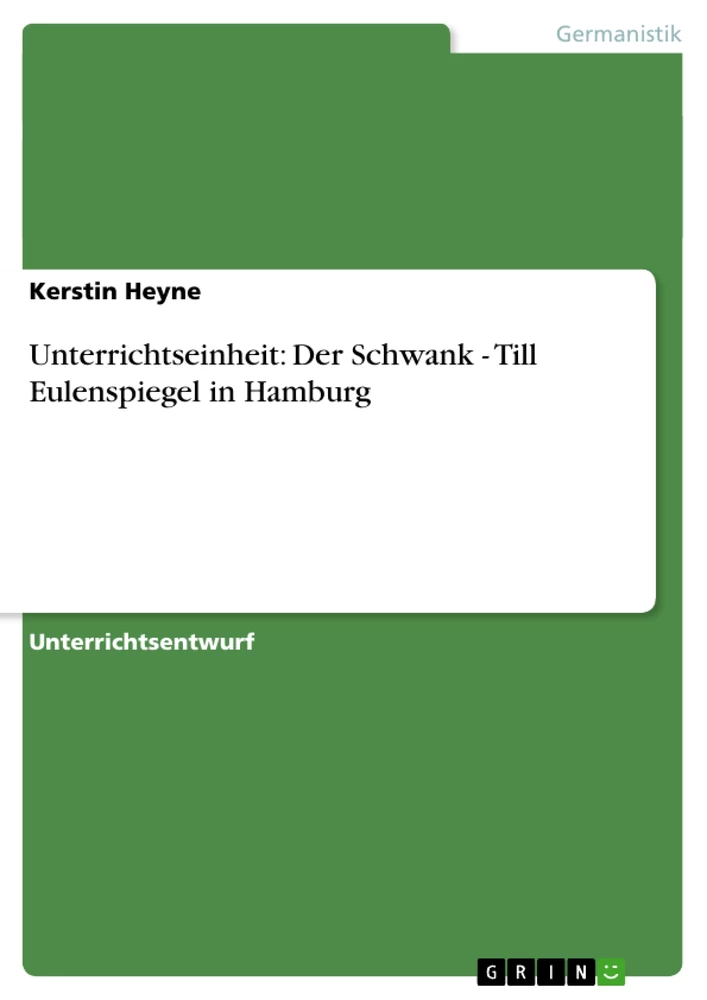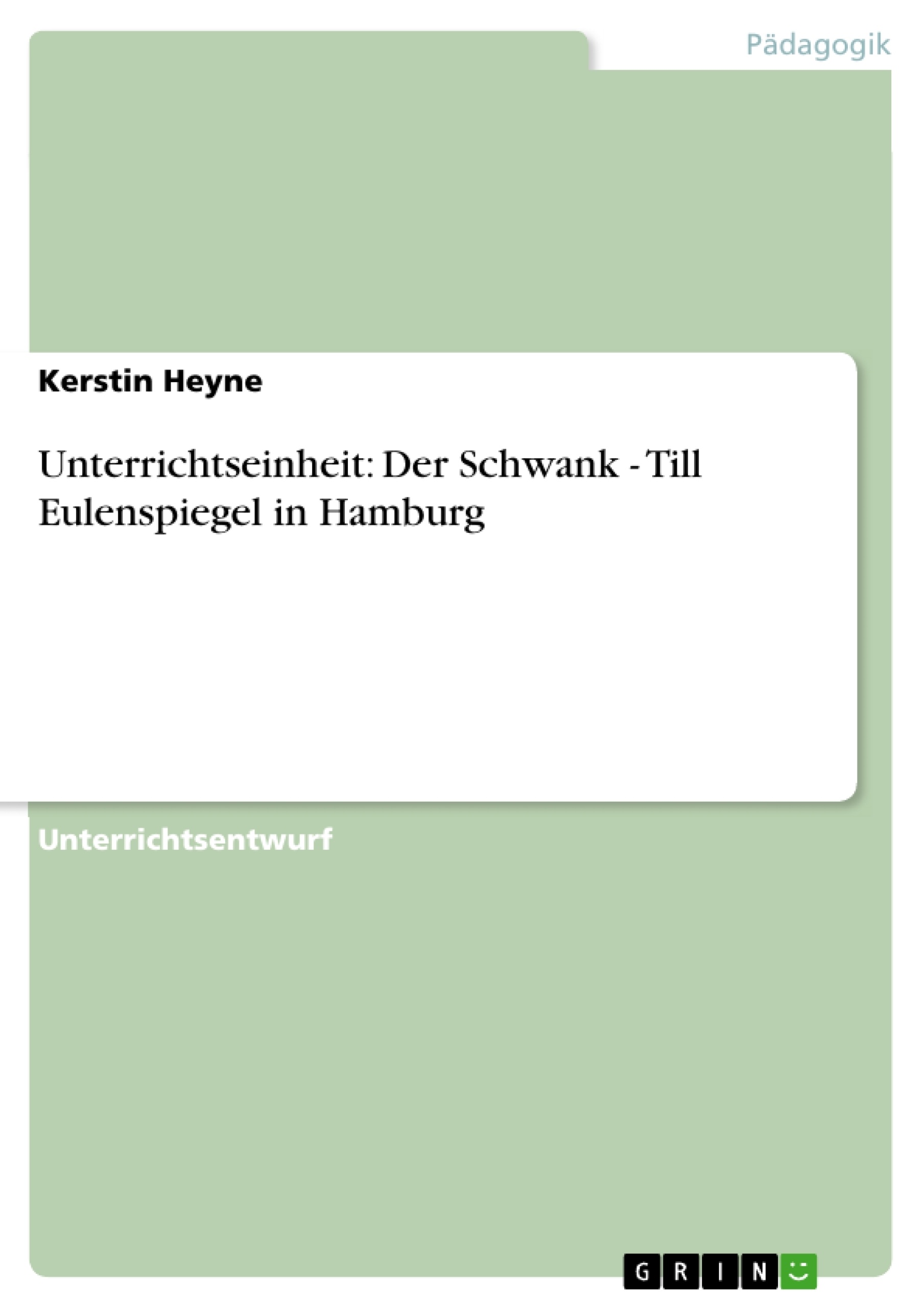Der Schwank (von "schwingende Bewegung"; vgl. Streich) erscheint erstmals im 13. Jahrhundert in der deutschen Literatur nach dem Vorbild der französischen Fabliaux (älteste Schwanksammlung "Der Stricker", gestorben ca. 1250). Eine weitere Schwankfigur, bekannt in der Weltliteratur, ist Nasreddin Hodscha, der 1208 in einem türkischen Dorf geboren wurde, von dem es etwa 300 Geschichten gibt. Seine größte Verbreitung erfuhr er allerdings erst im 16. (Hans Sachs) und 17. Jahrhundert. Bis heute sind die Schildbürgerstreiche, die Eulenspiegelgeschichten und - aus späterer Zeit - die Lügenerzählungen des Barons von Münchhausen (Gottfried August Bürger 1796) beliebt. Auch der "Rheinische Hausfreund" von Johann Peter Hebel enthielt Schwänke. Das Grundmuster besteht darin, dass Personen mit unterschiedlicher Rolle (Herr / Knecht, Bauer / Städter, Laie / Kleriker) zusammentreffen und eine dieser Figuren mit List den Sieg über die andere davonträgt.
Der Schwank als epische Form ist also eine kurze Geschichte (in Vers oder Prosa) mit witzig - humorvollem Beigeschmack und meist von einer derben sowie groben Sprache geprägt. Sein bevorzugter Inhalt ist menschliche Dummheit, Eitelkeit, Prahlsucht, Gerissenheit, der betrogene Bürger. Typisch sind seine gehäuften Eigenschaften sowie Ereignisse und sein Ziel ist die Unterhaltung.
Schließlich unterscheidet man noch das Schwankmärchen, in dem das eigentlich Schwankhafte das Märchenhaft - Wunderbare in den Hintergrund treten lässt.
Als Einlage in Texten anderer literarischer Gattung finden sich auch heute noch Schwänke, wie zum Beispiel in den "Flüchtlingsgesprächen" von Bertolt Brecht (1961).
Schwänke haben in der Geschichte der Literatur und des Schullesebuches bis heute eine ungebrochene Tradition. Diese Tatsache kann u.a. damit begründet werden, dass Schwänke menschliche Eigenarten, Schwächen, Fehler usw. im Lichte des Komischen, des Humors, der Heiterkeit, teilweise der Schadenfreude, erscheinen lassen, sodass sich jeder /-e Leser /-in gleich welchen Alters und Standes - erstaunt, verdutzt, nachdenklich und auch selbstkritisch - wiederzuentdecken vermag. Somit übt die Lektüre von Schwänken, deren Motive zwischen den Kulturen wandern und die nahe verwandt sind mit Märchen, Sagen, Legenden, Fabeln usw., eine erheiternde und befreiende Wirkung aus, die einerseits zum Lachen über sich selbst und auch zur Selbstkritik und andererseits zum Lachen über andere und zur Zeit- und Gesellschaftskritik anregen kann.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Sachanalyse
- 1.1 Der Schwank als Gattung
- 1.2 Till Eulenspiegel
- 2. Didaktische Analyse
- 2.1 Lehrplanbezug / Bildungsgehalt
- 2.2 Begründung der Schwerpunktsetzung
- 3. Methodische Analyse/Lernziele
- 4. Unterrichtsverlaufsplan
- 5. Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Der Lehrversuch „Der Schwank: Till Eulenspiegel in Hamburg“ zielt darauf ab, Schülern der sechsten Klasse die Gattung des Schwanks anhand eines bekannten Beispiels näherzubringen. Der Fokus liegt dabei auf der Analyse von literarischen Merkmalen, der Erarbeitung des Humors und der Einordnung in den historischen Kontext.
- Die Merkmale des Schwanks als literarische Gattung
- Die Figur des Till Eulenspiegel als Vertreter des Schwanks
- Die Bedeutung des Humors und der Satire im Schwank
- Der historische Kontext des Schwanks
- Die Relevanz des Schwanks für die heutige Zeit
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel befasst sich mit der Sachanalyse des Schwanks. Es werden die Ursprünge, die Entwicklung und die charakteristischen Merkmale der Gattung erläutert. Besonderes Augenmerk liegt dabei auf der Figur des Till Eulenspiegel, seiner Rolle als Vertreter des Schwanks und seinen typischen Streichen. Das zweite Kapitel widmet sich der didaktischen Analyse. Hier werden die Lehrplanbezüge und der Bildungsgehalt des Themas erörtert. Es wird dargelegt, wie der Schwank Schülern helfen kann, ihre Lesekompetenz zu verbessern, die Freude am Lesen zu entwickeln und wichtige Werte zu reflektieren.
Schlüsselwörter
Schwank, Till Eulenspiegel, Volksdichtung, Humor, Satire, Lehrplan, Bildungsgehalt, Lesekompetenz, Werteerziehung, historischer Kontext, literarische Gattung, Sprachkomik, Situationskomik, Streiche.
Häufig gestellte Fragen
Was zeichnet die literarische Gattung des Schwanks aus?
Ein Schwank ist eine kurze, humorvolle Erzählung in Vers oder Prosa, die oft menschliche Schwächen wie Dummheit oder Eitelkeit durch List und Schadenfreude bloßstellt.
Wer war Till Eulenspiegel?
Eulenspiegel ist eine weltbekannte Schwankfigur, die durch ihre Streiche und das wörtliche Nehmen von Redewendungen die Mitmenschen und die Gesellschaft kritisiert.
Warum sind Schwänke auch heute noch im Schulunterricht relevant?
Sie fördern die Lesekompetenz, vermitteln Humor und regen zur Selbstkritik sowie zur Reflexion über gesellschaftliche Werte an.
Was ist der Unterschied zwischen Sprachkomik und Situationskomik?
Sprachkomik entsteht durch Wortspiele oder Missverständnisse (wie bei Eulenspiegel), während Situationskomik aus komischen Begebenheiten und dem Zusammentreffen gegensätzlicher Rollen resultiert.
Welche anderen bekannten Schwankfiguren gibt es?
Neben Eulenspiegel sind Nasreddin Hodscha, die Schildbürger und der Baron von Münchhausen bekannte Vertreter dieser Gattung.
- Citar trabajo
- Kerstin Heyne (Autor), 2002, Unterrichtseinheit: Der Schwank - Till Eulenspiegel in Hamburg, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/117572