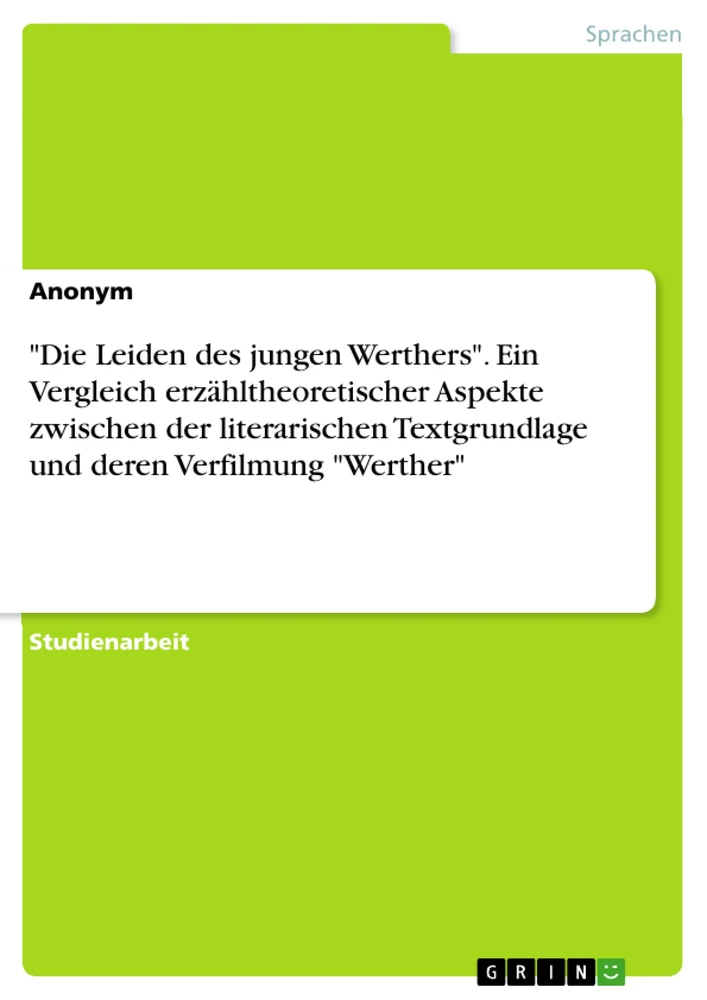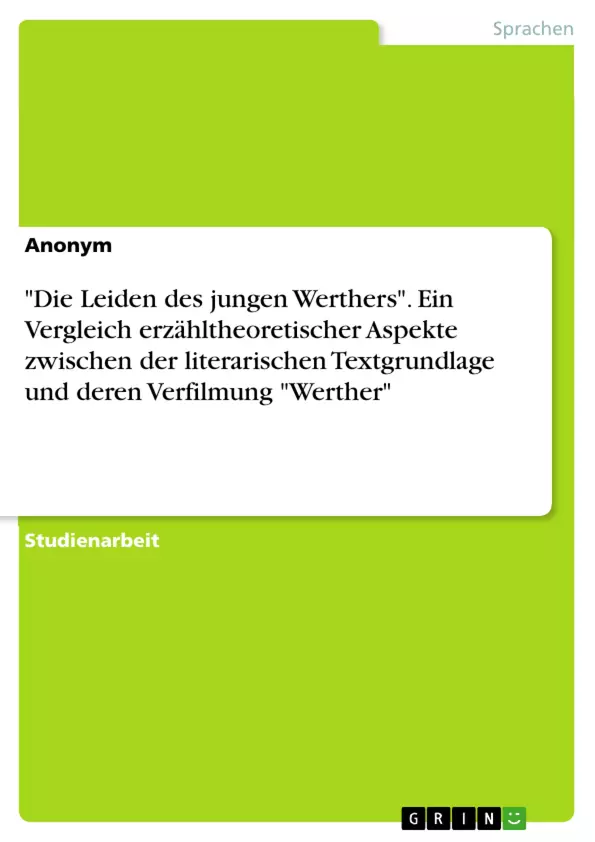Die folgende Ausarbeitung widmet sich einem Vergleich zwischen Literatur und ihrer Verfilmung. Nach Staiger (2018) kann hierzu von einem erweiterten medienübergreifenden Textbegriff gesprochen werden, welcher Literaturverfilmungen als audiovisuelle Texte bezeichnet. Demnach stehen audiovisuelle und literarische Texte in einer intermedialen Beziehung zueinander und können als Text klassifiziert werden. Hierzu wird zunächst der Film als Medium von Literatur erläutert und im Hinblick auf deren intermedialen Relation dargestellt. In einem nächsten Schritt wird der Transformationsprozess vom Text zum Bild der beiden Medien beschrieben und deren Differenzen hinsichtlich Rezeption bzw. Interpretation dargestellt. Im weiteren Verlauf der Arbeit werden dann Chancen und Probleme, die aus Literaturverfilmungen resultieren können, diskutiert, um diese in einem anschließenden Analyseteil auf die Literaturverfilmung von Goethes „Die Leiden des jungen Werthers“ zu beziehen. Hierfür werden einige Aspekte der Erzähltheorie herausgearbeitet, um diese im Anschluss anhand des Briefromans und dessen Verfilmung „Werther“ zu identifizieren und miteinander zu vergleichen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Filme als Medium von Literatur
- 2.1 Literaturverfilmung - ein intermediales Phänomen
- 2.2 Der Prozess vom Text zum Film
- 3. Chancen und Probleme von Literaturverfilmung
- 3.1 Technik des Erzählens
- 3.2 Erzähldauer
- 3.3 Erzählordnung
- 4. Chancen und Probleme von Literaturverfilmungen anhand von „Die Leiden des jungen Werthers“
- 4.1 Der Briefroman und seine Verfilmungen
- 4.2 Chancen und Probleme der Literaturverfilmung „Werther“
- 5. Zusammenfassung und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Chancen und Herausforderungen der Literaturverfilmung anhand eines Vergleichs zwischen Goethes „Die Leiden des jungen Werthers“ und dessen Verfilmungen. Im Fokus steht die Analyse erzähltheoretischer Aspekte und die Frage, inwieweit die filmische Adaption dem literarischen Original gerecht wird.
- Intermedialität von Literatur und Film
- Der Transformationsprozess vom literarischen Text zum Film
- Chancen und Probleme der Literaturverfilmung
- Erzähltheoretische Aspekte im Vergleich zwischen Roman und Film
- Analyse der Adaption von „Die Leiden des jungen Werthers“
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema ein und stellt die Relevanz der Beziehung zwischen Literatur und Film dar. Sie hebt die intermediale Natur von Literaturverfilmungen hervor und skizziert die Forschungsfrage: Welche Chancen und Probleme ergeben sich aus dem Vergleich einer Literaturverfilmung und ihrer textuellen Grundlage auf Basis erzähltheoretischer Aspekte? Die Einleitung benennt den Fokus auf die Untersuchung von Goethes „Die Leiden des jungen Werthers“ und dessen Verfilmungen.
2. Filme als Medium von Literatur: Dieses Kapitel befasst sich mit der Literaturverfilmung als intermediales Phänomen. Es differenziert zwischen Medienbezugnahme, Medienkombination und Medienwechsel und ordnet die Literaturverfilmung der Kategorie Medienwechsel zu. Es wird der Transformationsprozess vom literarischen Text zur filmischen Partitur analysiert, wobei die Unterschiede in den Codes (sprachlicher vs. kinematographischer Code) und die daraus resultierenden Unterschiede in Lektüre und Rezeption beleuchtet werden.
3. Chancen und Probleme von Literaturverfilmung: Dieses Kapitel behandelt die allgemeinen Chancen und Herausforderungen bei der Adaption literarischer Werke in filmische Form. Es wird auf verschiedene Aspekte der Erzähltheorie eingegangen, wie z.B. die Technik des Erzählens, die Erzähldauer und die Erzählordnung, um die spezifischen Schwierigkeiten und Möglichkeiten bei der Transformation aufzuzeigen. Der Fokus liegt auf den Herausforderungen, die sich aus der unterschiedlichen Natur der beiden Medien ergeben und wie diese gemeistert werden können.
4. Chancen und Probleme von Literaturverfilmungen anhand von „Die Leiden des jungen Werthers“: Dieses Kapitel konzentriert sich auf die spezifischen Herausforderungen und Möglichkeiten der Adaption von Goethes „Die Leiden des jungen Werthers“. Es analysiert den Briefroman als literarische Form und diskutiert, welche erzähltheoretischen Aspekte bei der Verfilmung besonders relevant sind und wie diese in der filmischen Adaption umgesetzt (oder nicht umgesetzt) wurden. Der Vergleich zwischen dem literarischen Original und der filmischen Version steht im Zentrum der Betrachtung.
Schlüsselwörter
Literaturverfilmung, Intermedialität, „Die Leiden des jungen Werthers“, Erzähltheorie, Briefroman, Filmsprache, Adaption, Medienwechsel, Texttransformation, Rezeption.
Häufig gestellte Fragen zu: Analyse der Literaturverfilmung von Goethes „Die Leiden des jungen Werthers“
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert die Chancen und Herausforderungen der Literaturverfilmung, insbesondere anhand von Goethes „Die Leiden des jungen Werthers“ und seinen verschiedenen Verfilmungen. Im Mittelpunkt steht ein Vergleich zwischen dem literarischen Original und seinen filmischen Adaptionen unter Berücksichtigung erzähltheoretischer Aspekte.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt Themen wie Intermedialität von Literatur und Film, den Transformationsprozess vom literarischen Text zum Film, Chancen und Probleme der Literaturverfilmung, erzähltheoretische Aspekte im Vergleich zwischen Roman und Film sowie eine detaillierte Analyse der Adaption von „Die Leiden des jungen Werthers“.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel: Eine Einleitung, ein Kapitel über Filme als Medium der Literatur, ein Kapitel über die Chancen und Probleme der Literaturverfilmung im Allgemeinen, ein Kapitel zur spezifischen Analyse von „Die Leiden des jungen Werthers“ und seinen Verfilmungen, sowie eine Zusammenfassung und einen Ausblick.
Was wird im Kapitel über „Filme als Medium von Literatur“ behandelt?
Dieses Kapitel definiert Literaturverfilmung als intermediales Phänomen, differenziert zwischen Medienbezugnahme, Medienkombination und Medienwechsel und analysiert den Transformationsprozess vom literarischen Text zur filmischen Umsetzung, inklusive der Unterschiede in den Codes (sprachlicher vs. kinematographischer Code) und deren Auswirkungen auf Lektüre und Rezeption.
Welche Chancen und Probleme der Literaturverfilmung werden diskutiert?
Das Kapitel zu den Chancen und Problemen der Literaturverfilmung beleuchtet aspekte der Erzähltheorie wie Erzähltechnik, Erzähldauer und Erzählordnung, um die spezifischen Schwierigkeiten und Möglichkeiten bei der Transformation aufzuzeigen. Es konzentriert sich auf die Herausforderungen, die sich aus der unterschiedlichen Natur der beiden Medien ergeben.
Wie wird „Die Leiden des jungen Werthers“ in der Arbeit behandelt?
Das Kapitel zu „Die Leiden des jungen Werthers“ analysiert den Briefroman als literarische Form und untersucht, welche erzähltheoretischen Aspekte bei der Verfilmung besonders relevant sind und wie diese in den filmischen Adaptionen umgesetzt wurden. Ein direkter Vergleich zwischen dem literarischen Original und den Filmen steht im Zentrum.
Welche Schlüsselwörter sind relevant?
Wichtige Schlüsselwörter sind: Literaturverfilmung, Intermedialität, „Die Leiden des jungen Werthers“, Erzähltheorie, Briefroman, Filmsprache, Adaption, Medienwechsel, Texttransformation, Rezeption.
Was ist die zentrale Forschungsfrage?
Die zentrale Forschungsfrage lautet: Welche Chancen und Probleme ergeben sich aus dem Vergleich einer Literaturverfilmung und ihrer textuellen Grundlage auf Basis erzähltheoretischer Aspekte?
Für wen ist diese Arbeit relevant?
Diese Arbeit ist relevant für Studierende der Literaturwissenschaft, Filmwissenschaft und Medienwissenschaft, die sich mit dem Thema Literaturverfilmung und intermedialen Prozessen auseinandersetzen. Sie eignet sich auch für alle, die sich für die Adaption literarischer Werke in den Film interessieren.
- Citar trabajo
- Anonym (Autor), 2021, "Die Leiden des jungen Werthers". Ein Vergleich erzähltheoretischer Aspekte zwischen der literarischen Textgrundlage und deren Verfilmung "Werther", Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1175749