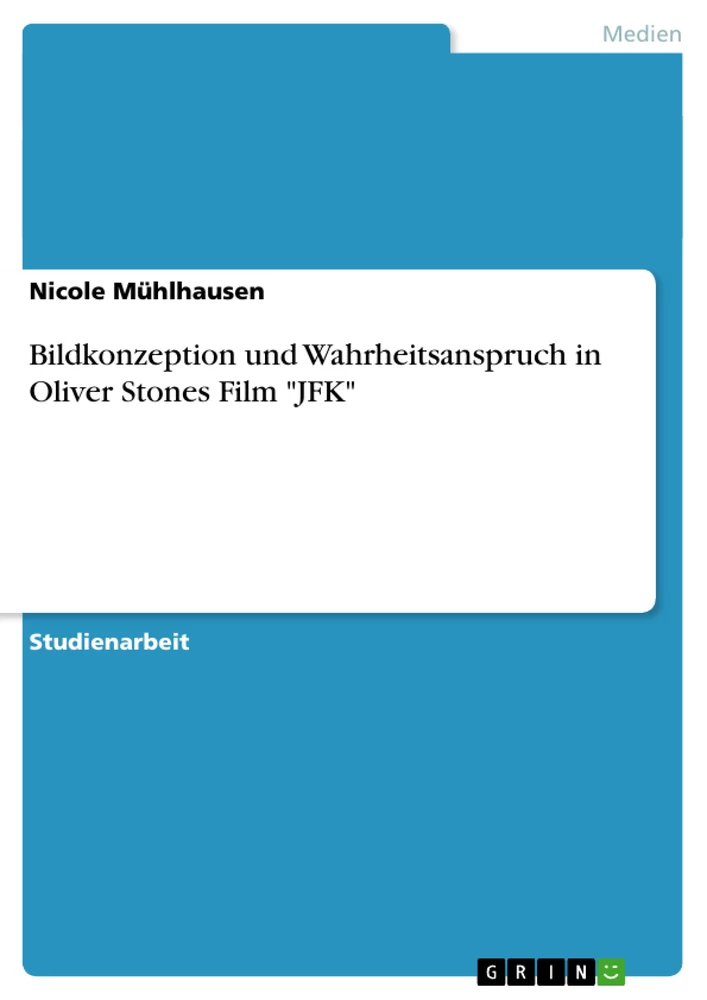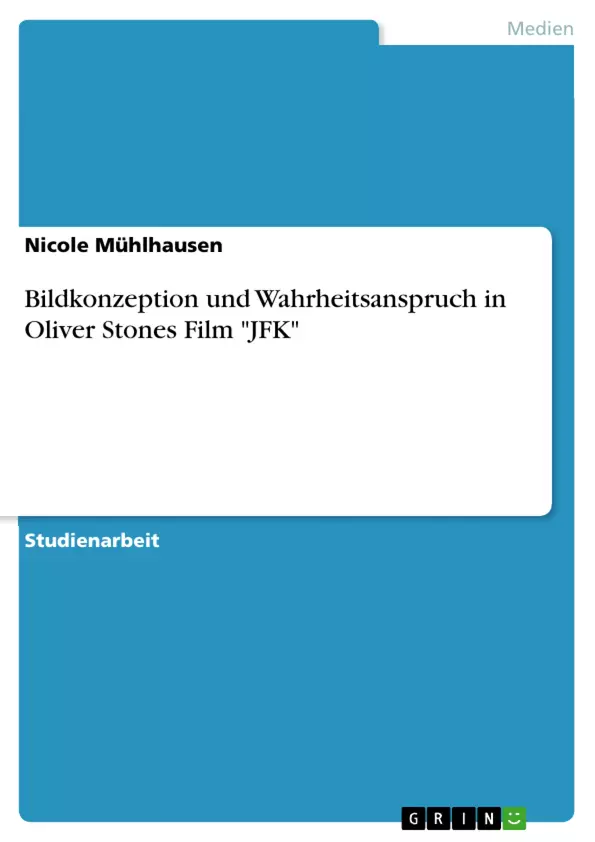Die Objektivität der Photographie verleiht ihr eine Überzeugungsmacht,
die allen anderen Bildwerken fehlt.[...] Das ästhetische Wirkungsvermögen
der Photografie liegt in der Enthüllung des Wirklichen.
1
Wenn es keine zuverlässigen Wege zur Wahrheit der Vergangenheit
gibt, wenn Fotografien und Filme keine Spiegel mit Gedächtnissen,
sondern eher, wie Baudrillard meint, Spiegelkabinette sind,
dann läge unsere beste Antwort auf diese Krise der Repräsentation
darin, [...]: [s]o viele Seiten dieser Spiegel wie möglich in Anschlag
zu bringen, um die Verführungskraft von Lügen zu enthüllen.2
Das hier von Bazin postulierte Vertrauen in die Fähigkeit der Kamera, objektive
Wahrheiten von Menschen, Objekten und Ereignissen sichtbar zu
machen, begründet er mit dem strengen Determinismus des fotografischen
Verfahrens. Mit der Entwicklung der Fotografie in der Mitte des 19.
Jahrhunderts entsteht ein Bild von der äußeren Wirklichkeit zum ersten
Mal automatisch, befreit von den subjektiven „Verfälschungen“ durch den
darstellenden Künstler. Diese Wirkungsmächtigkeit schrieb Bazin jedoch
nicht nur der Fotografie, sondern gleichermaßen dem Film zu, da diesem
Medium ebenso ein determiniertes, fotografisches Verfahren zugrunde
liegt. Darüber hinaus vermag es der Film, die Dinge in der Zeit und ihrer
damit verbundenen Veränderung zu zeigen, während das Foto nur die
Fähigkeit hat, das Darstellungsobjekt in einem bestimmten Augenblick vor
seinem zeitlichen Verfall zu konservieren.
Doch dieses Vertrauen in die Objektivität und die wahrheitsenthüllende
Kraft der Fotografie und der Filmbilder ist in den vergangenen dreißig
Jahren stark erschüttert worden. Der scheinbar unstillbare Hunger der
Menschen nach Bildern hat zu einer massenhaften Verbreitung von Bildern
und zu einer fortlaufenden Innovation der Bildmedien geführt. Es
kann nicht mehr geleugnet werden: Wir leben in einer von Bildern dominierten Welt. Insbesondere die Feuilletons reagieren mit zunehmen-der
Skepsis und Missbilligung auf diese übermächtige Bildpräsenz, die von
ihnen als apokalyptische Bilderflut oder sogar als Bilderhölle tituliert wird.
In den wissenschaftlichen Diskursen findet vornehmlich eine Auseinandersetzung
mit den elektronischen Fernsehbildern und den digitalen Bildern
statt. Ihre äußerste Zuspitzung erreichte diese wissenschaftliche
Bilddebatte durch die populär gewordene „Simulationstheorie“ von Jean
Baudrillard.
[...]
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Analyse der Bildkonzeption von „,JFK“
- Inhalt und Struktur des Films
- Die Indexikalität der Bilder
- Die Ikonizität der Bilder
- Die Montagetechnik
- Analyse des Wahrheitsanspruchs und der Wirkungsintention von \"JFK“
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit untersucht die Bildkonzeption und den Wahrheitsanspruch von Oliver Stones Film „JFK“. Sie analysiert, wie Stones Film die Geschichte des Attentats auf John F. Kennedy erzählt und welche Bildmittel er dabei einsetzt. Darüber hinaus wird der Frage nachgegangen, welche Wirkung Stone mit seinem Film erzielen möchte und welche Rezeption der Film in der Öffentlichkeit erfahren hat.
- Die Rolle von Bildern in der Konstruktion von Geschichte und Wahrheit
- Die Beziehung zwischen Film und Realität
- Die Frage nach der Objektivität und Manipulierbarkeit von Bildern
- Die Bedeutung von Montage und Narration im Film
- Die Rezeption des Films in der Öffentlichkeit und die Debatte um seine Wahrheitsansprüche
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung beschäftigt sich mit der Frage nach der Objektivität der Fotografie und dem Vertrauen in die Fähigkeit der Kamera, die Wahrheit abzubilden. Sie zeigt, wie dieses Vertrauen in den letzten Jahrzehnten durch die Verbreitung von Bildern und die Manipulierbarkeit von Bildmedien erschüttert worden ist.
Das zweite Kapitel analysiert die Bildkonzeption von „JFK“. Es untersucht die Inhalt und Struktur des Films, die Indexikalität und Ikonizität der Bilder sowie die Montagetechnik, die Stone einsetzt.
Das dritte Kapitel widmet sich der Analyse des Wahrheitsanspruchs von „JFK“ und der Wirkungsintention des Films. Es untersucht, welche Schlussfolgerungen Stone aus seinem Film zieht und welche Rezeption der Film in der Öffentlichkeit erfahren hat.
Schlüsselwörter
Bildkonzeption, Wahrheitsanspruch, Film, Geschichte, JFK, Oliver Stone, Montage, Indexikalität, Ikonizität, Simulation, Postmoderne, Skeptizismus, Rezeption.
Häufig gestellte Fragen
Welche zentralen Thesen vertritt Oliver Stone in seinem Film „JFK“?
Stone nutzt den Film, um die offizielle Version des Attentats auf John F. Kennedy infrage zu stellen. Er setzt dabei auf eine komplexe Bildkonzeption, um die Verführungskraft von Lügen zu enthüllen und alternative Wahrheiten zu diskutieren.
Was bedeutet die „Indexikalität der Bilder“ im Kontext des Films?
Indexikalität bezieht sich auf die physikalische Spur der Realität im Bild (wie bei einer Fotografie). Stone vermischt dokumentarisches Material mit inszenierten Szenen, um die Grenze zwischen historischer Tatsache und Fiktion zu verwischen.
Wie setzt Oliver Stone die Montagetechnik ein?
Die Montage in „JFK“ ist extrem schnell und assoziativ. Durch das Zusammenspielen verschiedener Bildebenen und Zeitformen erzeugt Stone einen suggestiven Wahrheitsanspruch, der den Zuschauer emotional und intellektuell fordert.
Was besagt Jean Baudrillards Simulationstheorie in Bezug auf Bilder?
Baudrillard argumentiert, dass Bilder in der Postmoderne nicht mehr die Realität spiegeln, sondern eine eigene Realität (Simulakrum) erschaffen. Dies führt zu einer Krise der Repräsentation, in der das Original hinter der Kopie verschwindet.
Warum ist das Vertrauen in die Objektivität der Fotografie erschüttert?
Durch die massenhafte Verbreitung und die technologische Entwicklung (Digitalisierung) ist die Manipulierbarkeit von Bildern offensichtlich geworden. Bilder werden heute oft skeptisch als „Bilderflut“ oder Konstruktion wahrgenommen.
- Citation du texte
- Nicole Mühlhausen (Auteur), 2005, Bildkonzeption und Wahrheitsanspruch in Oliver Stones Film "JFK", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/117593