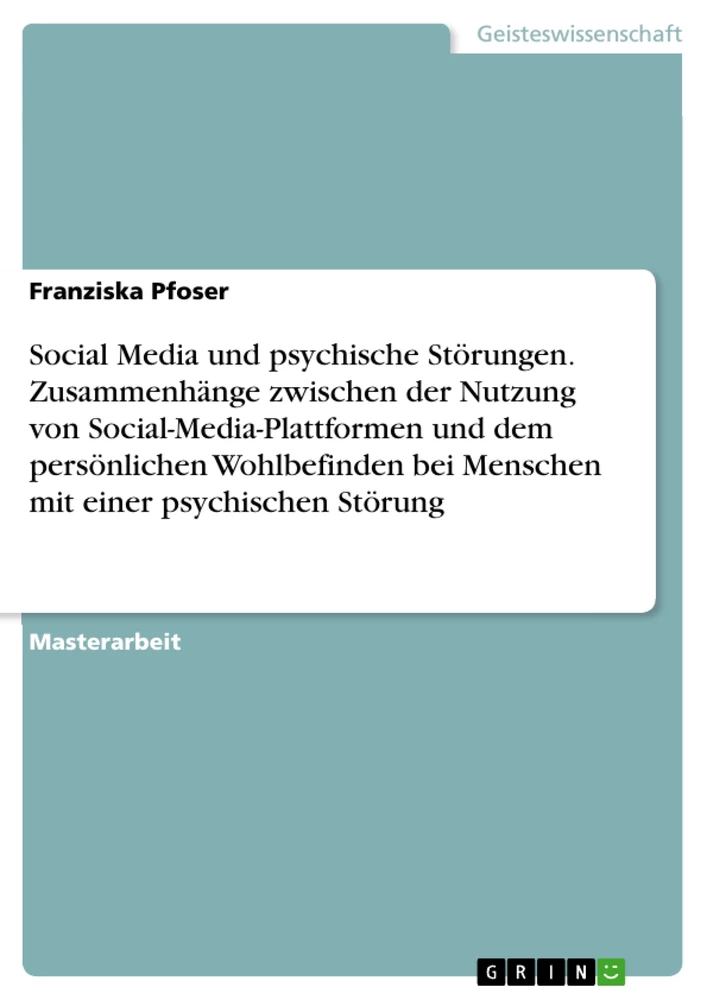Das Hauptaugenmerk der vorliegenden Abschlussarbeit liegt auf dem Themengebiet des Wohlbefindens in Zusammenhang mit der Nutzung von Social-Media-Plattformen. Dabei werden speziell Menschen mit einer psychischen Störung betrachtet. Es gibt bereits Studien, die den Zusammenhang zwischen dem Wohlbefinden bzw. der psychischen Gesundheit und der Nutzung von sozialen Netzwerken untersuchen. Bisher unerforscht ist jedoch der Sachverhalt bei Menschen, die bereits an einer psychischen Störung leiden. Mit Hilfe dieser Arbeit soll ein erster Schritt gegangen werden, um die Forschungslücke zu schließen.
Zur Erreichung dieses Ziels wurde eine empirische Untersuchung durchgeführt, welche die Zusammenhänge zwischen dem persönlichen Wohlbefinden und der Nutzung von Social-Media-Plattformen bei Menschen mit einer psychischen Störung erforscht. Die Untersuchungsobjekte der durchgeführten empirischen Untersuchung sind zum einen die sozialen Netzwerke Facebook, Instagram und What’s App und zum anderen die Nutzer, die an einer Depression, einer Angststörung oder einer posttraumatischen Belastungsstörung leiden. Mittels einer quantitativen Online-Befragung wurden 972 Betroffene zu ihrem Social-Media-Verhalten sowie ihrem Wohlbefinden befragt.
Inhaltsverzeichnis
- Abstrakt
- Schlüsselwörter
- Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 1.1 Problemstellung
- 1.2 Zielsetzung der Arbeit
- 1.3 Aufbau der Arbeit
- 2 Theoretische Grundlagen
- 2.1 Was ist Wohlbefinden?
- 2.1.1 Aktuelles vs. habituelles Wohlbefinden
- 2.1.2 Hedonisches vs. eudaimonisches Wohlbefinden
- 2.1.3 Subjektives Wohlbefinden
- 2.2 Psychische Störungen
- 2.2.1 Definition psychischer Störungen
- 2.2.2 Entstehung und Entwicklung von psychischen Störungen
- 2.2.3 Spezifische Störungsbilder
- 2.2.3.1 Depression
- 2.2.3.2 Posttraumatische Belastungsstörung
- 2.2.3.3 Angststörung
- 2.2.4 Therapie- und Behandlungsmöglichkeiten psychischer Störungen
- 2.3 Social Media
- 2.3.1 Begriffsbestimmung
- 2.3.2 Instagram
- 2.3.3 Facebook
- 2.3.4 What’s App
- 2.4 Social Media und psychische Störungen
- 2.4.1 Betroffene in sozialen Netzwerken
- 2.4.2 Aktuelle Diskussionen und Studien
- 2.5 Ableitung der untersuchungsrelevanten Forschungsfragen
- 2.1 Was ist Wohlbefinden?
- 3 Methode
- 3.1 Untersuchungsobjekt: Social-Media-Nutzer mit psychischer Störung
- 3.2 Die Befragung
- 3.2.1 Wahl der Methodik
- 3.2.2 Darstellung der Zielgruppe
- 3.2.3 Operationalisierung und Strukturbaum
- 3.2.4 Aufbau des Befragungsinstruments
- 3.2.5 Durchführung der Befragung
- 3.2.6 Beschreibung der Stichprobe
- 4 Ergebnisse
- 4.1 Methodik zur Datenauswertung
- 4.2 Auswertung des Datenmaterials der Befragung
- 4.3 Prüfung der Annahmen
- 4.3.1 Ergebnisse zu Hypothese 1
- 4.3.2 Ergebnisse zu Hypothese 2
- 4.3.3 Ergebnisse zu Hypothese 3
- 5 Diskussion
- 5.1 Interpretation und Beurteilung der Ergebnisse
- 5.2 Kritische Reflexion der Methodik
- 5.3 Kritische Reflexion der Ergebnisse
- 5.4 Fazit mit Zukunftsausblick
- Anhang
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Masterarbeit untersucht den Zusammenhang zwischen der Nutzung von Social-Media-Plattformen (Facebook, Instagram, WhatsApp) und dem Wohlbefinden von Menschen mit psychischen Störungen (Depression, Angststörung, PTBS). Ziel ist es, die Zusammenhänge zwischen Nutzungsdauer, Nutzungsverhalten und der Intensität der psychischen Symptomatik zu erforschen.
- Einfluss der Nutzungsdauer von Social Media auf das Wohlbefinden
- Unterschiede im Wohlbefinden abhängig von der genutzten Plattform
- Zusammenhang zwischen Nutzungsverhalten und der Ausprägung psychischer Symptome
- Qualitative und quantitative Aspekte der Social-Media-Nutzung
- Identifikation von Forschungslücken im Bereich Social Media und psychische Gesundheit
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Dieses Kapitel führt in die Thematik ein, stellt die Problemstellung dar – den zunehmenden Anstieg psychischer Erkrankungen in Verbindung mit der steigenden Social-Media-Nutzung – und benennt die Zielsetzung der Arbeit. Es werden einführende Studien zitiert, die den Zusammenhang zwischen Social-Media-Konsum und Wohlbefinden aufzeigen.
2 Theoretische Grundlagen: Dieses Kapitel vermittelt die theoretischen Grundlagen. Es definiert Wohlbefinden, unterscheidet zwischen hedonischem und eudaimonischem Wohlbefinden und beschreibt verschiedene Modelle zur Erfassung. Es definiert psychische Störungen, erläutert Entstehung und Entwicklung sowie Therapieansätze. Schließlich werden Social-Media-Plattformen (Facebook, Instagram, WhatsApp) beschrieben und bereits vorhandene Studien zu deren Einfluss auf psychische Gesundheit zusammengefasst und kritisch bewertet.
3 Methode: Dieses Kapitel beschreibt die durchgeführte quantitative Online-Befragung. Es werden die Methodik, die Zielgruppe, die Operationalisierung des Konstrukts mit Hilfe eines Strukturbaums und der Aufbau des Fragebogens detailliert erläutert. Der Ablauf der Befragung und die Zusammensetzung der Stichprobe (n=972) werden ebenfalls umfassend dargestellt.
Schlüsselwörter
Social Media, Instagram, Facebook, WhatsApp, psychische Störungen, Depression, Posttraumatische Belastungsstörung, Angststörung, Wohlbefinden, empirische Forschung, Nutzungsverhalten, Symptomintensität, Korrelation, Online-Befragung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Masterarbeit: Social Media und psychische Gesundheit
Was ist das Thema der Masterarbeit?
Die Masterarbeit untersucht den Zusammenhang zwischen der Nutzung von Social-Media-Plattformen (Facebook, Instagram, WhatsApp) und dem Wohlbefinden von Menschen mit psychischen Störungen (Depression, Angststörung, PTBS). Es wird der Einfluss von Nutzungsdauer und -verhalten auf die Intensität der psychischen Symptomatik erforscht.
Welche Forschungsfragen werden behandelt?
Die Arbeit untersucht u.a. den Einfluss der Nutzungsdauer von Social Media auf das Wohlbefinden, Unterschiede im Wohlbefinden abhängig von der genutzten Plattform, den Zusammenhang zwischen Nutzungsverhalten und der Ausprägung psychischer Symptome, sowie qualitative und quantitative Aspekte der Social-Media-Nutzung. Es werden auch Forschungslücken im Bereich Social Media und psychische Gesundheit identifiziert.
Welche theoretischen Grundlagen werden verwendet?
Die Arbeit definiert Wohlbefinden (hedonistisch und eudaimonisch), beschreibt verschiedene Modelle zur Erfassung und definiert psychische Störungen (Entstehung, Entwicklung, Therapieansätze). Es werden Social-Media-Plattformen beschrieben und bestehende Studien zu deren Einfluss auf die psychische Gesundheit zusammengefasst und kritisch bewertet.
Welche Methode wurde angewendet?
Es wurde eine quantitative Online-Befragung durchgeführt (n=972). Die Methodik, die Zielgruppe, die Operationalisierung des Konstrukts (mit Strukturbaum), der Aufbau des Fragebogens, der Ablauf der Befragung und die Zusammensetzung der Stichprobe werden detailliert beschrieben.
Wie wurden die Daten ausgewertet?
Das Kapitel "Ergebnisse" beschreibt die Methodik der Datenauswertung und die Auswertung des Datenmaterials der Befragung. Die Ergebnisse werden im Hinblick auf aufgestellte Hypothesen (mindestens drei) geprüft und dargestellt.
Welche Ergebnisse wurden erzielt?
Die konkreten Ergebnisse zur Prüfung der Hypothesen sind im Kapitel "Ergebnisse" detailliert dargestellt. Das Kapitel "Diskussion" interpretiert und bewertet diese Ergebnisse kritisch, reflektiert die Methodik und zieht ein Fazit mit Zukunftsausblick.
Welche Schlüsselwörter sind relevant?
Relevante Schlüsselwörter sind: Social Media, Instagram, Facebook, WhatsApp, psychische Störungen, Depression, Posttraumatische Belastungsstörung, Angststörung, Wohlbefinden, empirische Forschung, Nutzungsverhalten, Symptomintensität, Korrelation, Online-Befragung.
Wie ist die Arbeit aufgebaut?
Die Arbeit folgt einem klassischen wissenschaftlichen Aufbau mit Einleitung, theoretischen Grundlagen, Methode, Ergebnissen, Diskussion und Anhang. Ein detailliertes Inhaltsverzeichnis ist im HTML-Code enthalten.
Für wen ist diese Arbeit relevant?
Diese Arbeit ist relevant für Wissenschaftler, Studierende, und alle Interessierten, die sich mit dem Zusammenhang zwischen Social-Media-Nutzung und psychischer Gesundheit auseinandersetzen. Die Ergebnisse können dazu beitragen, die psychische Gesundheit in Zeiten intensiver Social-Media-Nutzung zu verbessern.
- Quote paper
- Franziska Pfoser (Author), 2019, Social Media und psychische Störungen. Zusammenhänge zwischen der Nutzung von Social-Media-Plattformen und dem persönlichen Wohlbefinden bei Menschen mit einer psychischen Störung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1176241