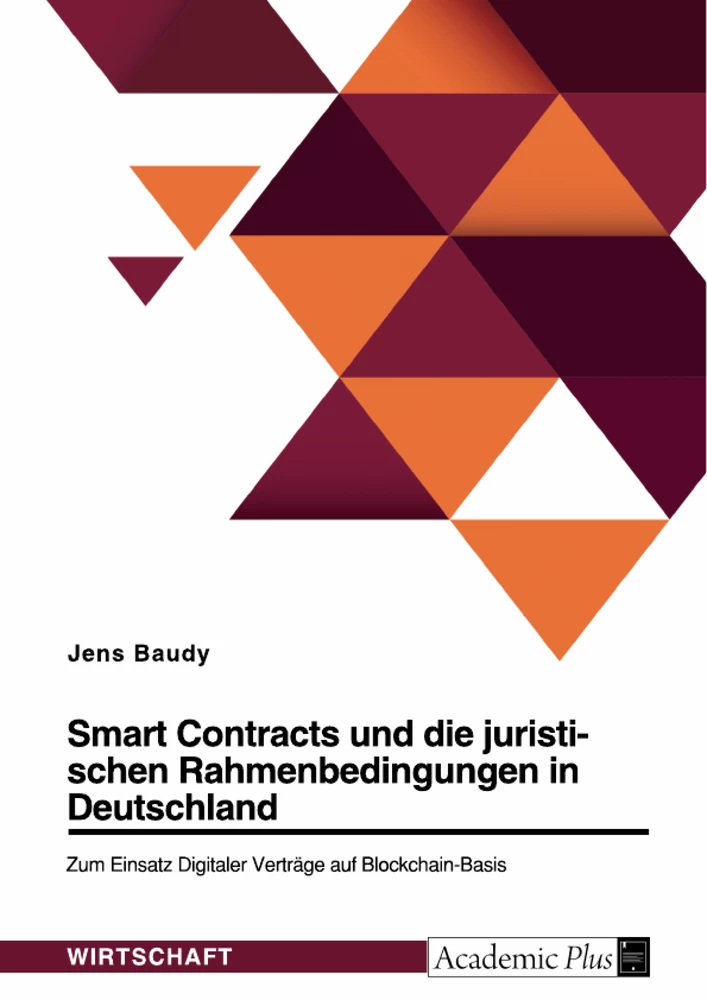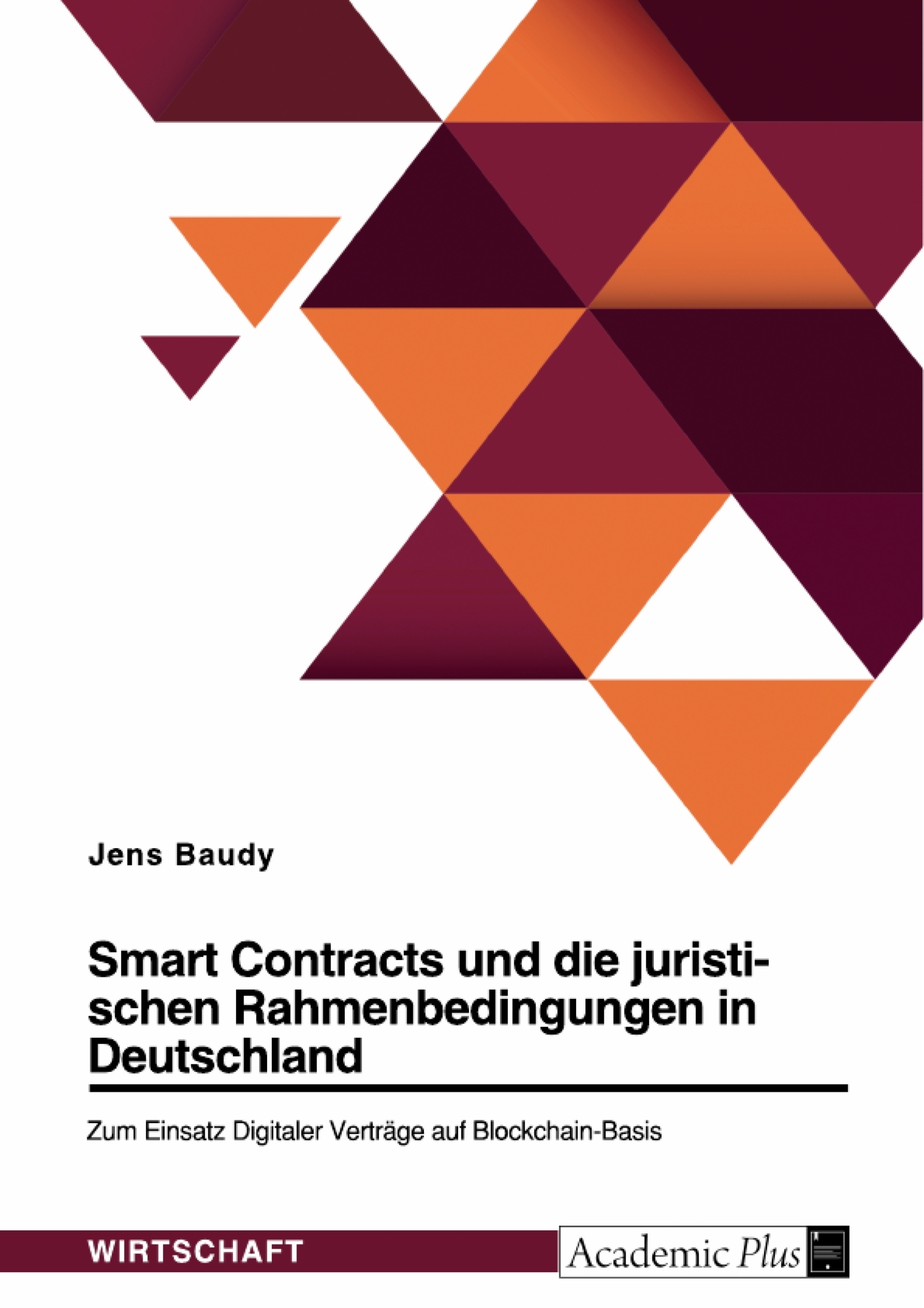In dieser Arbeit werden juristische Hürden untersucht, die beim Einsatz von Smart Contracts auftreten können und Rahmenbedingungen formuliert, innerhalb derer eine Nutzung nach dem gültigen Recht möglich ist.
Im Bereich Legal Tech sind Smart Contracts heutzutage immer häufiger als Schlagwort vorzufinden. Sie dienen der Schließung, Automatisierung und Rechtsdurchsetzung klassischer Verträge und wollen auf diesem Weg Rechtsstreitigkeiten auf ein Minimum reduzieren. Auch wenn sie von einigen bereits als unausweichliche Technologie angepriesen werden, ist ihre regulatorische Zulässigkeit noch nicht abschließend geklärt.
Selten waren die Meinungen über eine Technologie so zwiegespalten, wie es bei der Blockchain der Fall ist. Befürworter sehen in ihrer dezentralen Natur die Lösung für eine Vielzahl an Problemen des digitalen Zeitalters. Als disruptive Technologie wird ihr nachgesagt, die Digitalisierung in verschiedenen Bereichen wesentlich voranzutreiben und die Wirtschaft grundlegend auf den Kopf zu stellen.
Gleichzeitig steht das Konzept vor dem Hintergrund der Klimadebatte massiv unter Kritik, da es teils enorme Rechenleistung und somit Ressourcen erfordert. Entgegen der häufig vorzufindenden Gleichstellung der Blockchain mit Kryptowährungen gehen ihre Anwendungsfelder aber weit über diese hinaus. Blockchain-basierte Smart Contracts sollen zukünftig zur Obsoleszenz zentraler Institutionen über alle Branchen hinweg beitragen und die traditionelle Kautelarpraxis grundlegend revolutionieren.
Verträge werden sodann direkt zwischen Parteien geschlossen und die Rechtsdurchsetzung mittels selbstausführender Software automatisiert. Der damit einhergehende Verzicht auf zentrale Intermediäre hat Zeit- und Kosteneinsparungen zur Folge und stößt damit vor allem im Finanzsektor auf Begeisterung. Dennoch werden von Gegnern sinnvolle Einsatzzwecke der Smart Contracts angezweifelt, während andere dem bestehenden Rechtssystem bereits seine Daseinsberechtigung entziehen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Technologische Grundlagen
- Peer-to-Peer Netzwerke und Distributed-Ledger
- Blockchain
- Funktionsweise
- Klassifikation
- Problematik und Weiterentwicklung
- Blockchain 2.0
- Smart Contracts
- Definition
- Funktionsweise
- Evaluation und Anwendungsgebiete
- Juristische Betrachtung von Smart Contracts
- Vorvertragliche Herausforderungen
- Zurechnung von Willenserklärungen
- Software als Vertragssprache
- Smart Contracts und das AGB-Gesetz
- Gefahr der unerlaubten Rechtsdienstleistung
- Vertragsschluss
- Angebot und Annahme mittels Smart Contract
- Kryptowährung als schuldrechtliche Gegenleistung
- Störungen im Vertragsverhältnis
- Wirksamkeitshindernisse
- Rechtsvernichtende Einwendungen
- Leistungsstörungen
- Digitale Konfliktlösung und Rückabwicklung
- Automatisierte Selbstjustiz
- Vereinbarkeit von Transparenz und Datenschutz
- Vorvertragliche Herausforderungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der rechtlichen Einordnung von Smart Contracts und analysiert die regulatorischen Rahmenbedingungen für ihren Einsatz im digitalen Rechtsverkehr. Die Arbeit zielt darauf ab, die Herausforderungen und Möglichkeiten der Verwendung dieser Technologie im Kontext des geltenden Rechts zu beleuchten und juristische Handlungsempfehlungen zu formulieren.
- Rechtliche Einordnung von Smart Contracts
- Herausforderungen im Bereich des Leistungsstörungs- und Datenschutzrechts
- Möglichkeiten und Grenzen der Automatisierung von Vertragsabschlüssen
- Konzeptionelle und rechtliche Anpassungen für die breite Anwendung von Smart Contracts
- Entwicklung eines rechtlichen Rahmens für die Nutzung von Smart Contracts
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema Smart Contracts ein und skizziert die Relevanz dieser Technologie für den digitalen Rechtsverkehr. Im Anschluss werden in Kapitel 2 die technologischen Grundlagen von Smart Contracts erläutert. Hierbei werden die Funktionsweise und Klassifizierung von Blockchain-Technologien sowie die Problematik und Weiterentwicklung der Blockchain 2.0 behandelt. Kapitel 3 widmet sich der Definition, Funktionsweise und Evaluation von Smart Contracts sowie der Darstellung ihrer vielseitigen Anwendungsgebiete. Kapitel 4 untersucht die rechtlichen Herausforderungen und Möglichkeiten von Smart Contracts im Detail. Dabei werden die Bereiche des vorvertraglichen Rechts, des Vertragsschlusses, der Störungen im Vertragsverhältnis sowie der Vereinbarkeit von Transparenz und Datenschutz beleuchtet.
Schlüsselwörter
Diese Arbeit befasst sich mit den rechtlichen Aspekten von Smart Contracts und beleuchtet die Schlüsselthemen Blockchain, Smart Contracts, Zivilrecht und Datenschutzrecht. Die Arbeit analysiert die regulatorischen Herausforderungen und Chancen dieser Technologie im Kontext des geltenden Rechts und liefert einen Überblick über die relevanten juristischen Aspekte im Zusammenhang mit Smart Contracts.
Häufig gestellte Fragen
Was sind Smart Contracts?
Smart Contracts sind computergestützte Protokolle (Software), die Verträge abbilden, automatisieren und deren Einhaltung technisch erzwingen, meist auf Basis einer Blockchain.
Sind Smart Contracts nach deutschem Recht zulässig?
Die Arbeit untersucht juristische Hürden und kommt zu dem Schluss, dass sie unter bestimmten Rahmenbedingungen nutzbar sind, wobei Themen wie Willenserklärungen und das AGB-Recht beachtet werden müssen.
Welche Rolle spielt die Blockchain für Smart Contracts?
Die Blockchain dient als dezentrales Register (Distributed Ledger), das die Unveränderbarkeit und Transparenz der automatisierten Verträge ohne zentrale Mittelsmänner garantiert.
Welche datenschutzrechtlichen Probleme ergeben sich?
Ein Konflikt besteht zwischen der Unveränderbarkeit der Blockchain und dem "Recht auf Vergessenwerden" gemäß DSGVO, da Daten auf einer Blockchain kaum gelöscht werden können.
Können Smart Contracts klassische Anwälte ersetzen?
Sie können einfache, standardisierte Abläufe automatisieren (Kautelarpraxis revolutionieren), stoßen aber bei komplexen Leistungsstörungen und individueller Rechtsberatung an Grenzen.
- Arbeit zitieren
- Jens Baudy (Autor:in), 2022, Smart Contracts und die juristischen Rahmenbedingungen in Deutschland. Zum Einsatz Digitaler Verträge auf Blockchain-Basis, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1176386