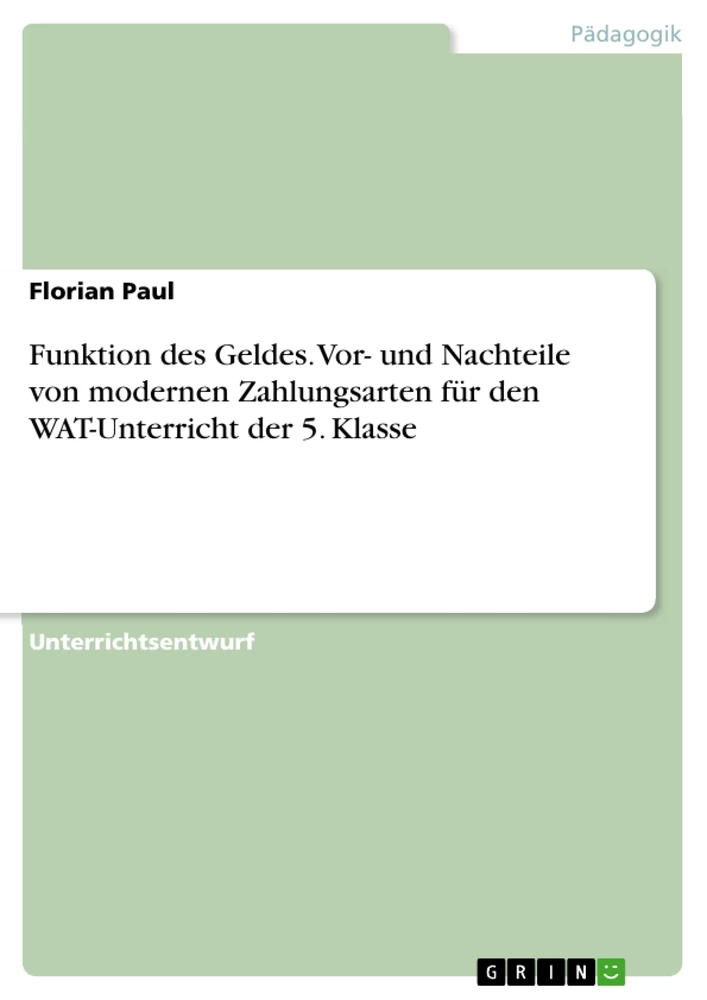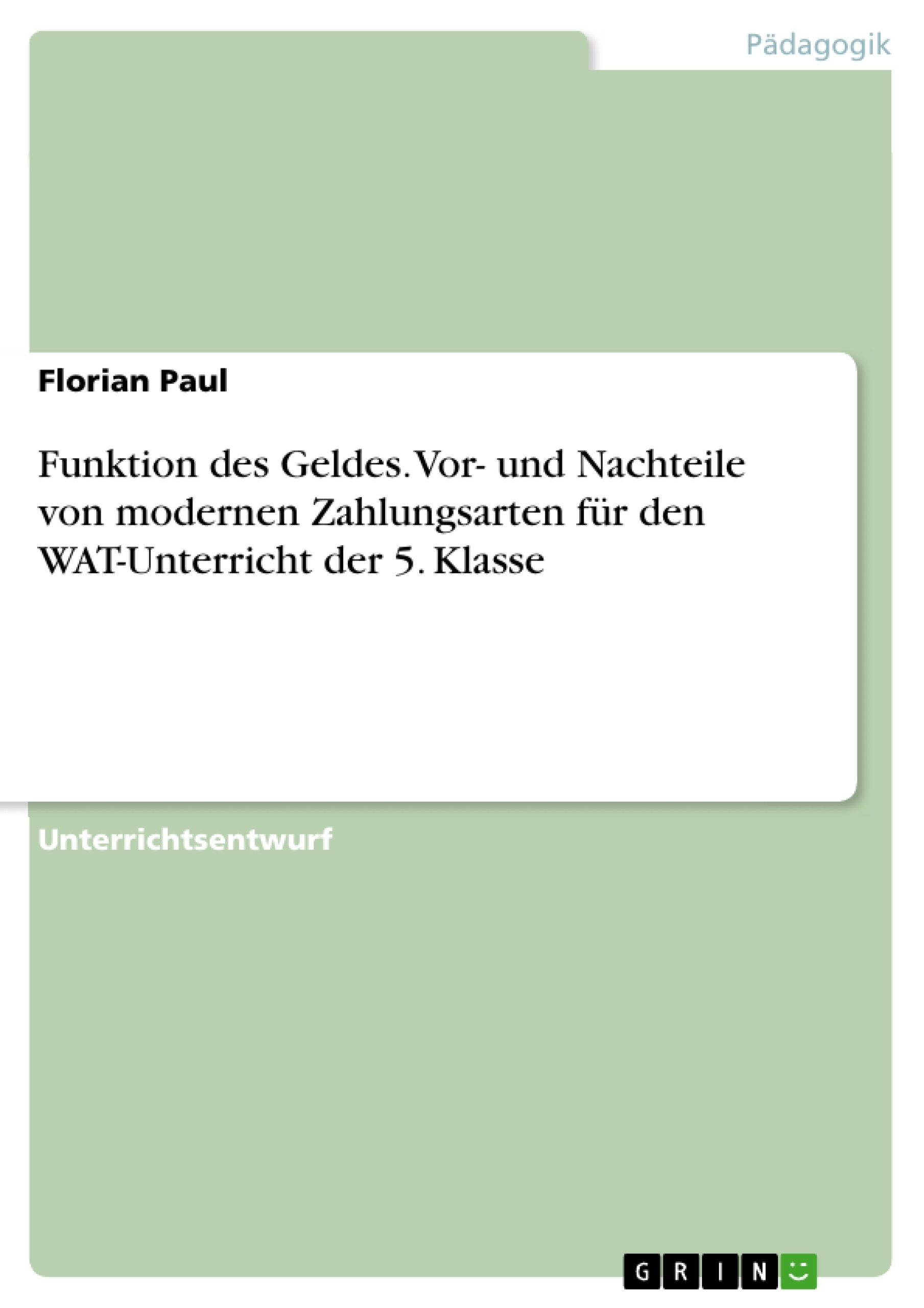Diese Arbeit beinhaltet einen Unterrichtsentwurf und die Reflexion der Durchführung einer Schulstunde zum Thema: "Funktion des Geldes. Vor- und Nachteile von modernen Zahlungsarten". Die Stunde ist für eine 5. Klasse konzipiert und wird im Fach Wirtschaft-Arbeit-Technik (WAT) unterrichtet.
Das Thema Geld ist nicht nur Bestandteil des verwendeten Lehrbuchs der Schüler und eines der Themenfelder des Rahmenlehrplans für Grundschulen, sondern auch ein immer aktueller Teil der Lebensrealität eines jeden Schülers. Das Thema umgibt sie in ihrer alltäglichen Realität, in der Form von Wertangaben von Produkten in Geld als Einheit und (Geld-)Geschenken an Feiertagen.
Gerade die Generation der „digital natives“ ist umgeben von Angeboten im digitalen Raum, wie Mikrotransaktionen in kostenlosen Apps, die sie nutzen. Das Thema Sparen gehört in der Form des physischen Geldsammelns ebenso zur Realität, da viele Luxusgüter, wie eine Spielekonsole oder ein neues Fahrrad, einen so hohen Wert haben, dass Geld dafür gesammelt werden muss. Natürlich können sich Schüler auch direkt Gegenstände zu Feiertagen wünschen oder ihren Eltern überzeugend darlegen, warum sie einen Gegenstand zwingend benötigen, es wird trotzdem Gegenstände geben, auf die sie sparen.
Der verantwortungsvolle Umgang mit Geld sollte allerdings im kleinen Rahmen erlernt werden, um im späteren Leben (oder jetzt schon im kleineren Maßstab) mündig, verantwortungsbewusst und selbstbestimmt im Wirtschaftskontext mit Geld umzugehen. Ökonomische Bildung sollte im Allgemeinen dafür sorgen, dass Schüler Probleme in verschiedenen Lebenssituationen selbstständig bewältigen können. Das Verständnis der Funktionen von Geld und der Art von verschiedenen Zahlungswegen sowie deren Vor- und Nachteile ist ein erster Schritt in die thematische Richtung von Bedürfnissen, Einkommen und letztendlich dem Wirtschaftskreislauf.
Inhaltsverzeichnis
- Lernvoraussetzungen
- Darstellung und Begründung didaktisch-methodischer Entscheidungen
- Sequenz- bzw. Reihenplanung des Unterrichts
- Kompetenzen und Standards
- Fachliche Analyse
- Didaktisch-methodisches Konzept der Unterrichtsstunde
- Verlaufsplanung
- Reflexion
- Literaturverzeichnis
- Anhang
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Der Unterricht zielt darauf ab, den Schülern das Thema Geld und die verschiedenen modernen Zahlungsarten näherzubringen und ihre Funktionen sowie Vor- und Nachteile zu beleuchten. Dieser Unterricht soll ihnen helfen, ein Verständnis für den verantwortungsvollen Umgang mit Geld in verschiedenen Lebenssituationen zu entwickeln und sie auf die Herausforderungen des Wirtschaftskontextes vorzubereiten.
- Funktion des Geldes
- Moderne Zahlungsarten
- Vor- und Nachteile verschiedener Zahlungsarten
- Verantwortungsvoller Umgang mit Geld
- Ökonomische Bildung
Zusammenfassung der Kapitel
Lernvoraussetzungen
Die Lernsituation wird beschrieben, wobei die organisatorischen Gegebenheiten des Klassenraums, die Lehr- und Lernmethoden, die Vorkenntnisse der Schüler und die bisherige Unterrichtsphase beleuchtet werden. Besonderheiten wie das Klingelsignal, die Raumgestaltung und die Klassenatmosphäre werden erwähnt.
Darstellung und Begründung didaktisch-methodischer Entscheidungen
Dieses Kapitel erklärt die Einbindung des Themas Geld in den Rahmenlehrplan und beleuchtet die Relevanz des Themas für die Schüler. Es werden die Ziele des Unterrichts und die dazugehörenden Kompetenzen, sowie die fachliche Analyse des Themas "Geld" beschrieben. Die didaktisch-methodischen Entscheidungen, wie die Verwendung von Vorträgen und Gruppenarbeit, werden begründet und die Auswahl der Unterrichtsmethoden erläutert.
- Arbeit zitieren
- Florian Paul (Autor:in), 2021, Funktion des Geldes. Vor- und Nachteile von modernen Zahlungsarten für den WAT-Unterricht der 5. Klasse, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1176578