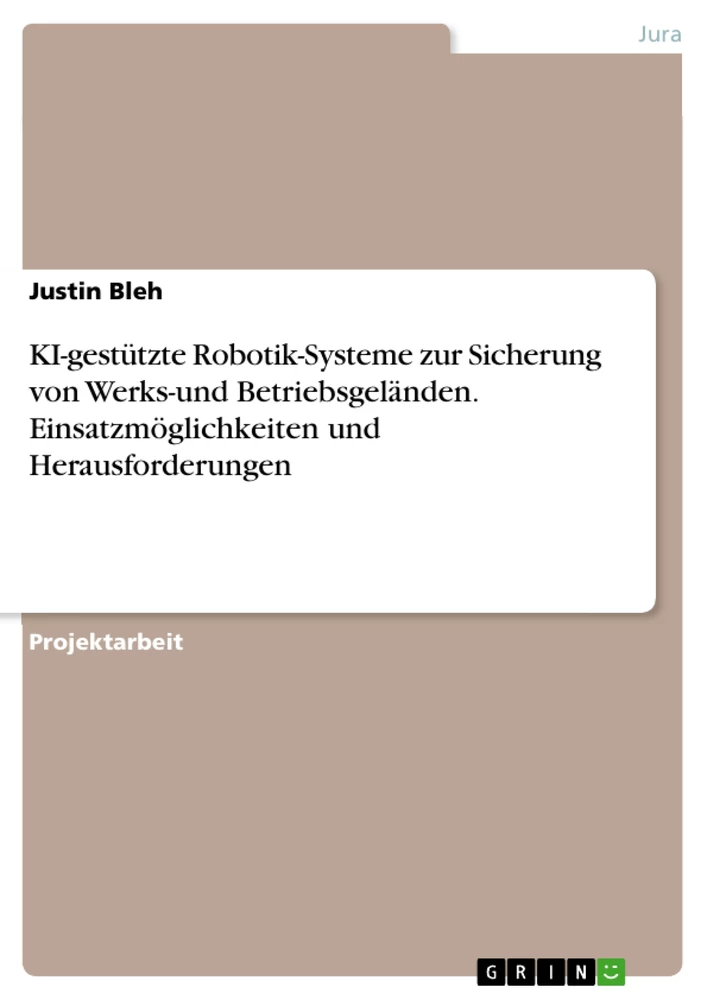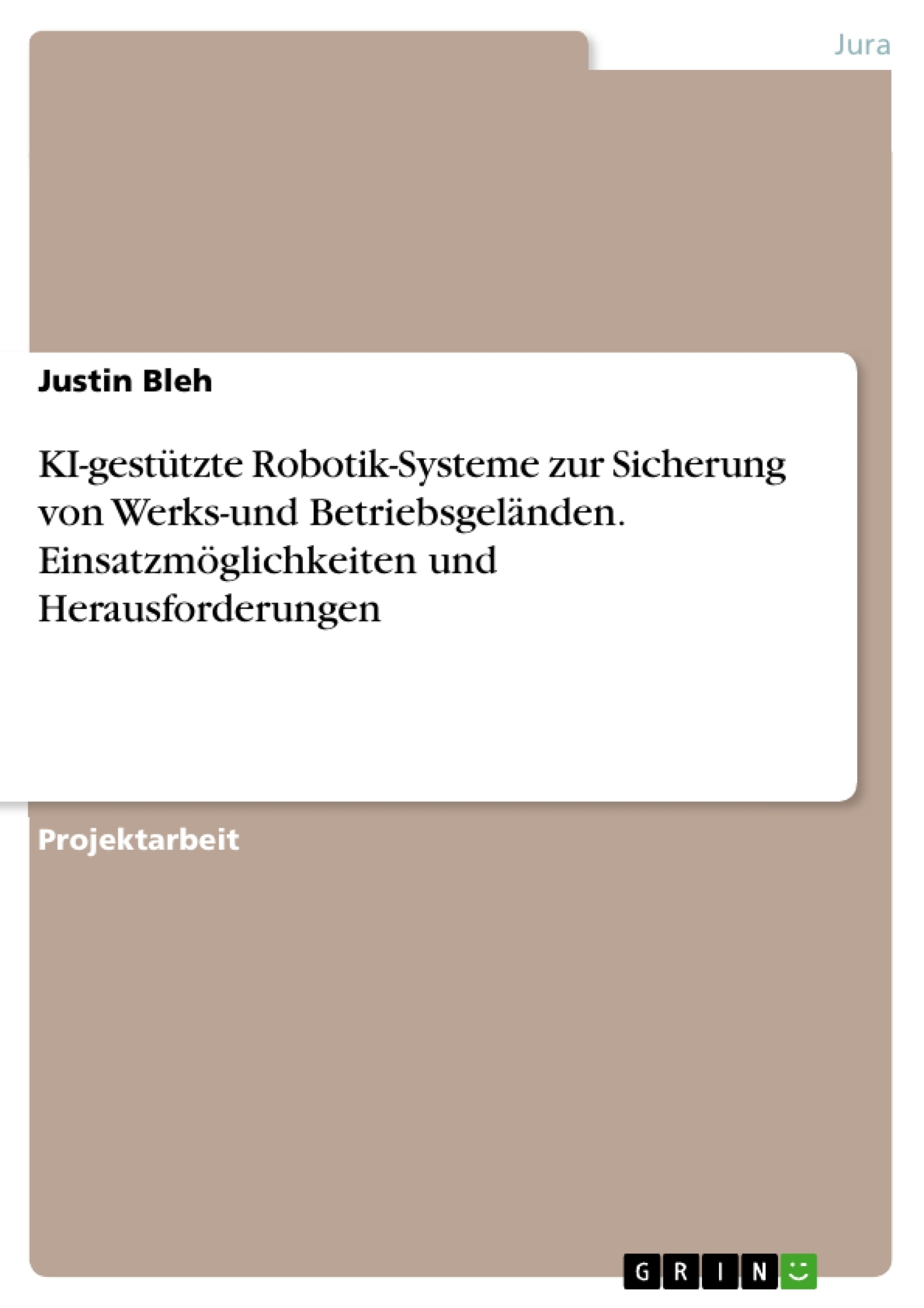Künstliche Intelligenz, Robotik und biometrische Legitimierung – Begriffe, die zu Zeiten der Jahrtausendwende noch klangen wie utopische Vorstellungen oder Auszüge aus Science-Fiction-Filmen, sind in aller Munde. Durch die Weiterentwicklungen dieser Technologien sind auch Einsatzmöglichkeiten außerhalb der produzierenden Industrie, beispielsweise im Sicherheitssektor denkbar. Im Laufe der Projektarbeit wird geprüft, inwieweit der Einsatz solcher Technologien nach den Maßgaben des Datenschutz- und Betriebsverfassungsrecht zu bewerten ist.
Schon jetzt ist die Legitimierung durch den Einsatz biometrischer Daten weltweit verbreitet. Die Entsperrung des iPhones durch Face-ID, Legitimation durch Abgabe eines Fingerabdrucks im Flugverkehr oder der Abgleich von Gesichtsmerkmalen bei Straftaten sind nur wenige Beispiele für die umfassende Nutzung von Biometrie als Identifikationstechnik. Der Vorteil biometrischer Legitimation im Gegensatz zu physischen Zugangskarten oder der Eingabe des persönlichen Passworts liegen sinnbildlich auf der Hand. Iris, Fingerabdruck und andere biometrische Merkmale sind nahezu fälschungssicher, während physische Identifikationsmöglichkeiten leicht gestohlen oder reproduziert, und Passwörter gehackt oder unberechtigt eingesehen werden können.
Inhaltsverzeichnis
- B.) ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS.
- C.) AUSARBEITUNG…………………………..\n
- I.) EINLEITUNG.........
- II.) VORSTELLBARE EINSATZMÖGLICHKEITEN
- III.) PROBLEMATIK DURCH DIE GRUNDSÄTZE DER DS-GVO.........
- 1.) TRANSPARENZGEBOT
- 2.) ZWECKBINDUNG
- 3.) DATENMINIMIERUNG.
- 4.) INTEGRITÄT UND VERTRAULICHKEIT..
- 5.) RECHENSCHAFTSPFLICHT..
- IV.) BETRIEBSVERFASSUNGSRECHT
- 1.) ANWENDUNG DES BETRVG........
- 2.) UNTERRICHTUNGSPFLICHT..
- 3.) MITBESTIMMUNGSRECHT
- V.) EINSCHLÄGIGE ERLAUBNISTATBESTÄNDE.
- 1.) Berechtigtes Interesse
- 2.) EINWILLIGUNG
- 3.) KOLLEKTIVVEREINBARUNG..\n.......
- 4.) AUSLEGUNGEN DER ÖFFNUNGSKLAUSEL
- VI.) TECHNISCHE UND ORGANISATORISCHE MAẞNAHMEN.
- VII.) DATENSCHUTZ-FOLGENABSCHÄTZUNG .
- VIII.) FAZIT.........
- D.) LITERATURVERZEICHNIS .........
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit den Einsatzmöglichkeiten von KI-gestützter Robotik zur Sicherung von Werks- und Betriebsgeländen. Sie untersucht die datenschutzrechtlichen Herausforderungen, die mit dem Einsatz dieser Systeme verbunden sind, und analysiert die relevanten rechtlichen Rahmenbedingungen.
- Datenschutzrechtliche Aspekte im Zusammenhang mit KI-gestützter Robotik
- Anwendung der Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) im Kontext von Robotik-Systemen
- Relevanz des Betriebsverfassungsrechts für die Einführung von KI-gestützter Robotik
- Ermittlung von Erlaubnisstatbeständen für die Verarbeitung personenbezogener Daten im Rahmen der Robotik-Anwendung
- Technische und organisatorische Maßnahmen zur Sicherstellung des Datenschutzes
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Diese Einleitung liefert einen einführenden Überblick über den Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI), Robotik und biometrischer Legitimierung im Bereich der Sicherheit. Es werden verschiedene Beispiele für den Einsatz von Biometrie als Identifikationstechnik genannt und deren Vorteile gegenüber anderen Methoden hervorgehoben.
- Vorstellbare Einsatzmöglichkeiten: Dieses Kapitel analysiert den potenziellen Einsatz von KI-gestützter Robotik im Security-Bereich. Es werden verschiedene Anwendungsgebiete und deren Herausforderungen im Hinblick auf die datenschutzrechtliche Relevanz beleuchtet.
- Problematik durch die Grundsätze der DS-GVO: Dieses Kapitel untersucht die Herausforderungen, die sich aus den Grundsätzen der DS-GVO für den Einsatz von KI-gestützter Robotik ergeben. Insbesondere das Transparenzgebot und die Herausforderungen durch lernende KI-Systeme werden diskutiert.
- Betriebsverfassungsrecht: In diesem Kapitel werden die relevanten Aspekte des Betriebsverfassungsrechts im Kontext von KI-gestützter Robotik beleuchtet. Themen wie die Anwendung des Betriebsverfassungsgesetzes (BetrVG), die Unterrichtungspflicht und das Mitbestimmungsrecht werden behandelt.
- Einschlägige Erlaubnisstatbestände: Dieses Kapitel untersucht die verschiedenen Erlaubnisstatbestände, die für die Verarbeitung personenbezogener Daten im Rahmen des Einsatzes von KI-gestützter Robotik relevant sind. Insbesondere werden das berechtigte Interesse, die Einwilligung und die Kollektivvereinbarung behandelt.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit zentralen Themen wie Datenschutzrecht, Künstliche Intelligenz (KI), Robotik, Biometrie, Transparenzgebot, Zweckbindung, Datenminimierung, Betriebsverfassungsrecht, Erlaubnisstatbestände, technische und organisatorische Maßnahmen, Datenschutz-Folgenabschätzung.
- Quote paper
- Justin Bleh (Author), 2021, KI-gestützte Robotik-Systeme zur Sicherung von Werks-und Betriebsgeländen. Einsatzmöglichkeiten und Herausforderungen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1176704