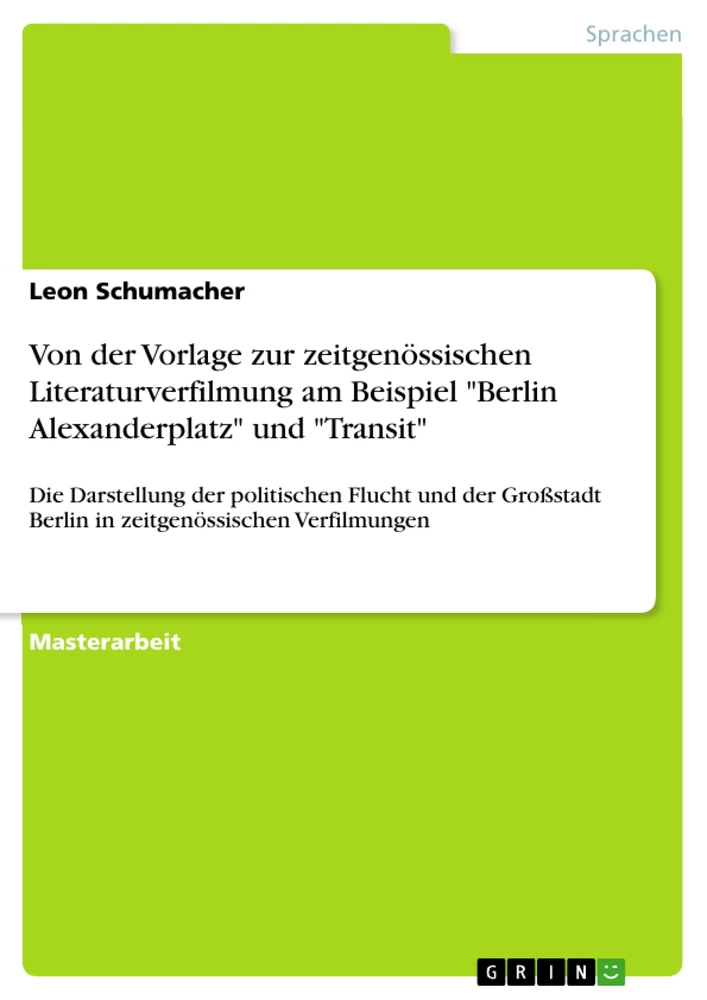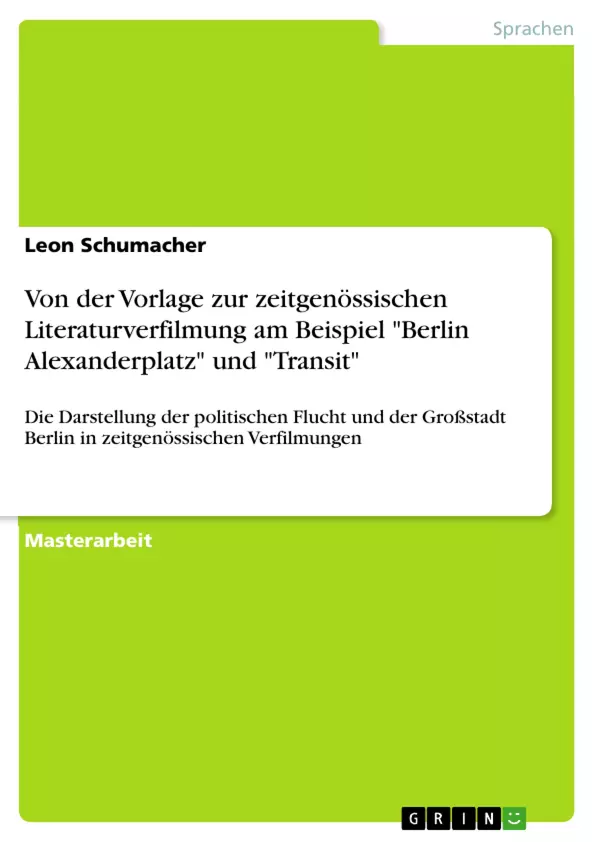Die Masterarbeit behandelt das Thema der zeitgenössischen, filmischen Adaptionen von Berlin Alexanderplatz und Transit. Transit wurde 2018, Berlin Alexanderplatz 2020 zeitgenössisch verfilmt und thematisch in die Gegenwart verlagert. Die Arbeit konzentriert sich auf bei Berlin Alexanderplatz auf die Darstellung der Großstadt Berlin und der politischen Situation und vergleicht Vorlage von Alfred Döblin mit der Verfilmung von Burhan Qurbani sowie der Serie von Rainer Werner Fassbinder. Der Abschnitt zu Transit behandelt das Thema der politischen Flucht. Auch hier werden Verbindungen zwischen Vergangenheit und Gegenwart untersucht und herausgearbeitet, wie dies auf filmisch umgesetzt wird. Die Arbeit analysiert Text wie Film und führt diesen Vergleich dann auf die Hypothese zurück.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 1.1 Ausgangslage
- 1.2 Ziele und Fragestellungen
- 1.3 Gliederung der Arbeit
- 2. Theoretischer Rahmen
- 2.1 Die Charakteristik der filmischen Adaption
- 2.2 Die Literaturverfilmung als Transformation
- 3. Berlin Alexanderplatz
- 3.1 Hintergrund zu Berlin Alexanderplatz
- 3.1.1 Übersicht über die Handlung von Berlin Alexanderplatz
- 3.1.2 Vergleichbarkeit zwischen der Verfilmung und der Vorlage
- 3.1.3 Übersicht über weitere Verfilmungen
- 3.2 Die Darstellung der Großstadt in Berlin Alexanderplatz
- 3.2.1 Die Darstellung der Großstadt Berlin in der Buchvorlage
- 3.2.2 Die transformierte Darstellung der Großstadt Berlin in Berlin Alexanderplatz von Burhan Qurbani
- 3.2.2.1 Vergleichende Analyse der Werke auf narrativer Ebene
- 3.2.2.2 Vergleichende Analyse der Werke auf erzählerischer Ebene
- 3.2.2.3 Exemplarischer Vergleich einer Szene in Döblins, Qurbanis und Fassbinders „Berlin Alexanderplatz“
- 4. Transit
- 4.1 Hintergrund zu Transit
- 4.1.1 Übersicht über die Handlung von Transit
- 4.1.2 Vergleichbarkeit zwischen der Verfilmung und der Vorlage
- 4.1.3 Übersicht über weitere Verfilmungen
- 4.2 Die transformierte Darstellung der politischen Flucht in Transit von Christian Petzold
- 4.2.1 Vergleichende Analyse der Werke auf narrativer Ebene
- 4.2.2 Vergleichende Analyse der Werke auf erzählerischer Ebene
- 4.2.3 Exemplarischer Vergleich einer Szene in Seghers und Petzolds Transit
- 5. Diskussion
- 5.1 Kritische Reflexion und Grenzen der Arbeit
- 5.2 Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Masterarbeit untersucht die aktuellen Verfilmungen von Alfred Döblins „Berlin Alexanderplatz“ und Anna Seghers „Transit“, insbesondere wie die Verlegung der Handlung in die Gegenwart die zeitgeschichtliche Relevanz der Vorlage aktualisiert und einen Bezug zur Jetztzeit herstellt. Die Arbeit analysiert die Transformationsprozesse von der literarischen Vorlage zur filmischen Adaption auf narrativer und erzählerischer Ebene.
- Transformationsprozesse in Literaturverfilmungen
- Die Darstellung der Großstadt Berlin in „Berlin Alexanderplatz“
- Die Darstellung politischer Flucht in „Transit“
- Intermediale Analyse von Literatur und Film
- Vergleichende Analyse verschiedener Verfilmungen desselben Werkes
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema der Literaturverfilmung ein und stellt die beiden ausgewählten Werke, „Berlin Alexanderplatz“ und „Transit“, vor. Sie begründet die Relevanz der Untersuchung aktueller Adaptionen klassischer Romane und skizziert die Ziele und Fragestellungen der Arbeit. Der Fokus liegt auf der Transformation der literarischen Vorlagen und der Aktualisierung ihrer Thematik für die Gegenwart. Der einleitende Abschnitt legt die methodischen Grundlagen der intermedialen Analyse fest und verweist auf die Bedeutung der Werktreue vs. freier Interpretation im Kontext von Literaturverfilmungen.
2. Theoretischer Rahmen: Dieses Kapitel liefert den theoretischen Hintergrund für die Analyse der Literaturverfilmungen. Es beleuchtet die Charakteristika filmischer Adaptionen im Allgemeinen und untersucht die Literaturverfilmung als einen Prozess der Transformation. Es etabliert ein theoretisches Verständnis davon, wie literarische Elemente in filmische Mittel übersetzt und interpretiert werden, und legt den Grundstein für die anschließende Vergleichsanalyse von literarischen Texten und ihren filmischen Gegenstücken.
3. Berlin Alexanderplatz: Dieses Kapitel analysiert die verschiedenen Verfilmungen von Alfred Döblins „Berlin Alexanderplatz“, mit einem Schwerpunkt auf der aktuellen Adaption von Burhan Qurbani. Es untersucht, wie die Darstellung der Großstadt Berlin in der Buchvorlage in die filmische Umsetzung transformiert wird. Die Analyse betrachtet sowohl narrative als auch erzählerische Ebenen und vergleicht die unterschiedlichen Adaptionen (einschließlich der Fassbinder-Version) exemplarisch anhand ausgewählter Szenen. Der Fokus liegt auf der Aktualisierung der Darstellung der Großstadt und der gesellschaftlichen Probleme in der Neuzeit.
4. Transit: Analog zu Kapitel 3, konzentriert sich dieses Kapitel auf Christian Petzolds Verfilmung von Anna Seghers „Transit“. Es untersucht die Transformation der Darstellung der politischen Flucht in der aktuellen Adaption und vergleicht sie mit der literarischen Vorlage. Ähnlich wie in Kapitel 3 werden narrative und erzählerische Ebenen analysiert und exemplarische Szenen verglichen, um die Veränderungen und Aktualisierungen der Thematik in der Neuverfilmung zu beleuchten.
Schlüsselwörter
Literaturverfilmung, intermediale Analyse, „Berlin Alexanderplatz“, „Transit“, Alfred Döblin, Anna Seghers, Großstadt, politische Flucht, Transformation, Adaption, Gegenwart, Vergleichende Analyse, narrative Ebene, erzählerische Ebene.
Häufig gestellte Fragen zu: Masterarbeit - Verfilmungen von "Berlin Alexanderplatz" und "Transit"
Was ist das Thema der Masterarbeit?
Die Masterarbeit untersucht aktuelle Verfilmungen von Alfred Döblins „Berlin Alexanderplatz“ und Anna Seghers „Transit“. Im Mittelpunkt steht die Analyse, wie die Verlegung der Handlung in die Gegenwart die zeitgeschichtliche Relevanz der Vorlage aktualisiert und einen Bezug zur Jetztzeit herstellt. Die Arbeit analysiert die Transformationsprozesse von der literarischen Vorlage zur filmischen Adaption auf narrativer und erzählerischer Ebene.
Welche Werke werden analysiert?
Die Arbeit konzentriert sich auf die Verfilmungen von Alfred Döblins „Berlin Alexanderplatz“ (insbesondere die Adaption von Burhan Qurbani) und Anna Seghers „Transit“ (insbesondere die Adaption von Christian Petzold). Es werden auch Vergleiche zu anderen Verfilmungen der jeweiligen Werke gezogen.
Welche Aspekte werden in der Analyse betrachtet?
Die Analyse untersucht die Transformationsprozesse von der literarischen Vorlage zur filmischen Adaption. Es werden sowohl narrative als auch erzählerische Ebenen verglichen. Besondere Aufmerksamkeit wird der Darstellung der Großstadt Berlin in „Berlin Alexanderplatz“ und der Darstellung politischer Flucht in „Transit“ gewidmet.
Welche methodischen Ansätze werden verwendet?
Die Arbeit verwendet eine intermediale Analyse, um Literatur und Film zu vergleichen. Es werden vergleichende Analysen verschiedener Verfilmungen desselben Werkes durchgeführt, wobei exemplarische Szenenvergleiche die Unterschiede und Gemeinsamkeiten herausarbeiten.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themenschwerpunkte: Transformationsprozesse in Literaturverfilmungen, die Darstellung der Großstadt Berlin in „Berlin Alexanderplatz“, die Darstellung politischer Flucht in „Transit“, intermediale Analyse von Literatur und Film sowie vergleichende Analysen verschiedener Verfilmungen desselben Werkes.
Wie ist die Arbeit aufgebaut?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, einen theoretischen Rahmen, Kapitel zu „Berlin Alexanderplatz“ und „Transit“, eine Diskussion mit kritischer Reflexion und Fazit, sowie ein Inhaltsverzeichnis und Schlüsselwörter. Die Kapitel zu den einzelnen Werken beinhalten Hintergrundinformationen zu den Romanen und ihren Verfilmungen, sowie detaillierte vergleichende Analysen auf narrativer und erzählerischer Ebene.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Literaturverfilmung, intermediale Analyse, „Berlin Alexanderplatz“, „Transit“, Alfred Döblin, Anna Seghers, Großstadt, politische Flucht, Transformation, Adaption, Gegenwart, Vergleichende Analyse, narrative Ebene, erzählerische Ebene.
Welche Fragen werden in der Arbeit gestellt?
Die Arbeit untersucht, wie die Verfilmungen die zeitgeschichtliche Relevanz der Romane aktualisieren und wie literarische Elemente in filmische Mittel übersetzt und interpretiert werden. Ein zentraler Aspekt ist der Vergleich von Werktreue und freier Interpretation in Literaturverfilmungen.
- Quote paper
- Leon Schumacher (Author), 2021, Von der Vorlage zur zeitgenössischen Literaturverfilmung am Beispiel "Berlin Alexanderplatz" und "Transit", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1176724