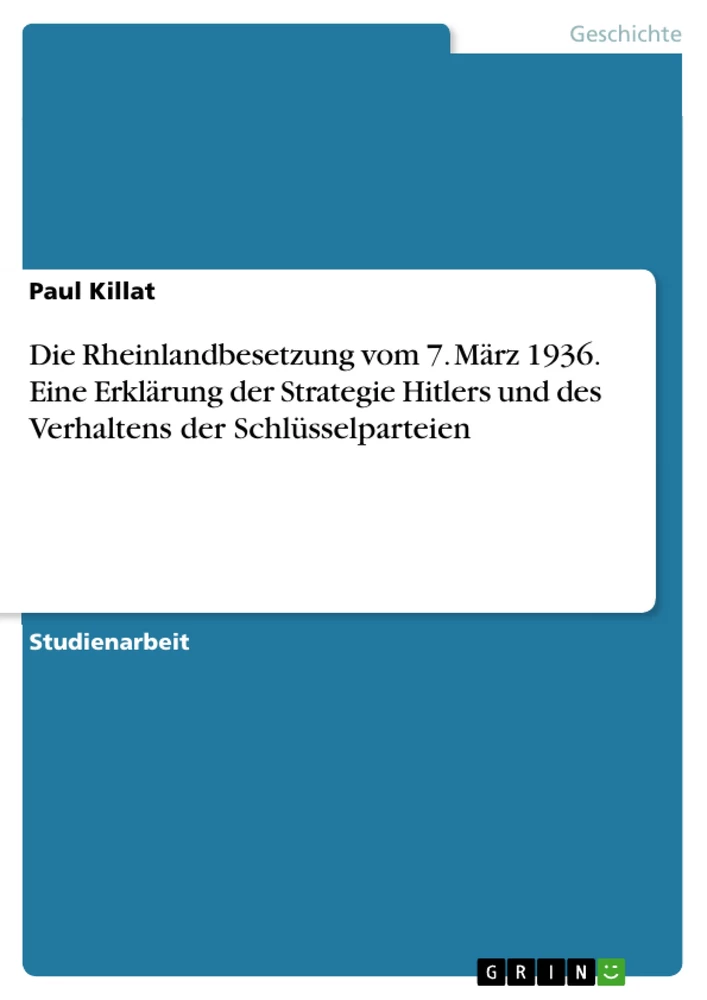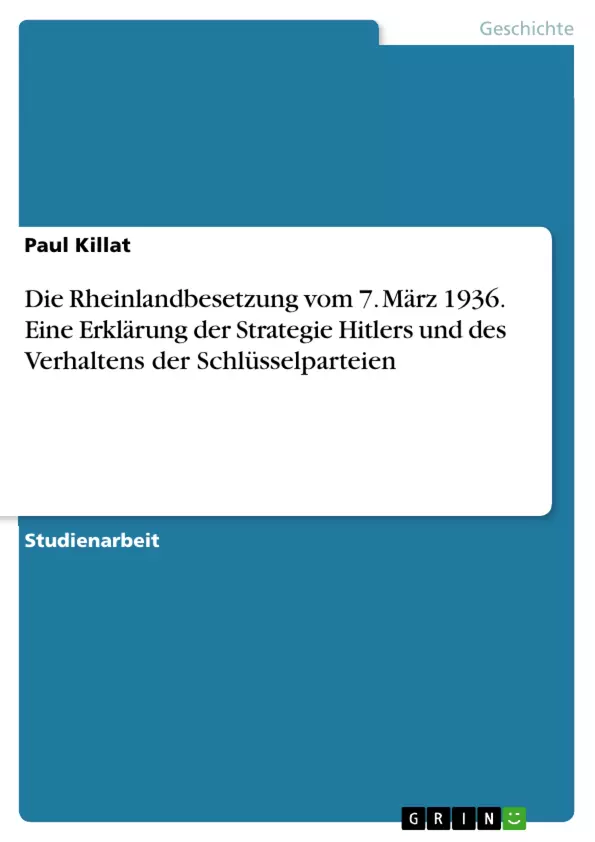Wieso griff Frankreich bei diesem aggressiven Schachzug Hitlers nicht ein, obwohl es – so Hitler – die militärischen Mittel dazu gehabt hätte? Weitere Fragen, die sich daraus ergeben, sind die der ausbleibenden Reaktion Englands und die nach der Strategie Hitlers. Diese drei Fragen sollen in der vorliegenden Arbeit erörtert werden.
Hierzu soll zunächst eine historische Einordnung der Ereignisse im März 1936 stattfinden, die als Basis für die weitere Analyse und Beantwortung der Forschungsfragen dient. Zu erwähnen sei hierbei, dass der Fokus gemäß des Proseminar-Themas auf den außenpolitischen Schritten Hitlers und gemäß der Thematik der Arbeit auf der Vorgeschichte des Rheinlandes liegt. Darauf folgt ein Kapitel, welches die strategische, aber auch kulturelle Wichtigkeit des Rheins und des Rheinlandes für die Deutschen beleuchten soll. Anschließend soll die erste Forschungsfrage näher betrachtet werden: Wie und mit welchen Strategien hat Hitler diesen Coup trotz der zahlreichen Hürden bewerkstelligt? Im fünften Kapitel soll es dann um die Reaktionen der beteiligten Schlüsselparteien Frankreich und England gehen, indem deren mögliche Gründe für ihr Verhalten aufgezeigt werden. In einem vorletzten Schritt werden die innen- und außenpolitischen Folgen der Rheinlandbesetzung beleuchtet, die einen Ausblick auf die folgenden Ereignisse und Entwicklungen bieten. Am Ende sollen in einem Fazit die Ergebnisse der vorliegenden Arbeit zusammengefasst und die Forschungsfragen soweit möglich prägnant beantwortet werden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Historische Einordnung
- Die Wichtigkeit des Rheins und des Rheinlandes für die Deutschen
- Die Strategie Hitlers
- Die Reaktionen der Schlüsselparteien
- Frankreich
- England
- Folgen
- Innenpolitisch
- Außenpolitisch
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert die Rheinlandbesetzung durch deutsche Truppen am 7. März 1936. Sie untersucht Hitlers Strategie bei diesem Vorgehen sowie die Reaktionen der Schlüsselparteien Frankreich und England. Die Arbeit zielt darauf ab, die Hintergründe und Auswirkungen dieses wichtigen Ereignisses im Kontext der Außenpolitik des Dritten Reiches zu beleuchten.
- Hitlers Strategie und die Hintergründe der Rheinlandbesetzung
- Die Bedeutung des Rheins und des Rheinlandes für Deutschland
- Die Reaktionen Frankreichs und Englands auf die Rheinlandbesetzung
- Die Folgen der Rheinlandbesetzung für die deutsche Innen- und Außenpolitik
- Die Rolle des Versailler Vertrages und des Locarno-Vertrages in diesem Kontext
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Thematik der Arbeit vor und erläutert die Forschungsfragen, die im Verlauf der Arbeit beantwortet werden sollen. Das zweite Kapitel bietet eine historische Einordnung der Ereignisse im März 1936 und beleuchtet die außenpolitische Strategie des Dritten Reiches in den Jahren nach 1933. Das dritte Kapitel konzentriert sich auf die strategische und kulturelle Bedeutung des Rheins und des Rheinlandes für Deutschland. Im vierten Kapitel wird Hitlers Strategie zur Rheinlandbesetzung näher betrachtet. Das fünfte Kapitel analysiert die Reaktionen der Schlüsselparteien Frankreich und England auf die Rheinlandbesetzung. Das Kapitel „Folgen“ untersucht die Auswirkungen der Rheinlandbesetzung auf die deutsche Innen- und Außenpolitik. Die Arbeit schließt mit einem Fazit, das die Ergebnisse zusammenfasst und die Forschungsfragen beantwortet.
Schlüsselwörter
Die Arbeit behandelt wichtige Schlüsselbegriffe und Themen der deutschen Außenpolitik im Dritten Reich, darunter die Rheinlandbesetzung, Hitlers Strategie, die Reaktionen der Schlüsselparteien Frankreich und England, der Versailler Vertrag, der Locarno-Vertrag, die Bedeutung des Rheins und des Rheinlandes für Deutschland, die innen- und außenpolitischen Folgen der Rheinlandbesetzung.
Häufig gestellte Fragen
Warum war die Rheinlandbesetzung 1936 ein Wendepunkt?
Mit der Besetzung brach Hitler sowohl den Versailler Vertrag als auch den Locarno-Pakt. Da die Westmächte nicht militärisch eingriffen, festigte dies Hitlers Macht und ermutigte ihn zu weiteren aggressiven Schritten.
Warum reagierte Frankreich nicht militärisch auf den Einmarsch?
Frankreich war innenpolitisch gespalten, befand sich in einer Wirtschaftskrise und wollte ohne die Unterstützung Englands kein militärisches Risiko eingehen.
Welche Rolle spielte England bei der Rheinlandbesetzung?
England verfolgte eine Politik des "Appeasement". Viele britische Politiker sahen den Einmarsch lediglich als Rückkehr Deutschlands in seinen eigenen "Hinterhof" an und lehnten Sanktionen ab.
Welche Strategie verfolgte Hitler bei diesem "Coup"?
Hitler nutzte die internationale Ablenkung durch den Abessinienkrieg und präsentierte den Einmarsch gleichzeitig mit einem "Friedensangebot", um die Weltöffentlichkeit zu beruhigen.
Was waren die innenpolitischen Folgen für Hitler?
Der Erfolg steigerte Hitlers Prestige im deutschen Volk enorm. Eine anschließende Volksabstimmung erbrachte eine überwältigende (wenn auch manipulierte) Zustimmung zu seiner Politik.
- Quote paper
- Paul Killat (Author), 2021, Die Rheinlandbesetzung vom 7. März 1936. Eine Erklärung der Strategie Hitlers und des Verhaltens der Schlüsselparteien, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1177356