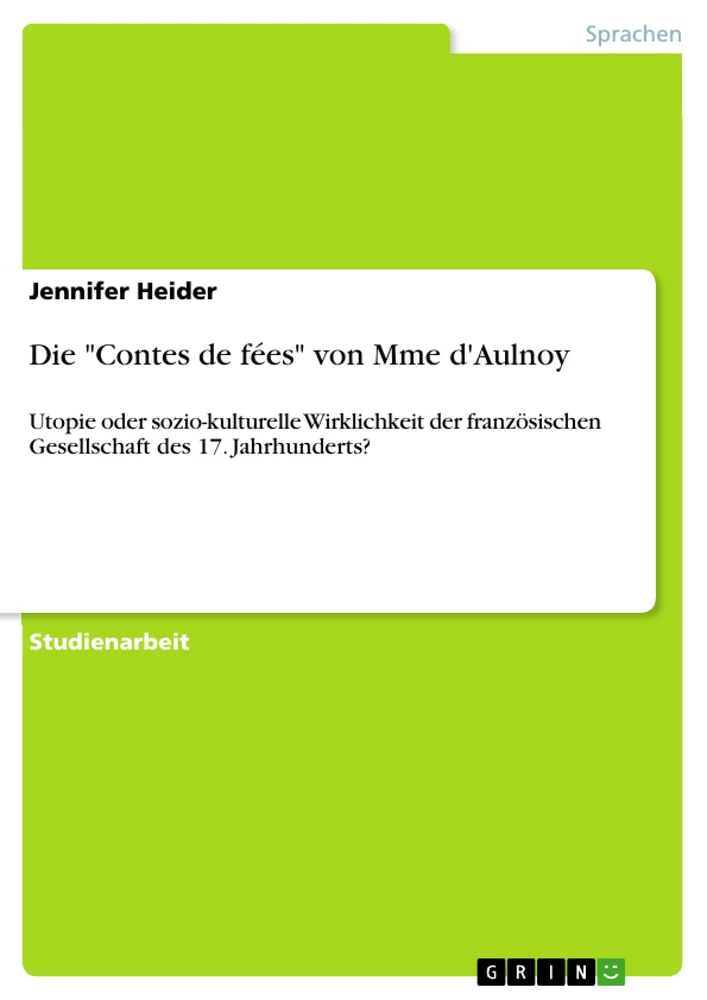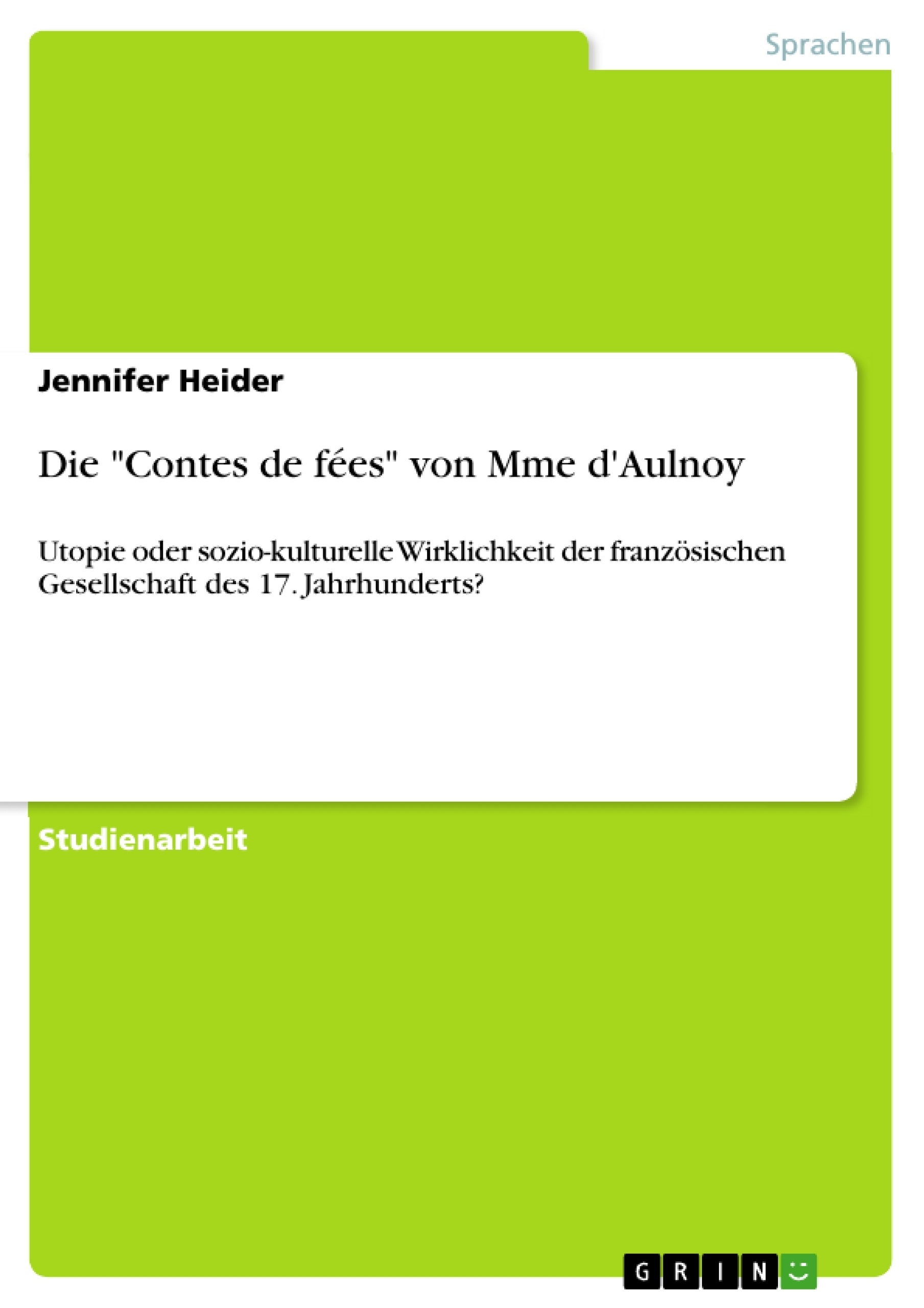Verkleidete Prinzessinnen, verwandelte Königssöhne, imaginäre Amazoneninseln und Schlösser aus Kristall, sprechende Bäume und erzählende Tiere – die salonnières der mondänen Gesellschaft hauchten ihren Figuren und Gestalten Leben ein und gaben diesen fiktiven Welten ihr Colorit. Der Geburtsort der Feenmärchen findet sich in den preziösen Salons der französischen Gesellschaft im 17. Jahrhundert. Neben dem für seine Märchen wohl bekanntesten französischen Schriftsteller Charles Perrault, stehen eine ganze Reihe jener Salondamen, die das Conte de fée initiiert, zu seiner Blüte gebracht und zur Popularität verholfen haben. Die grandes dames wie Mademoiselle Lhéritier, Mademoiselle Bernard, Mademoiselle de La Force, Madame de Murat, Madame Durand, Madame d’Auneuil und Madame d’Aulnoy organisierten sich über die Institution des Salon hinaus in interessengeleiteten, literarische Zirkeln und schufen ein neues literarisches Genre: den Conte de fées.
Zwischen 1690 und 1698 erschienen allein von Marie-Catherine d’Aulnoy 25 Feenmärchen. Obwohl zu ihren Lebzeiten sehr populär, sank das Interesse an ihren Contes de fées im 18. und 19. Jahrhundert. Auch im 20. Jahrhundert scheint Perrault vorrangig präsent zu sein. Erst das 300jährige Erscheinungsjubiläum ihrer Märchen initiiert ein „Feenmärchen-Revival“. Es folgen neue Editionen, eine von der Bibliothèque Nationale organisierte Ausstellung, auch das wissenschaftliche Interesse steigt. Dieser wiedererwachten Beachtung Mme d’Aulnoys durch die Forschung ist es geschuldet, dass dieser Arbeit ein weites Spektrum an Sekundärliteratur zur Verfügung steht.
Der erste Teil der Arbeit widmet sich der Selbstwahrnehmung Mme d’Aulnoys, der Wirkung der Märchen im privaten Raum und stellt anschließend die zeitgenössischen Reaktionen im öffentlichen Raum auf die Feenmärchen dar. Ziel ist es das Stimmungsbild der mondänen Gesellschaft hinsichtlich der Contes de fées zu zeichnen.
Der folgende Abschnitt setzt sich intensiv mit der narrativen Struktur, erzählerischen Elementen und Inhalten des d’aulnoyschen Conte de fée auseinander. Die gattungseignen Partikularitäten werden am Beispiel der von mir auf Grund ihres beispielhaften Charakters und Bekanntheitsgrades ausgewählten Feenmärchen herausgearbeitet. Die Analyse von Le Rameau d‘Or, La Princess Printanière et L‘Oranger et l‘Abeille hinsichtlich je eines Schwerpunktes soll Aufschluss über deren sozio-kulturelle Relevanz für die Salonièren und ihr Publikum geben.
Inhaltsverzeichnis
Einleitung
I. Zeitgenössische Rezeption
I. 1. Strategien der Selbstaufwertung und Wirkung im privaten Raum
I. 2. Wertschätzung und Kritik im öffentlichen Raum
II. Die Gattungsmerkmale der d‘aulnoyschen Contes de fées
II. 1. Le Rameau d‘Or – Die Kunst der Narration
II. 2. La Princesse Printanière – Die Macht der Sprache
II. 3. L‘Oranger et l‘Abeille – Das Spiel mit den Geschlechtern
III. Fazit
IV. Literaturverzeichnis
Einleitung
Verkleidete Prinzessinnen, verwandelte Königssöhne, imaginäre Amazoneninseln und Schlösser aus Kristall, sprechende Bäume und erzählende Tiere – die salonnières der mondänen Gesellschaft hauchten ihren Figuren und Gestalten Leben ein und gaben diesen fiktiven Welten ihr Colorit. Der Geburtsort der Feenmärchen findet sich in den preziösen Salons der französischen Gesellschaft im 17. Jahrhundert. Neben dem für seine Märchen wohl bekanntesten französischen Schriftsteller Charles Perrault, stehen eine ganze Reihe jener Salondamen, die das Conte de fée initiiert, zu seiner Blüte gebracht und zur Popularität verholfen haben. Die grandes dames wie Mademoiselle Lhéritier, Mademoiselle Bernard, Mademoiselle de La Force, Madame de Murat, Madame Durand, Madame d’Auneuil und Madame d’Aulnoy organisierten sich über die Institution des Salon hinaus in interessengeleiteten, literarische Zirkeln und schufen ein neues literarisches Genre: den Conte de fées.
Zwischen 1690 und 1698 erschienen allein von Marie-Catherine d’Aulnoy 25 Feenmärchen. Obwohl zu ihren Lebzeiten sehr populär, sank das Interesse an ihren Contes de fées im 18. und 19. Jahrhundert. Auch im 20. Jahrhundert scheint Perrault vorrangig präsent zu sein. Erst das 300jährige Erscheinungsjubiläum ihrer Märchen initiiert ein „Feenmärchen-Revival“. Es folgen neue Editionen, eine von der Bibliothèque Nationale organisierte Ausstellung, auch das wissenschaftliche Interesse steigt. Dieser wiedererwachten Beachtung Mme d’Aulnoys durch die Forschung ist es geschuldet, dass dieser Arbeit ein weites Spektrum an Sekundärliteratur zur Verfügung steht.
Der erste Teil der Arbeit widmet sich der Selbstwahrnehmung Mme d’Aulnoys, der Wirkung der Märchen im privaten Raum und stellt anschließend die zeitgenössischen Reaktionen im öffentlichen Raum auf die Feenmärchen dar. Ziel ist es das Stimmungsbild der mondänen Gesellschaft hinsichtlich der Contes de fées zu zeichnen.
Der folgende Abschnitt setzt sich intensiv mit der narrativen Struktur, erzählerischen Elementen und Inhalten des d’aulnoyschen Conte de fée auseinander. Die gattungseignen Partikularitäten werden am Beispiel der von mir auf Grund ihres beispielhaften Charakters und Bekanntheitsgrades ausgewählten Feenmärchen herausgearbeitet. Die Analyse von Le Rameau d‘Or, La Princess Printanière et L‘Oranger et l‘Abeille hinsichtlich je eines Schwerpunktes soll Aufschluss über deren sozio-kulturelle Relevanz für die Salonièren und ihr Publikum geben.
I. Zeitgenössische Rezeption
I.1 Strategien der Selbstaufwertung und Wirkung im privaten Raum
Die Untersuchung der Selbstwahrnehmung und Rezeptionsvorgaben Mme d’Aulnoys macht es notwendig einen Blick auf Charles Perrault zu werfen. Dieser spricht sich, durch die Figur des Abbé, im dritten Dialog seiner Parallèle des Anciens et Modernes (1690) eindeutig für die mündlich tradierten, heimischen Volksmärchen aus. Diese seien auf Grund ihrer moralischen Eindeutigkeit den anlogen Texten aus der Antike überlegen. Perrault als Verfechter des klassischen Regelkanons legte auf die Moralhaftigkeit der Märchen großen Wert und positionierte somit die literarische Formwerdung der Feenmärchen und ihre Autorinnen in den Kreis der „Modernes“.[1] Perraults Vorstellung einer Märchen erzählenden, von Kindern umringten Gouvernante, findet sich auch auf der Bild-Ebene: dem Frontispiz seiner Erstausgabe.[2] Die Illustration des Frontispiz der Contes nouveaux ou Les Fées à la mode[3] (1698) von Mme d’Aulnoy hebt sich davon enorm ab. Auch hier ist die Erzählfigur weiblich, allerdings trägt sie eine Brille und hält ein Buch in der Hand, welches als Titel Contes de fées (1697) erkennen lässt und die kaum zu entziffernden Worte Gracieuse et Percinet[4]. Sowohl die Darstellung des Vorlesens, die Nennung des eigenen Werkes als Titel des abgebildeten Buches, als auch der symbolhaft geschlossene Mund, der eine literarische Quelle suggeriert ist ein Indiz für eine selbstbewusste weibliche Autorenschaft.[5]
Darüber hinaus entwickelt sich die traditionelle Erzählerin nicht nur auf der Bildebene, sondern auch auf der Textebene zu einer Leserin. Der dritte Band der Contes de fées wird durch einen Rahmen gebenden Prolog eingeleitete, in dem unter dem abgekürzten Namen Madame D... die Autorin des Buches in Szene gesetzt wird. Mittels Lobpreisungen seitens Madame D... auf die Autorin vor einem fiktiven Publikum, explizite Aufforderungen weitere Geschichten zu erzählen und Bezügen zu anderen Märchen wird die Erzählerin selbst zum Leser ihrer Geschichten.[6]
Neben den Fragen der Moral und der Sitte maßen die grandes dames Sprach- und Stilproblemen entscheidende Bedeutung zu. Die Preziösen, eine von Frauen getragene Bewegung, deren führende Dame die Marquise de Rambouillet war, strebten nach Perfektion. Dieses Anliegen erstreckte sich auf Sprachschatz und Konversation aus der alles Niedere und Realistische verbannt werden sollte. Ebenso wie die Akademie verteidigten sie die Reinheit und Klarheit der Sprache.[7] Die Preziösen hoben sich auch in sofern von den anderen Frauen ihrer Zeit ab, als dass sie den Anspruch erhoben, selbst zu produzieren und zu schaffen und sich nicht mit der Rolle der plaudernden Dame zufrieden zugeben. Die meisten von ihnen hatten keine den Männern gleichwertige Bildung genossen, sie waren Autodidakten; ihre Lehrmeister waren in erster Linie Salonbesucher.[8] Inwieweit die Märchen als Bühne für die Ausformulierung und Darstellung preziöser Ideale fungierten wird im zweiten Teil der Arbeit näher betrachtet.
Die Salons bildeten den Rahmen für diese bedeutende Variante des jeux d’esprit; politisch entmachtet, war er die Bühne der aristokratischen Gesellschaft.[9] Lewis Seiffert sieht hier die Ursache für den Popularitätsverlust der Märchen begründet. Auf Grund zunehmender Bedeutungslosigkeit der kulturtragenden Schicht im 17. und 18. Jahrhundert verschwand peu à peu das angesprochene Lesepublikum. Schließlich gab es kein erwachsenes Publikum mehr, das in der Lage war Anspielungen auf die fiktionsexterne Realität des höfischen und städtischen Lebens des 17. Jahrhunderts zu verstehen, der Wiedererkennungseffekt ging verloren und somit auch die zugleich amüsante und brisante Note der Kunstmärchen. Folglich kam es zu einer Interessenverschiebung im Sinne Perraults, da nun der moralische Inhalt und der pädagogische Anspruch in den Mittelpunkt allgemeiner Betrachtungen rückten.[10]
I.2 Wertschätzung und Kritik im öffentlichen Raum
Zur Einschätzung der zeitgenössischen Reaktion auf die Contes de fées zieht Roswitha Böhm neben den Frauenkatalogen mit Memorialfunktion[11] sowohl gerade entstehende literarische Monatsschriften, wie den Mercure galant, das Journal de Sçavans und die Histoire des Ouvrages des Sçavans[12] als auch eine Streitschrift an die „Herren der Académie Française“[13] heran.[14]
Erschienen 1698, ist das zweibändige Werk von Seigneur de Vertrons La Nouvelle Pandore ou les Femmes illustres du siècle de Louis le Grand besonders aufschlussreich, da der Autor die feminine Kulturtätigkeit mit einer Lobpreisung der absolutistischen Monarchie verbindet und demzufolge die weibliche Kreativität als Argument heranzieht um die geistige Überlegenheit des französischen 17. Jahrhunderts zu untermauern. Des Weiteren schlägt er die Aufnahme einiger französischen Autorinnen, Malerinnen und Salondamen als Mitglieder in die Accademia die Ricovrati[15] vor. Unter der Überschrift „Les Muses Françoises ou Les Dames Illustres de France“[16] nennt er neben Mme de Scudéry und Mademoiselle de la Force auch Mme d’Aulnoy. Er betont ihre außerordentliche Redefertigkeit und ihren herausragenden Geist. Im Anschluss findet sich der o.g. Memorialkatalog, in dem sich Mme d’Aulnoy unter der Rubrik „Dames Illustres Vivantes“ findet. Ein kurzer Eintrag gibt Informationen über die Biographie und zählt ihre Publikationen sowohl Reiseberichte als auch Feenmärchen auf. Mme d’Aulnoy wird demnach über ihr Werk, auf Grund ihrer Eigenschaft als Verfasserin definiert, als „femme des lettres“ und nicht als „femme d’aventures“.[17]
Die in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts entstehenden und periodisch über die „république des lettres“ berichtenden Zeitschriften spielten eine enorme Rolle im kulturellen Leben der Zeit. Sie beinhalteten sowohl Buchankündigungen als auch Rezensionen, Kritik und Dispute, ergo beeinflussten sie in hohem Maße die Meinungsbildung in den anvisierten mondänen Kreisen. Der Mercure galant war das bedeutendste publizistische Organ in Bezug auf die Rezeption der Feenmärchen und hatte sich „...dem Dienst an den Damen verschrieben und [veröffentlichte] regelmäßig die von ihnen verfassten Texte [...].“[18] Folglich reagierte der Mercure galant zwischen 1690 und 1698 auf vielfältige Weise auf die Veröffentlichungen Mme d’Aulnoys. Die in den 90er Jahren publizierten Mémoires de la Cour d’Espagne wurden mit Begeisterung aufgenommen. Ebenso in den höchsten Tönen gelobt wurde die im darauf folgenden Jahr erschienene Histoire de Jean de Bourbon, Prince de Carency – und das, obwohl der Autor zugab das Buch nicht gelesen zu haben. Im Anschluss an die positive Einschätzung Mme d’Aulnoys als „femme de qualité“[19] folgt unverzüglich die Nennung der ihr Werk vertreibenden Buchhändler. Im Laufe des Jahres 1698 wird verstärkt über die Feenmärchen berichtet und das Erscheinen diverser Märchenbände angekündigt. Die Februar-Ausgabe enthält einen Kommentar zu den Contes nouveaux von Mme d’Aulnoy:
[...]
[1] Vgl.: Baader, Renate: Dames de lettres. Autorinnen des preziösen, hocharistokratischen und „modernen“ Salons (1649-1698), Romanistische Abhandlungen, Bd. 5, Stuttgart 1986, S. 228. Im Folgenden: BAADER 1986.
[2] Vgl.: Böhm, Roswitha: Wunderbares Erzählen. Die Feenmärchen der Marie-Cathrine d`Aulnoy, in: Prof. Bennholdt-Thompsen, Anke u.a. (Hg.): Ergebnisse der Frauen- und Geschlechterforschung, Bd.3, Göttingen 2003, S. 32. Im Folgenden: BÖHM 2003.
[3] Marie-Josèphe (Hg.): Elle était une fois, Paris 1989, S. 167.
[4] Gracieuse et Percinet ist das erste Feenmärchen, welches in dem Werk Contes des fées von 1697 erscheint.
[5] Vgl.: BÖHM: S. 31-36.
[6] Vgl. BÖHM 2003: S. 37/38.
[7] Vgl.: Bagola, Beatrice: Die Honnêtes gens und die Salons: Zur Sprachdiskussion im Frankreich des 17. Jahrhunderts, in: Romanistik in Geschichte und Gegenwart (2,2), Hamburg 1996, S. 213. Im Folgenden: BAGOLA 1996.
[8] Vgl.: Böhmer, Ursula: Konversation und Literatur: zur Rolle der Frau im französischen Salon des 18. Jahrhunderts, in: Baader, Renate/Fricke, Dietmar(Hg.): Die französische Autorin vom Mittelalter bis zur Gegenwart, Wiesbaden 1976, S.112/113.
[9] Vgl.: BAGOLA 1996: S. 213/214.
[10] Vgl.: Seifert, C. Lewis: Entre l‘écrit et l‘orale: la réception des contes de fées ‚classiques‘, in Defrance, Anne/Perrin, Jean-François: Le conte en ses paroles: la figuration de l‘oralité dans le conte merveilleux du Classicisme aux Lumières, Paris 2007, S. 21-33.
[11] Die Frauenkataloge des 17. Jahrhunderts sind im Zuge der europäischen Querelle des Femmes entstanden und enthalten eine Auflistung herausragender Frauengestalten der Antike, Bibel und Frühgeschichte. Vgl.: BÖHM 2003: S. 50.
[12] Detaillierte Angaben zu den Erscheinungsdaten der Buchankündigungen von Mme d’Aulnoy in den genannten Monatschriften finden sich bei: BÖHM 2003: S. 52.
[13] In: BÖHM 2003: S. 50.
[14] Vgl.: BÖHM 2003: S. 50-67.
[15] 1599 von Montsignore Federico Cornaro gegründet, wurde die Accademia di Ricovrati von einem Neffen des papstes Clemens VIII. protegiert. Berühmte Personen wie Galileo Galilei gehörten ihr an. Während des 17. Jahrhunderts besaß sie ein derartiges Renommee, dass zahlreiche Gelehrte und Schriftsteller um Mitgliedschaft ersuchten. Vgl. Di Scanno, Teresa: Les contes de fées à l’époque classique (1680-1715), Neapel 1975, S.117.
[16] In: BÖHM 2003: S. 51.
[17] Vgl.: BÖHM 2003: S. 52.
[18] In: BAADER 1986: S. 231.
[19] In: Mercure galant, décembre 1691, S. 276 zitiert aus: BÖHM 2003: S. 55.
Häufig gestellte Fragen
Wer war Madame d’Aulnoy?
Sie war eine bedeutende französische Schriftstellerin des 17. Jahrhunderts und gilt als Pionierin des literarischen Feenmärchens (Contes de fées).
Wo entstanden die französischen Feenmärchen?
Sie entstanden in den preziösen Salons der mondänen Gesellschaft, in denen Frauen literarische Zirkel organisierten.
Was unterscheidet d’Aulnoys Märchen von denen Perraults?
Während Perrault oft pädagogische Moral betonte, sind d’Aulnoys Werke komplexer, spielen mit Geschlechterrollen und spiegeln preziöse Ideale wider.
Welche Rolle spielten die Salonièren?
Die Salonièren waren gebildete Frauen, die den kulturellen Diskurs prägten und Märchen als Bühne für sprachliche Perfektion und gesellschaftliche Kritik nutzten.
Warum sank das Interesse an d’Aulnoys Märchen später?
Mit dem Verschwinden der Salonkultur ging der Wiedererkennungseffekt für die zeitgenössischen Anspielungen verloren, und moralischere Versionen (wie Perrault) wurden bevorzugt.
- Quote paper
- Jennifer Heider (Author), 2008, Die "Contes de fées" von Mme d'Aulnoy, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/117787