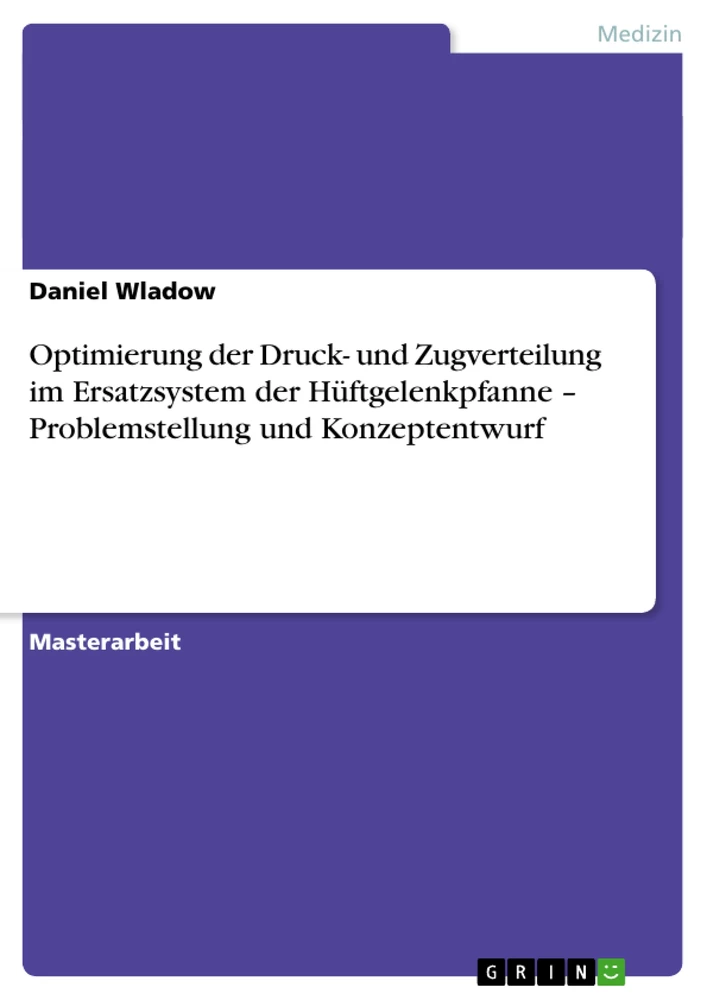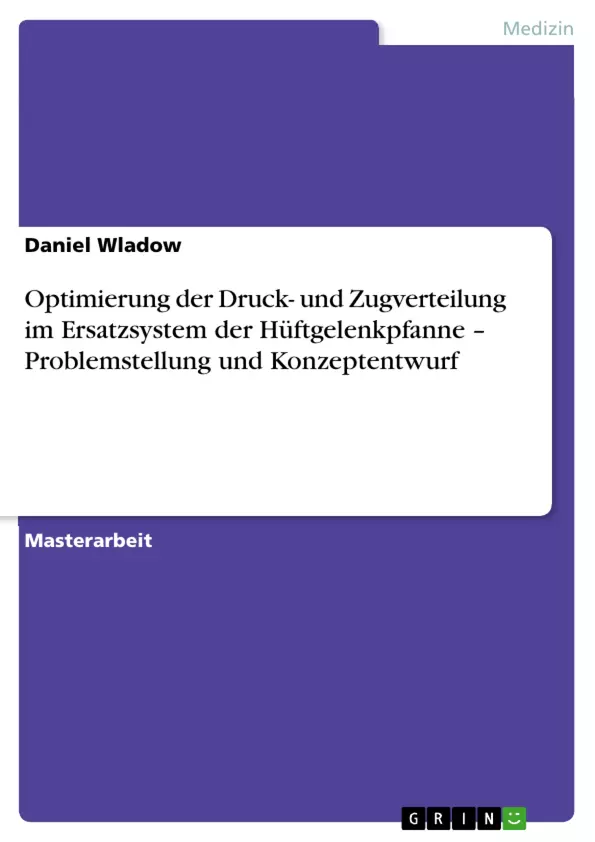In Deutschland erhalten jährlich rund 200.000 Menschen ein künstliches Hüftgelenk. Das Ziel eines solchen Hüftgelenkersatzes ist eine möglichst dauerhafte und optimale Wiederherstellung der Funktion des betroffenen Gelenks, das durch Abnutzung, Fehlbildung oder Unfall geschädigt ist. Die für einen vollständigen Gelenkersatz verwendete Totalendoprothese (TEP) besteht dabei aus einer in den Beckenknochen zu implantierenden künstlichen Hüftpfanne sowie aus einer Schaftprothese mit Kugelkopf, die in den Oberschenkelknochen eingesetzt wird.
Bei der Entwicklung von künstlichen Hüftpfannen spielt die Geometrie des Hüftgelenks eine entscheidende Rolle. Da die natürliche Gelenkpfanne annähernd halbkugelförmig ist, bietet sich diese Form auch für die Implantate an. Eine höhere Stabilität im knöchernen Lager besitzen hingegen andere Pfannenformen. Das verwendete Material und die Beschaffenheit der Schalenoberfläche sind nur zwei von vielen weiteren Faktoren, die einen Einfluss auf die Langzeitstabilität von künstlichen Hüftpfannen haben. Nicht zuletzt ist auch die Kinematik der Pfannenschale, d. h. ihre Implantationsrichtung für eine optimale Fixierung des orthopädischen Knochenimplantats und einen ausreichenden Bewegungsumfang im künstlichen Hüftgelenk von Bedeutung.
Die Arbeit beschäftigt sich mit den zahlreichen Einflussfaktoren auf künstliche Hüftpfannen. Dies soll einen Aufschluss über Stabilitätskriterien des Hüftgelenkersatzes geben, die im Optimierungsprozess von künstlichen Hüftpfannen von Bedeutung sein können. Neben der ausführlichen Problemstellung wird ein Konzeptentwurf für eine Optimierung der Druck- und Zugverteilung im Ersatzsystem der Hüftgelenkpfanne ausgearbeitet und vorgestellt. Zunächst wird der aktuelle Stand der Technik für zementierte und zementfrei zu implantierende Hüftpfannen beschrieben. Anschließend wird die Arbeitshypothese formuliert und anhand eines Ordnungsschemas am Beispiel von zwei zuvor als wesentlich ermittelten Einflussfaktoren begründet. In Anforderungslisten werden zudem einige Forderungen und Wünsche für modulare Pressfit- und Schraubpfannen festgelegt.
Die Ergebnisse der Arbeit fließen im Rahmen des Projektes RomEo, an dem die Helmut-Schmidt-Universität und das Berufsgenossenschaftliche Unfallkrankenhaus Hamburg beteiligt sind, in ein Teilprojekt zur Optimierung und Weiterentwicklung des Hüftgelenkersatzes ein.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Anatomie und Histologie
- 2.1 Stützgewebe
- 2.1.1 Knorpelgewebe
- 2.1.2 Knochengewebe
- 2.1.3 Vergleich Knochen – Knorpel
- 2.2 Muskelgewebe
- 2.2.1 Glattes Muskelgewebe
- 2.2.2 Quergestreiftes Muskelgewebe
- 2.3 Achsen, Ebenen und Orientierungsbezeichnungen
- 2.3.1 Körperachsen und Körperebenen
- 2.3.2 Lage- und Richtungsbezeichnungen
- 2.3.3 Bewegungsrichtungen des Rumpfes und der Extremitäten
- 2.4 Anatomie des Hüftgelenks
- 2.4.1 Gelenkpfanne
- 2.4.2 Gelenkkopf
- 2.4.3 Ausrichtung des Gelenks
- 2.4.4 Gelenkkapsel
- 2.4.5 Mechanik
- 2.4.6 Gefäßversorgung
- 2.4.7 Innervation
- 2.5 Ärztliche Topographie und Zugänglichkeit
- 2.1 Stützgewebe
- 3. Werkstoffe und Hüftpfannen
- 3.1 Werkstoffe
- 3.1.1 Metalle
- 3.1.2 Keramiken
- 3.1.3 Kunststoffe
- 3.2 Werkstoffeignung
- 3.2.1 Anforderungen an Implantate
- 3.2.2 Anforderungen an Implantatwerkstoffe
- 3.2.3 Gestaltungseinfluss
- 3.2.4 Beurteilung
- 3.2.5 Ergebnisse
- 3.3 Hüftpfannen
- 3.3.1 Zementierte Hüftpfannen
- 3.3.2 Zementfreie Hüftpfannen
- 3.3.3 Material und Oberfläche
- 3.3.4 Osseointegration
- 3.3.5 Ergebnisse
- 3.1 Werkstoffe
- 4. Biomechanik
- 4.1 Kontaktkraft im Hüftgelenk
- 4.1.1 Das Rechenmodell von Pauwels
- 4.1.2 Einfluss von Anatomie und Muskelfunktion auf die Kontaktkraft
- 4.2 Gelenkdruck
- 4.3 Knochenumbau
- 4.4 Endoprothesen
- 4.5 Belastung des Hüftgelenks bei komplexen Aktivitäten
- 4.5.1 Kraftberechnung
- 4.5.2 Kraftmessung
- 4.5.3 Spannungsberechnung
- 4.6 In vivo wirkende Kräfte im Hüftgelenk
- 4.6.1 Stehen
- 4.6.2 Gehen und Joggen
- 4.6.3 Treppensteigen
- 4.6.4 Aufstehen und Hinsetzen
- 4.6.5 Kniebeugen
- 4.6.6 Krankengymnastik
- 4.6.7 Gehen mit Unterarmgehstützen
- 4.6.8 Stolpern
- 4.6.9 Fahrrad fahren
- 4.6.10 Einfluss von Schuhwerk und Bodenmaterial
- 4.6.11 Belastungsrichtungen
- 4.6.12 Drehbelastung von Hüftimplantaten
- 4.7 Erwärmung von Hüftimplantaten
- 4.8 Bewegungsumfang
- 4.8.1 Implantatposition
- 4.8.2 Implantatdesign
- 4.8.3 Ergebnisse
- 4.1 Kontaktkraft im Hüftgelenk
- 5. Konzeptentwurf
- 5.1 Stand der Technik
- 5.1.1 Zementierte Hüftpfannen
- 5.1.2 Zementfreie Hüftpfannen
- 5.2 Optimierung der Druck- und Zugverteilung
- 5.2.1 Arbeitshypothese
- 5.2.2 Einflussfaktoren
- 5.2.3 Ordnungsschema am Beispiel von zwei Einflussfaktoren
- 5.2.4 Anforderungslisten
- 5.1 Stand der Technik
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Masterarbeit zielt darauf ab, die zahlreichen Einflussfaktoren auf künstliche Hüftpfannen zu untersuchen und ein Konzept für die Optimierung der Druck- und Zugverteilung im Ersatzsystem der Hüftgelenkpfanne zu entwickeln. Die Arbeit soll Aufschluss über Stabilitätskriterien geben, die im Optimierungsprozess von Bedeutung sind.
- Anatomie und Histologie des Hüftgelenks
- Werkstoffe und ihre Eignung für Hüftpfannen
- Biomechanik des Hüftgelenks und die im Gelenk wirkenden Kräfte
- Optimierung der Druck- und Zugverteilung im Hüftgelenkersatz
- Konzeptentwurf für modulare Hüftpfannen
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik des Hüftgelenkersatzes ein, beschreibt die Problemstellung der aseptischen Prothesenlockerung und die Bedeutung der Geometrie und Werkstoffauswahl bei der Entwicklung künstlicher Hüftpfannen. Sie gibt einen Überblick über die Struktur der Arbeit und die Einbindung der Ergebnisse in das Projekt RomEo.
2. Anatomie und Histologie: Dieses Kapitel beschreibt detailliert die Anatomie und Histologie des Hüftgelenks, einschließlich der Stütz- und Muskelgewebe, sowie Achsen, Ebenen und Orientierungsbezeichnungen. Es behandelt die Anatomie des Hüftgelenks selbst, die Gelenkpfanne, den Gelenkkopf, die Gelenkkapsel, die Mechanik des Gelenks, sowie die Gefäßversorgung und Innervation. Abschließend wird die ärztliche Topographie und Zugänglichkeit des Gelenks diskutiert.
3. Werkstoffe und Hüftpfannen: Dieses Kapitel befasst sich mit den Werkstoffen und den verschiedenen Arten von Hüftpfannen. Es werden Metalle (wie Titan und seine Legierungen, Cobalt-Chrom-Molybdän), Keramiken und Kunststoffe (wie Polyethylen) hinsichtlich ihrer Eignung für Hüftpfannen bewertet. Die Anforderungen an Implantate und Implantatwerkstoffe, der Einfluss der Gestaltung auf die Werkstoffeignung sowie eine Beurteilung verschiedener Werkstoffe und die Ergebnisse dieser Beurteilung werden detailliert dargestellt. Schließlich werden zementierte und zementfreie Hüftpfannen, ihr Material, ihre Oberfläche und die Osseointegration behandelt. Die Ergebnisse verschiedener Pfannentypen werden zusammengefasst.
4. Biomechanik: Dieses Kapitel behandelt die Biomechanik des Hüftgelenks, inklusive der Kontaktkraft, des Gelenkdrucks, des Knochenumbaus und der Belastung des Hüftgelenks bei verschiedenen Aktivitäten. Es beschreibt das Rechenmodell von Pauwels, den Einfluss von Anatomie und Muskelfunktion auf die Kontaktkraft, die Kraftmessung mit instrumentierten Endoprothesen und die Spannungsberechnung mittels Finite-Elemente-Methode (FEM). Die In-vivo-Kräfte bei verschiedenen Aktivitäten (Stehen, Gehen, Joggen, Treppensteigen, Aufstehen/Hinsetzen, Kniebeugen, Krankengymnastik, Stolpern, Fahrradfahren) sowie der Einfluss von Schuhwerk und Bodenmaterial werden analysiert. Die Belastungsrichtungen und die Drehbelastung von Hüftimplantaten werden ebenfalls diskutiert, ebenso wie die Erwärmung der Implantate und der Bewegungsumfang.
5. Konzeptentwurf: Dieses Kapitel präsentiert den Konzeptentwurf zur Optimierung der Druck- und Zugverteilung im Ersatzsystem der Hüftgelenkpfanne. Es beginnt mit einer Beschreibung des aktuellen Stands der Technik für zementierte und zementfreie Hüftpfannen. Anschließend wird die Arbeitshypothese formuliert und mit einem Ordnungsschema belegt, welches verschiedene Einflussfaktoren und deren Kombinationen darstellt. Schließlich werden Anforderungslisten für modulare Pressfit- und Schraubpfannen erstellt, die Forderungen und Wünsche für die Gestaltung und Materialauswahl enthalten.
Schlüsselwörter
Hüftgelenkersatz, Hüftgelenkpfanne, Druckverteilung, Zugverteilung, Biomechanik, Implantatwerkstoffe, Titan, Keramik, Polyethylen, Osseointegration, Pressfitpfanne, Schraubpfanne, Kontaktkraft, Gelenkdruck, Knochenumbau, Bewegungsumfang, Range of Motion (ROM), Impingement, Luxation, Finite-Element-Methode (FEM), präoperative Planung (POP), Projekt RomEo.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Masterarbeit: Optimierung der Druck- und Zugverteilung in künstlichen Hüftpfannen
Was ist das Thema der Masterarbeit?
Die Masterarbeit befasst sich mit der Optimierung der Druck- und Zugverteilung in künstlichen Hüftpfannen. Sie untersucht die zahlreichen Einflussfaktoren auf künstliche Hüftpfannen und entwickelt ein Konzept zur Verbesserung der Druck- und Zugverteilung im Ersatzsystem der Hüftgelenkpfanne. Ein Schwerpunkt liegt auf der Ermittlung relevanter Stabilitätskriterien im Optimierungsprozess.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel: Einleitung, Anatomie und Histologie des Hüftgelenks, Werkstoffe und Hüftpfannen, Biomechanik des Hüftgelenks und Konzeptentwurf zur Optimierung. Jedes Kapitel behandelt spezifische Aspekte, die für die Entwicklung optimierter Hüftpfannen relevant sind.
Was wird im Kapitel "Anatomie und Histologie" behandelt?
Dieses Kapitel beschreibt detailliert die Anatomie und Histologie des Hüftgelenks, einschließlich Stütz- und Muskelgewebe, Achsen, Ebenen und Orientierungsbezeichnungen. Es analysiert die Anatomie des Hüftgelenks selbst (Gelenkpfanne, Gelenkkopf, Gelenkkapsel, Mechanik, Gefäßversorgung, Innervation) und die ärztliche Topographie und Zugänglichkeit.
Welche Werkstoffe werden im Kapitel "Werkstoffe und Hüftpfannen" betrachtet?
Das Kapitel bewertet Metalle (Titanlegierungen, Cobalt-Chrom-Molybdän), Keramiken und Kunststoffe (Polyethylen) hinsichtlich ihrer Eignung für Hüftpfannen. Es untersucht Anforderungen an Implantate und Werkstoffe, den Einfluss der Gestaltung und die Ergebnisse verschiedener Materialtests. Zementierte und zementfreie Hüftpfannen, deren Material, Oberfläche und Osseointegration werden ebenfalls behandelt.
Was sind die Schwerpunkte des Kapitels "Biomechanik"?
Das Kapitel behandelt die Biomechanik des Hüftgelenks, inklusive Kontaktkraft, Gelenkdruck, Knochenumbau und Belastung bei verschiedenen Aktivitäten (Stehen, Gehen, Joggen, Treppensteigen etc.). Es beschreibt das Rechenmodell von Pauwels, den Einfluss von Anatomie und Muskelfunktion, Kraftmessung, Spannungsberechnung mittels FEM und die Analyse von In-vivo-Kräften unter verschiedenen Belastungen. Die Erwärmung von Implantaten und der Bewegungsumfang werden ebenfalls diskutiert.
Was beinhaltet der "Konzeptentwurf"?
Der Konzeptentwurf präsentiert ein Konzept zur Optimierung der Druck- und Zugverteilung im Hüftgelenkersatz. Er beginnt mit dem Stand der Technik (zementierte und zementfreie Pfannen) und formuliert eine Arbeitshypothese. Ein Ordnungsschema zeigt Einflussfaktoren und deren Kombinationen. Schließlich werden Anforderungslisten für modulare Pressfit- und Schraubpfannen erstellt.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter umfassen Hüftgelenkersatz, Hüftgelenkpfanne, Druck- und Zugverteilung, Biomechanik, Implantatwerkstoffe (Titan, Keramik, Polyethylen), Osseointegration, Pressfit- und Schraubpfannen, Kontaktkraft, Gelenkdruck, Knochenumbau, Bewegungsumfang (ROM), Impingement, Luxation, FEM, präoperative Planung (POP) und Projekt RomEo.
Welche Zielsetzung verfolgt die Masterarbeit?
Die Masterarbeit zielt darauf ab, die Einflussfaktoren auf künstliche Hüftpfannen zu untersuchen und ein Konzept zur Optimierung der Druck- und Zugverteilung im Hüftgelenkersatz zu entwickeln. Sie soll Aufschluss über Stabilitätskriterien geben, die im Optimierungsprozess von Bedeutung sind.
- Quote paper
- Daniel Wladow (Author), 2007, Optimierung der Druck- und Zugverteilung im Ersatzsystem der Hüftgelenkpfanne – Problemstellung und Konzeptentwurf, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/117799