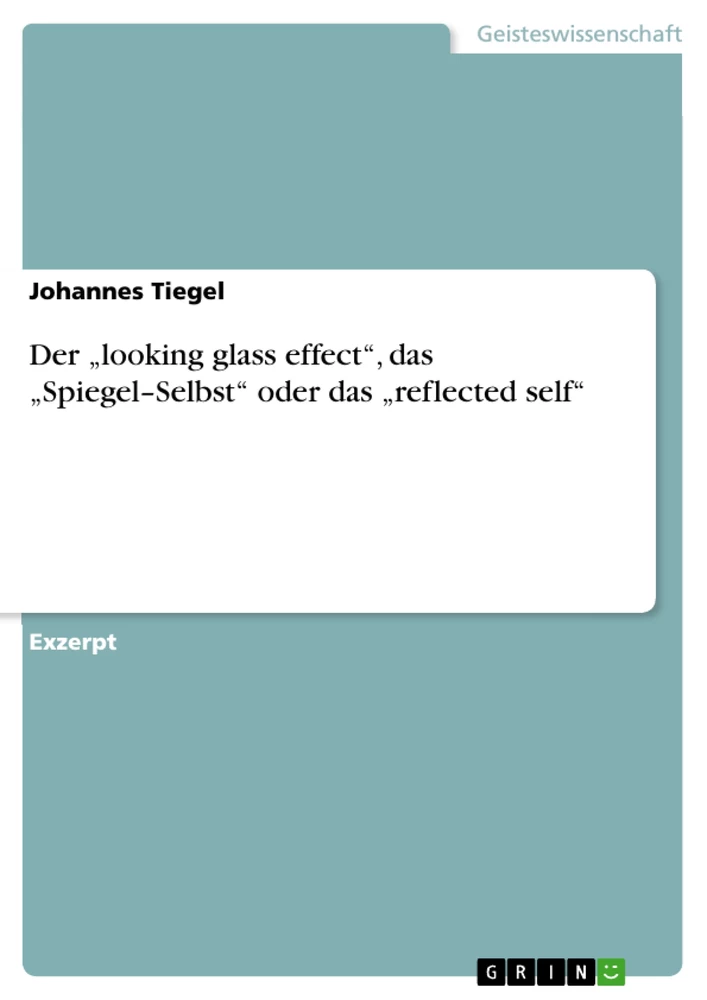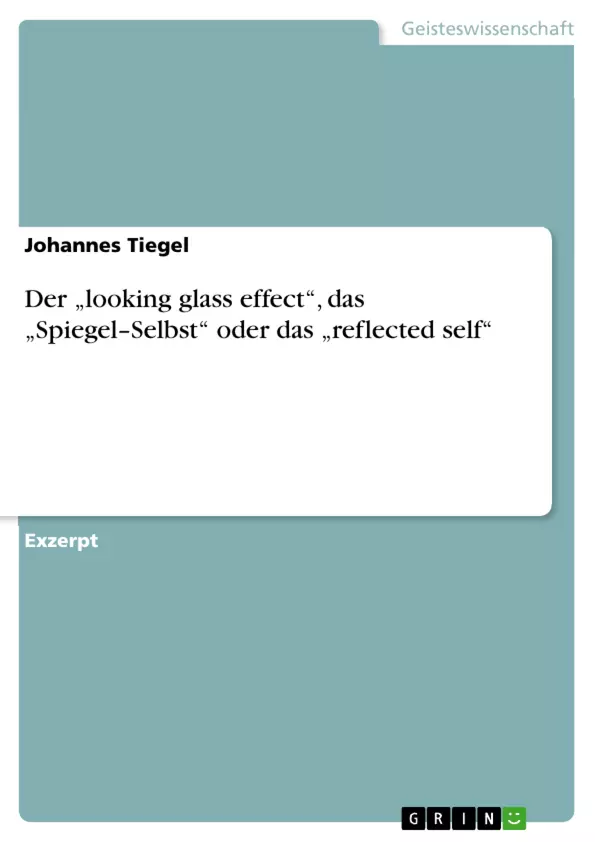Dieser Essay behandelt das Thema : Der „looking glass effect“ , das „Spiegel – Selbst“ oder das „reflected self“
Inhaltsverzeichnis
- Der „looking glass effect“
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit dem „looking glass effect“, einem zentralen Konzept der interpretativen Soziologie. Ziel ist es, Cooley's Theorie des „Spiegel-Selbst“ zu erläutern und seine Bedeutung für die Selbstentwicklung zu verdeutlichen.
- Cooleys Konzept des „Spiegel-Selbst“
- Die drei Prozesse des „looking glass effect“
- Der Einfluss des „looking glass effect“ auf die Selbstentwicklung
- Der Unterschied zwischen „looking glass effect“ und „taking the role of the other“
- Der „looking glass effect“ im Kontext des symbolischen Interaktionismus
Zusammenfassung der Kapitel
Der „looking glass effect“: Der Text beschreibt den „looking glass effect“, wie er von Charles Horton Cooley in seinem Werk „Human Nature and the social Order“ entwickelt wurde. Cooley baut auf William James' Konzept des „Selbst“ auf, wobei die Person sich selbst als Objekt ihrer Wahrnehmung und Bewertung begreift. Der „looking glass effect“ besagt, dass wir uns in die Gedanken anderer hineinversetzen, um uns selbst zu sehen und zu beurteilen. Dies geschieht in drei Schritten: Wir bilden uns eine Vorstellung davon, wie wir auf andere wirken; wir schätzen ab, wie andere unser Verhalten beurteilen; und schließlich nehmen wir eine emotionale Haltung zu diesen Vorstellungen ein. Die Reaktionen unserer Mitmenschen spiegeln unser Verhalten wider und prägen unser Selbstverständnis. Dieser Lernprozess ist besonders in der frühen Kindheit wichtig, wo das Kind lernt, sein Handeln aus der Perspektive anderer, beispielsweise der Mutter, zu sehen und zu beurteilen. Der „looking glass effect“ verdeutlicht, dass gleiche Handlungen unterschiedliche Reaktionen hervorrufen können und dass Individuen aktiv Rollen einnehmen und dadurch die Reaktionen anderer beeinflussen können. Im Gegensatz zu „taking the role of the other“ konzentriert sich der „looking glass effect“ auf die Beobachtung der Reaktionen der anderen auf das eigene Verhalten, ohne diese Rolle explizit zu übernehmen. Das Selbst entsteht durch ein Wechselspiel interpersoneller Wahrnehmungsvorgänge, wobei jeder Einzelne jedem anderen als Spiegel dient. Die wechselseitige Beeinflussung und die aktive Gestaltung der Umwelt durch das Individuum ordnen diesen Ansatz dem symbolischen Interaktionismus zu.
Schlüsselwörter
Looking glass effect, Spiegel-Selbst, reflected self, Charles Horton Cooley, William James, Social Self, Selbstentwicklung, symbolischer Interaktionismus, interpersonelle Wahrnehmung, Rollenübernahme.
Häufig gestellte Fragen zum Text: Der „Looking Glass Effect“
Was ist der Inhalt des Textes?
Der Text bietet eine umfassende Übersicht über den „Looking Glass Effect“ (Spiegel-Selbst), ein zentrales Konzept der interpretativen Soziologie. Er erläutert Cooley's Theorie, beschreibt die drei Prozesse des „Looking Glass Effect“, seinen Einfluss auf die Selbstentwicklung und den Unterschied zu „Taking the Role of the Other“. Der Kontext des symbolischen Interaktionismus wird ebenfalls beleuchtet.
Wer ist der Autor der Theorie des „Looking Glass Effect“?
Die Theorie des „Looking Glass Effect“ wurde von Charles Horton Cooley in seinem Werk „Human Nature and the social Order“ entwickelt. Sie baut auf William James' Konzept des „Selbst“ auf.
Was ist der „Looking Glass Effect“?
Der „Looking Glass Effect“ beschreibt den Prozess, wie wir uns selbst wahrnehmen und beurteilen, indem wir die Reaktionen anderer auf unser Verhalten interpretieren. Wir bilden uns eine Vorstellung davon, wie wir auf andere wirken, schätzen deren Bewertung unseres Verhaltens ab und entwickeln daraus eine emotionale Haltung zu uns selbst. Unsere Selbstwahrnehmung ist also ein Spiegelbild der Reaktionen unserer Umwelt.
Welche drei Prozesse beinhaltet der „Looking Glass Effect“?
Der „Looking Glass Effect“ besteht aus drei Schritten: 1. Wir imaginieren, wie wir auf andere wirken; 2. Wir interpretieren die Bewertung unseres Verhaltens durch andere; 3. Wir entwickeln eine emotionale Reaktion auf diese Bewertung, die unser Selbstbild prägt.
Wie beeinflusst der „Looking Glass Effect“ die Selbstentwicklung?
Der „Looking Glass Effect“ ist besonders wichtig in der frühen Kindheit. Kinder lernen, ihr Handeln aus der Perspektive anderer zu sehen und zu beurteilen, was ihr Selbstverständnis maßgeblich prägt. Der Prozess ist ein lebenslanger Lernprozess, der unser Selbstbild ständig beeinflusst.
Was ist der Unterschied zwischen „Looking Glass Effect“ und „Taking the Role of the Other“?
Während „Taking the Role of the Other“ die aktive Übernahme der Perspektive anderer beinhaltet, konzentriert sich der „Looking Glass Effect“ auf die Beobachtung der Reaktionen anderer auf das eigene Verhalten, ohne diese Rolle explizit einzunehmen. Es geht um die Interpretation der Reaktionen, nicht um die aktive Perspektivübernahme.
Welchen Platz nimmt der „Looking Glass Effect“ im symbolischen Interaktionismus ein?
Der „Looking Glass Effect“ wird dem symbolischen Interaktionismus zugeordnet, da er die wechselseitige Beeinflussung zwischen Individuen und die aktive Gestaltung der Umwelt durch das Individuum betont. Das Selbst entsteht durch ein ständiges Wechselspiel interpersoneller Wahrnehmungsvorgänge.
Welche Schlüsselwörter sind mit dem „Looking Glass Effect“ verbunden?
Schlüsselwörter sind: Looking glass effect, Spiegel-Selbst, reflected self, Charles Horton Cooley, William James, Social Self, Selbstentwicklung, symbolischer Interaktionismus, interpersonelle Wahrnehmung, Rollenübernahme.
- Arbeit zitieren
- Johannes Tiegel (Autor:in), 2008, Der „looking glass effect“, das „Spiegel–Selbst“ oder das „reflected self“, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/117893