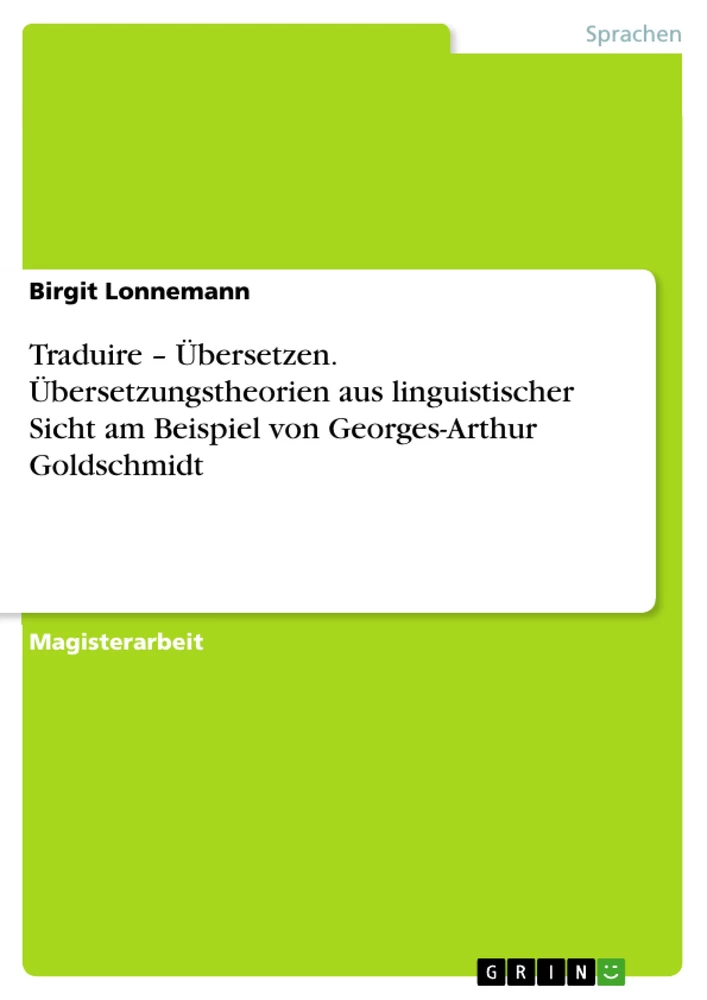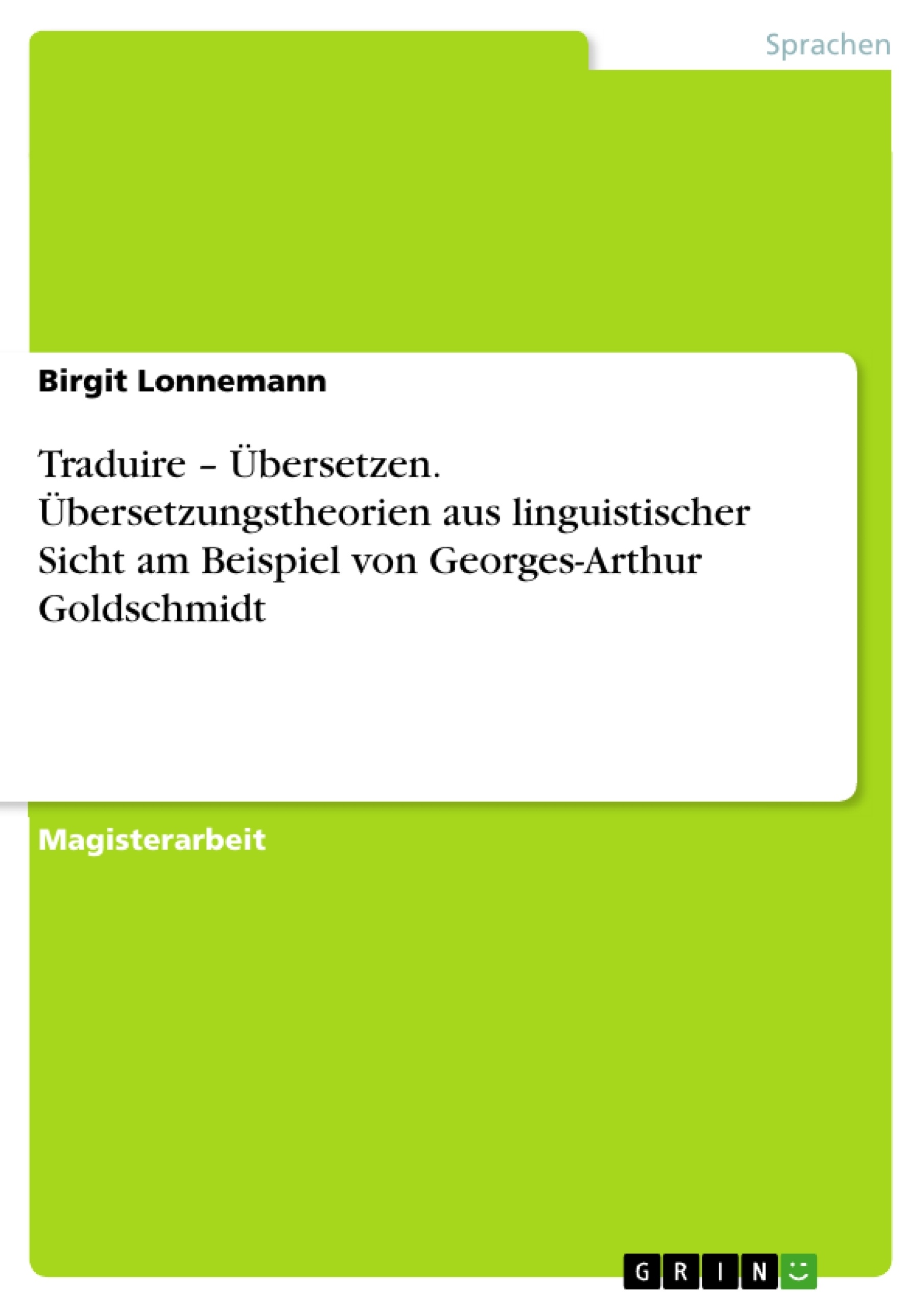Als Gegenstand der Übersetzungswissenschaft dient – wie der Name schon sagt – die Übersetzung. Im Deutschen und im Französischen, den beiden Sprachen, mit denen ich mich vorwiegend befasse, sind die Begriffe Übersetzung bzw. traduction doppeldeutig. Diese werden einerseits zur Bezeichnung des Prozesses, andererseits zur Bezeichnung des Produktes verwendet. Für die Übersetzungswissenschaft bedeutet dies, dass sie zum einen eine prospektive Wissenschaft ist, die Prozessforschung betreibt, zum anderen eine retrospektive, die sich mit Ergebnisforschung befasst.
Da sich Übersetzungen nicht durch den bloßen Austausch von Wörtern verschiedener Sprachen bewerkstelligen lassen, sondern neben Denotationen und Konnotationen auch kultur- oder regionalspezifische Bedeutungen von Wörtern, Polysemien und Falsche Freunde zu bedenken sind, wundert es nicht, dass immer wieder Neuübersetzungen angefertigt werden, die die Frage nach dem Unterschied zwischen ewig jungen Originalen einerseits und alternden Übersetzungen andererseits aufwerfen.
Im ersten Teil meiner Arbeit widme ich mich in erster Linie den Übersetzungstheorien, um einen theoretischen Rahmen für den zweiten Teil meiner Arbeit abstecken zu können. Dort steht Georges-Arthur Goldschmidts Übersetzung von Kafkas Proceß im Vordergrund. Sie dient, im Vergleich mit weiteren Übersetzungen, als Grundlage für die Erstellung eines semantischen Netzes nach Gerzymisch-Arbogast & Mudersbach (1998).
Inhaltsverzeichnis
- Vorwort
- Abbildungsverzeichnis
- 1. Einleitung
- Teil I
- 2. Definitionen
- 3. Geschichtliches – Herausbildung übersetzerischer Grundkonzeptionen
- 3.1 Die Anfänge
- 3.2 Die Antike: Herausbildung der Dichotomie frei vs. wörtlich
- 3.3 Die Renaissance: Herausbildung der Dichotomien Einbürgerung vs. Verfremdung und Übersetzung vs. Bearbeitung
- 3.4 Die Romantik: Herausbildung der Dichotomie Geringschätzung vs. Hochschätzung des Übersetzers
- 3.5 Die Klassik: Herausbildung der Dichotomie Übersetzbarkeit vs. Unübersetzbarkeit
- 3.6 Der Beginn des zwanzigsten Jahrhunderts: Herausbildung der Dichotomie: Alternde Übersetzungen vs. ewig junge Originale
- 4. Übersetzungstheorien
- 4.1 Den Transfer im Blickfeld
- 4.2 Das Sprachenpaar im Blickfeld
- 4.3 Den Text im Blickfeld
- 4.4 Das Handeln im Blickfeld
- 4.5 Den Übersetzer im Blickfeld
- 4.6 Die Methode im Blickfeld
- 4.7 Die Disziplin im Blickfeld
- 4.8 Fazit
- Teil II
- 5. Begründung der Textauswahl
- 6. Georges-Arthur Goldschmidt: Leben und Werk
- 6.1 Stammbaum
- 6.2 Biographie
- 6.3 Werke
- 7. Georges-Arthur Goldschmidt – der „Komplize des Autors“
- 8. Bernard Lortholary – der „Anwalt des Lesers“
- 9. Franz Kafka im Spiegel der Übersetzungen
- 9.1 Sprachliche Besonderheiten bei Franz Kafka
- 9.2 Franz Kafka und seine französischen Übersetzer Goldschmidt und Lortholary
- 9.2.1 Franz Kafka und Georges-Arthur Goldschmidt
- 9.2.2 Franz Kafka und Bernard Lortholary
- 10. Inhalt des Romans Der Proceß
- 11. Übersetzungsanalyse
- 11.1 Syntax
- 11.2 Lexik
- 11.3 Wiederholungen
- 11.4 Partikeln
- 11.5 Auswertung der Analyseergebnisse
- 12. Semantisches Netz
- 13. Schlussbemerkung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Magisterarbeit untersucht Übersetzungstheorien aus linguistischer Perspektive, anhand des Beispiels von Georges-Arthur Goldschmidts Übersetzungen von Franz Kafka. Die Arbeit zielt darauf ab, verschiedene Übersetzungstheorien zu beleuchten und deren Anwendung in der Praxis zu analysieren. Die Analyse fokussiert sich auf Goldschmidts Übersetzungsentscheidungen und deren linguistische Grundlage.
- Linguistische Analyse von Übersetzungstheorien
- Fallstudie: Georges-Arthur Goldschmidt und seine Kafka-Übersetzungen
- Vergleichende Analyse verschiedener Übersetzungsphilosophien
- Der Einfluss linguistischer Faktoren auf die Übersetzung
- Die Rolle des Übersetzers im Übersetzungsprozess
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema der Arbeit ein und beschreibt die Zielsetzung und den methodischen Ansatz. Es wird die Relevanz der linguistischen Betrachtungsweise bei der Übersetzungstheorie betont und die Auswahl von Georges-Arthur Goldschmidt als Fallbeispiel begründet.
2. Definitionen: Dieses Kapitel klärt zentrale Begriffe, wie „Traduire“ und „Übersetzen“, und legt die Grundlage für die nachfolgende Diskussion der Übersetzungstheorien. Es unterscheidet verschiedene Übersetzungstypen und -ansätze.
3. Geschichtliches – Herausbildung übersetzerischer Grundkonzeptionen: Dieses Kapitel bietet einen historischen Überblick über die Entwicklung übersetzerischer Konzepte von den Anfängen bis ins 20. Jahrhundert. Es werden die wichtigsten Dichotomien in der Übersetzungsgeschichte herausgearbeitet, z.B. die Debatte um wörtliche vs. freie Übersetzung, Einbürgerung vs. Verfremdung, und die Bewertung des Übersetzers selbst. Die Entwicklung der jeweiligen Diskurse wird detailliert nachgezeichnet.
4. Übersetzungstheorien: Hier werden verschiedene Übersetzungstheorien aus linguistischer Sicht präsentiert und analysiert. Es werden verschiedene Modelle und Ansätze zur Beschreibung des Übersetzungsprozesses vorgestellt und kritisch bewertet, wobei der Fokus auf dem Transfer, dem Sprachenpaar, dem Text, dem Handeln, dem Übersetzer selbst und der angewendeten Methode liegt. Der Einfluss verschiedener linguistischen Theorien und Modelle wird erörtert.
5. Begründung der Textauswahl: Dieses Kapitel rechtfertigt die Wahl von Goldschmidts Übersetzungen als Fallbeispiel für die Arbeit. Es werden die Gründe für die Auswahl von Goldschmidt und Kafkas Werk als Untersuchungsobjekte erläutert.
6. Georges-Arthur Goldschmidt: Leben und Werk: Dieses Kapitel skizziert Leben und Werk des Übersetzers Georges-Arthur Goldschmidt. Es werden biografische Details, der familiäre Hintergrund sowie sein Gesamtwerk betrachtet und in den Kontext seines Übersetzungsansatzes eingeordnet.
7. Georges-Arthur Goldschmidt – der „Komplize des Autors“: Dieses Kapitel untersucht Goldschmidts Übersetzungsansatz und charakterisiert ihn als „Komplizen des Autors“. Es werden seine Übersetzungsstrategien analysiert und mit Bezug auf seine Biografie erläutert.
8. Bernard Lortholary – der „Anwalt des Lesers“: Dieses Kapitel stellt den Übersetzer Bernard Lortholary vor und beschreibt seinen Übersetzungsansatz im Vergleich zu dem Goldschmidts. Die unterschiedlichen Herangehensweisen werden gegeneinander abgewogen.
9. Franz Kafka im Spiegel der Übersetzungen: Dieses Kapitel untersucht die sprachlichen Besonderheiten von Kafkas Werk und deren Herausforderungen für die Übersetzung. Die spezifischen sprachlichen Eigenheiten Kafkas werden beleuchtet und deren Übersetzbarkeit diskutiert. Es werden die Übersetzungsstrategien von Goldschmidt und Lortholary im Umgang mit diesen Herausforderungen verglichen.
10. Inhalt des Romans Der Proceß: Hier wird der Inhalt von Kafkas "Der Proceß" zusammengefasst, um den Kontext für die folgende Übersetzungsanalyse zu schaffen.
11. Übersetzungsanalyse: Dieses Kapitel präsentiert eine detaillierte linguistische Analyse der Übersetzungen von Goldschmidt, wobei Aspekte wie Syntax, Lexik, Wiederholungen und Partikeln untersucht werden. Die Ergebnisse dieser Analyse werden ausführlich diskutiert.
12. Semantisches Netz: Hier wird ein semantisches Netz erstellt, um die Beziehungen zwischen den einzelnen Elementen im Text und in den Übersetzungen zu visualisieren und zu analysieren.
Schlüsselwörter
Übersetzungstheorien, Linguistik, Georges-Arthur Goldschmidt, Franz Kafka, Übersetzungsanalyse, „Der Proceß“, wörtliche Übersetzung, freie Übersetzung, Einbürgerung, Verfremdung, Sprachvergleich, Semantik, Syntax, Lexik.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Magisterarbeit: Übersetzungstheorien am Beispiel der Kafka-Übersetzungen von Georges-Arthur Goldschmidt
Was ist der Gegenstand dieser Magisterarbeit?
Die Magisterarbeit untersucht Übersetzungstheorien aus linguistischer Perspektive anhand der Kafka-Übersetzungen von Georges-Arthur Goldschmidt. Sie analysiert verschiedene Übersetzungstheorien und deren praktische Anwendung, fokussiert auf Goldschmidts Übersetzungsentscheidungen und deren linguistische Grundlagen.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit behandelt linguistische Analysen von Übersetzungstheorien, eine Fallstudie zu Goldschmidt und seinen Kafka-Übersetzungen, einen Vergleich verschiedener Übersetzungsphilosophien, den Einfluss linguistischer Faktoren auf die Übersetzung und die Rolle des Übersetzers im Übersetzungsprozess.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in mehrere Kapitel: Einleitung, Definitionen, historischer Überblick über die Entwicklung übersetzerischer Konzepte, Darstellung verschiedener Übersetzungstheorien, Begründung der Textauswahl (Goldschmidt und Kafka), Biographie und Werk von Georges-Arthur Goldschmidt, Analyse von Goldschmidts Übersetzungsansatz ("Komplize des Autors"), Vergleich mit dem Ansatz von Bernard Lortholary ("Anwalt des Lesers"), Analyse der sprachlichen Besonderheiten von Kafka und deren Übersetzbarkeit, Zusammenfassung des Inhalts von Kafkas "Der Prozess", detaillierte linguistische Übersetzungsanalyse (Syntax, Lexik, Wiederholungen, Partikeln), Erstellung eines semantischen Netzes und Schlussbemerkung.
Welche Methoden werden angewendet?
Die Arbeit verwendet eine linguistische Perspektive zur Analyse von Übersetzungstheorien und wendet diese auf die konkrete Fallstudie der Kafka-Übersetzungen von Goldschmidt an. Methoden umfassen die vergleichende Analyse verschiedener Übersetzungsphilosophien und eine detaillierte linguistische Analyse der Übersetzungen selbst (Syntax, Lexik, etc.). Ein semantisches Netz wird erstellt, um die Beziehungen zwischen Textelementen zu visualisieren.
Wer ist Georges-Arthur Goldschmidt?
Die Arbeit untersucht Georges-Arthur Goldschmidt als Übersetzer von Franz Kafka. Das Kapitel über Goldschmidt umfasst biografische Details, seinen familiären Hintergrund und sein Gesamtwerk, um seinen Übersetzungsansatz in den Kontext einzuordnen. Sein Ansatz wird als der eines "Komplizen des Autors" charakterisiert.
Welche Rolle spielt Bernard Lortholary in der Arbeit?
Bernard Lortholary wird als weiterer Kafka-Übersetzer vorgestellt und sein Ansatz wird im Vergleich zu dem von Goldschmidt analysiert. Sein Ansatz wird als der eines "Anwalts des Lesers" beschrieben, im Gegensatz zu Goldschmidts "Komplize des Autors". Der Vergleich der beiden Übersetzer zeigt unterschiedliche Übersetzungsstrategien auf.
Wie werden Kafkas sprachliche Besonderheiten behandelt?
Die Arbeit untersucht die sprachlichen Besonderheiten von Kafkas Werk und die Herausforderungen, die diese für die Übersetzung darstellen. Die spezifischen sprachlichen Eigenheiten Kafkas werden beleuchtet und deren Übersetzbarkeit diskutiert, wobei die Übersetzungsstrategien von Goldschmidt und Lortholary im Umgang mit diesen Herausforderungen verglichen werden.
Welche Art von linguistischer Analyse wird durchgeführt?
Die linguistische Analyse konzentriert sich auf verschiedene Ebenen der Sprache: Syntax (Satzbau), Lexik (Wortwahl), Wiederholungen und Partikeln. Die Ergebnisse dieser Analyse werden ausführlich diskutiert und helfen, die Übersetzungsentscheidungen von Goldschmidt zu verstehen.
Was ist das Ziel der Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, verschiedene Übersetzungstheorien zu beleuchten und deren Anwendung in der Praxis zu analysieren, indem sie Goldschmidts Übersetzungsentscheidungen und deren linguistische Grundlage untersucht. Sie möchte den Einfluss linguistischer Faktoren auf die Übersetzung und die Rolle des Übersetzers im Übersetzungsprozess verdeutlichen.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit am besten?
Schlüsselwörter sind: Übersetzungstheorien, Linguistik, Georges-Arthur Goldschmidt, Franz Kafka, Übersetzungsanalyse, "Der Prozess", wörtliche Übersetzung, freie Übersetzung, Einbürgerung, Verfremdung, Sprachvergleich, Semantik, Syntax, Lexik.
- Quote paper
- Dr. phil. Birgit Lonnemann (Author), 2000, Traduire – Übersetzen. Übersetzungstheorien aus linguistischer Sicht am Beispiel von Georges-Arthur Goldschmidt, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/117918