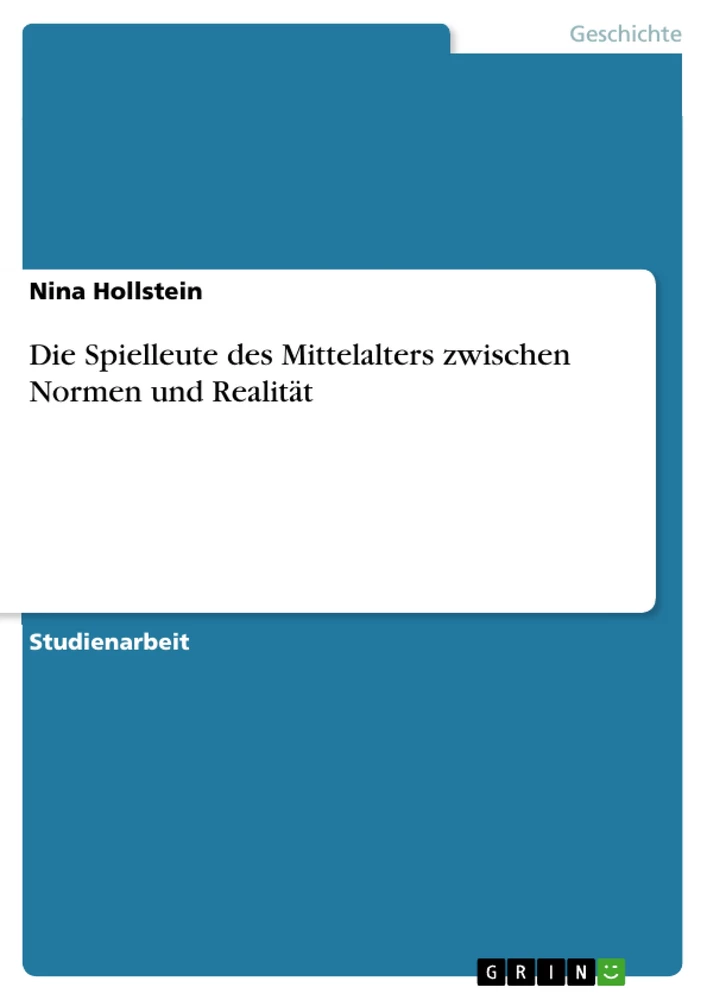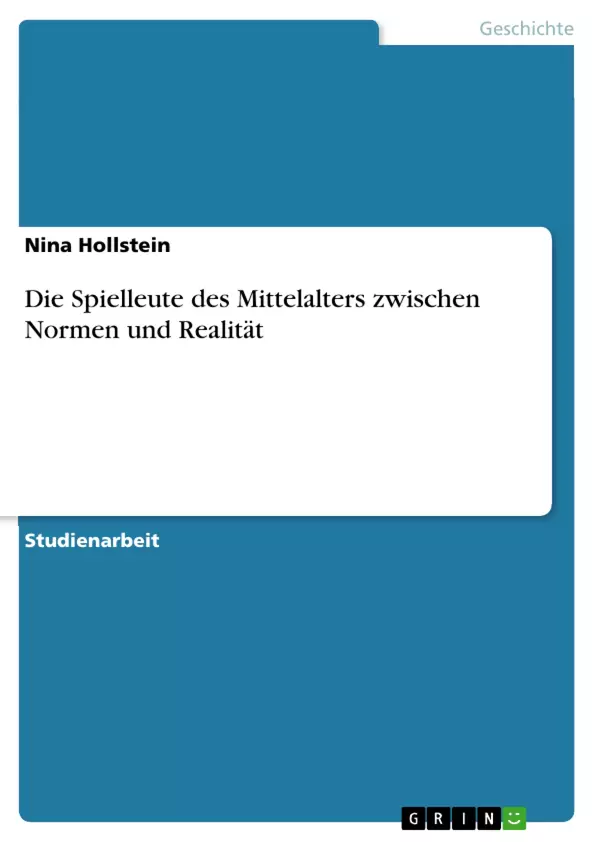Diese Arbeit beschäftigt sich mit der Randgruppe der Spielleute im Mittelalter. Im
Zuge der Literaturrecherche zu dieser Thematik und deren Bearbeitung war es
nahezu unumgänglich auf einen eklatant tiefen Widerspruch im Leben dieser
Randständigen aufmerksam zu werden:
Die Spielleute hatten ein umfassendes Repertoire an Unterhaltungskünsten zu
bieten. Mit Gesang, instrumentalen Künsten, bis hin zu Zauberkünsten und
erotischen Tänzen beeindruckten und unterhielten sie ein breites Publikum.
Erwartungsvoll, begierig und dankbar wurden diese Darbietungen von den
Zuschauern aufgenommen und mit entsprechender Anerkennung und Entlohnung
honoriert. Der gesellschaftliche Ausschluss sowie die deklassierende Stellung in der
weltlichen und kirchlichen Herrschaft stehen dem Vorangegangenen in deutlicher
Gegensätzlichkeit gegenüber.
Und genau dieser Thematik nimmt sich die vorliegende Arbeit an, indem die Kluft
zwischen der Realität und speziell den kirchlichen Normen aufgezeigt werden soll.
Die zentrale Fragestellung hierbei wird sein, welches die möglichen Motive oder die
Begründung dieses augenfälligen Widerspruchs sind.
Die Quellenlage und die Anzahl der verschiedenen Quellengattungen bezüglich
dieser Thematik sind sehr breit gefächert. Neben den Gesetzessammlungen,
Traktaten und Predigten, bieten ebenso die literarischen und historiographischen
Texte die Möglichkeit zur Beurteilung und Darstellung der Spielleute. Besonders
über die kirchlichen und weltlichen Normen berichten uns zahlreiche Quellentexte.
Genannt werden sollen hier die beiden bedeutendsten mittelalterlichen
Rechtsquellen, namentlich der Schwaben- und Sachsenspiegel. Besonders
letzterer weist laut Jürgen Brandhorst „ein hohes Maß an Übereinstimmung zwischen
der dort niedergelegten normativen Diskriminierung und der tatsächlichen
Behandlung der Spielleute“ auf.
[...]
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Das frühchristliche Erbe
- 2.1. Die „Vorfahren“ der Spielleute
- 2.2. Die Haltung der Kirchenväter
- 3. Die Spielleute im Mittelalter
- 3.1. Norm und Recht der spielmännischen Lebensform
- 3.1.1. Die Haltung der Kirche
- 3.1.2. Die Haltung der weltlichen Herrschaft
- 3.2. Realität der Lebensform
- 4. Gründe der Kluft zwischen Normen und Realität
- 5. Schlussbetrachtungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den Widerspruch zwischen der gesellschaftlichen Akzeptanz und dem gleichzeitig bestehenden gesellschaftlichen Ausschluss der Spielleute im Mittelalter. Sie beleuchtet die Kluft zwischen der Realität ihrer erfolgreichen Darbietungen und der negativen Bewertung ihrer Lebensform durch Kirche und Obrigkeit. Die zentrale Frage ist, welche Gründe für diesen Widerspruch verantwortlich sind.
- Die gesellschaftliche Stellung der Spielleute im Mittelalter
- Der Einfluss der Kirche auf die Wahrnehmung der Spielleute
- Die rechtliche Situation der Spielleute
- Der Widerspruch zwischen Normen und Realität im Leben der Spielleute
- Die historischen Ursprünge der Spielleute
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der Spielleute im Mittelalter ein und stellt die zentrale Forschungsfrage nach den Gründen für den Widerspruch zwischen ihrer gesellschaftlichen Akzeptanz aufgrund ihrer Unterhaltungskünste und ihrer gleichzeitig niedrigen sozialen Stellung und Ablehnung durch Kirche und Obrigkeit. Die Arbeit verspricht, diesen Widerspruch anhand einer breiten Quellenlage, einschließlich Rechtsquellen, Traktate und literarischer Texte, zu untersuchen.
2. Das frühchristliche Erbe: Dieses Kapitel erforscht mögliche historische Wurzeln der ambivalenten Bewertung der Spielleute. Es untersucht zwei Thesen zu ihren Vorfahren: die Abstammung von germanischen Helden- und Mythensängern (Skopen) und die Abstammung von spätantiken Schauspielern (Mimi und Histriones). Beide Thesen erklären die spätere Marginalisierung der Spielleute durch den Verlust ihrer ursprünglichen Positionen aufgrund des Aufstiegs des Christentums und des Untergangs des Römischen Reiches. Der Fokus liegt auf der Frage, ob bereits den Vorfahren der Spielleute ein Stigma der Unehrlichkeit anhaftete.
3. Die Spielleute im Mittelalter: Dieses Kapitel analysiert die normative und tatsächliche Lebensform der mittelalterlichen Spielleute. Es beleuchtet die Haltung der Kirche und der weltlichen Herrschaft gegenüber den Spielleuten, indem es Rechtsquellen wie den Schwabenspiegel und den Sachsenspiegel heranzieht, welche die Diskriminierung der Spielleute belegen. Im Gegensatz dazu wird die Realität ihrer gesellschaftlichen Akzeptanz und ihres wirtschaftlichen Erfolgs durch ihre Auftritte dargestellt. Der Widerspruch zwischen den Normen und der tatsächlichen Lebenswirklichkeit der Spielleute bildet den Kern dieses Kapitels.
Schlüsselwörter
Spielleute, Mittelalter, soziale Ungleichheit, Kirche, weltliche Herrschaft, Recht, Normen, Realität, Unterhaltungskunst, Randgruppe, Joculator, Skôp, Mimus, Histrio, Schwabenspiegel, Sachsenspiegel.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Mittelalterliche Spielleute - Ein Widerspruch zwischen Norm und Realität
Was ist der zentrale Gegenstand dieser Arbeit?
Die Arbeit untersucht den Widerspruch zwischen gesellschaftlicher Akzeptanz und Ausschluss von mittelalterlichen Spielleuten. Sie beleuchtet die Diskrepanz zwischen ihrem realen Erfolg und der negativen Bewertung ihrer Lebensform durch Kirche und Obrigkeit, und sucht nach den Ursachen dieses Widerspruchs.
Welche Aspekte werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt die gesellschaftliche Stellung der Spielleute, den Einfluss der Kirche auf deren Wahrnehmung, ihre rechtliche Situation, den Widerspruch zwischen Normen und Realität ihres Lebens und die historischen Ursprünge der Spielleute.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit und worum geht es in jedem Kapitel?
Die Arbeit besteht aus fünf Kapiteln: Kapitel 1 (Einleitung) führt in die Thematik ein und stellt die Forschungsfrage. Kapitel 2 (Das frühchristliche Erbe) erforscht die historischen Wurzeln der ambivalenten Bewertung der Spielleute, indem es deren mögliche Vorfahren (Skopen, Mimi und Histriones) untersucht. Kapitel 3 (Die Spielleute im Mittelalter) analysiert die normative und tatsächliche Lebensform der Spielleute, beleuchtet die Haltung von Kirche und Obrigkeit (unter Bezugnahme auf Rechtsquellen wie den Schwabenspiegel und Sachsenspiegel) und beschreibt die Realität ihres gesellschaftlichen Erfolgs. Kapitel 4 (Gründe der Kluft zwischen Normen und Realität) widmet sich der Analyse der Ursachen des Widerspruchs. Kapitel 5 (Schlussbetrachtungen) fasst die Ergebnisse zusammen.
Welche Quellen werden verwendet?
Die Arbeit bezieht sich auf eine breite Quellenlage, einschließlich Rechtsquellen (Schwabenspiegel, Sachsenspiegel), Traktate und literarische Texte.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit am besten?
Schlüsselwörter sind: Spielleute, Mittelalter, soziale Ungleichheit, Kirche, weltliche Herrschaft, Recht, Normen, Realität, Unterhaltungskunst, Randgruppe, Joculator, Skôp, Mimus, Histrio, Schwabenspiegel, Sachsenspiegel.
Welche Forschungsfrage steht im Mittelpunkt der Arbeit?
Die zentrale Frage ist, welche Gründe für den Widerspruch zwischen der gesellschaftlichen Akzeptanz der Spielleute aufgrund ihrer Unterhaltungskünste und ihrer gleichzeitig niedrigen sozialen Stellung und Ablehnung durch Kirche und Obrigkeit verantwortlich sind.
Wie wird der Widerspruch zwischen Norm und Realität der Spielleute dargestellt?
Der Widerspruch wird anhand der Gegenüberstellung der negativen Bewertung der Spielleute durch Kirche und Obrigkeit (reflektiert in Rechtsquellen und Normen) und ihrer tatsächlichen gesellschaftlichen Akzeptanz und ihres wirtschaftlichen Erfolgs durch ihre Auftritte dargestellt.
Welche Rolle spielte die Kirche in der Wahrnehmung der Spielleute?
Die Arbeit untersucht den Einfluss der Kirche auf die negative Wahrnehmung der Spielleute und deren gesellschaftlichen Ausschluss.
Welche Rolle spielte die weltliche Herrschaft in der Wahrnehmung der Spielleute?
Ähnlich wie die Kirche wird auch der Einfluss der weltlichen Herrschaft auf die rechtliche und soziale Situation der Spielleute untersucht.
- Citation du texte
- Nina Hollstein (Auteur), 2006, Die Spielleute des Mittelalters zwischen Normen und Realität, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/117955