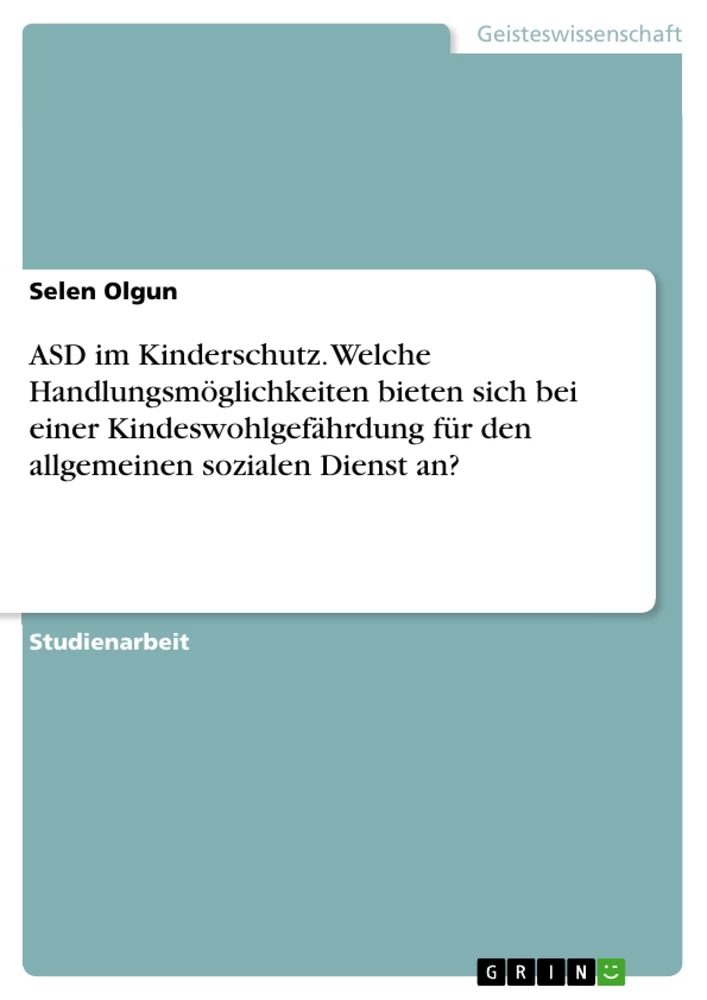Jeder junge Mensch hat ein Recht auf Förderung seiner Entwicklung und auf Erziehung einer selbstbestimmten, eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit.. Doch nicht immer gelingt es Eltern das Wohl der
Kinder/Jugendlichen zu gewährleisten. Nicht selten wird in den Medien von einer Kindeswohlgefährdung berichtet. Oftmals wird dabei auch das Jugendamt kritisiert und der Druck an die Fachkräfte steigt. Die Aufgabe des ASD ist es die Kinder und Jugendliche vor Wohlgefährdungen zu schützen und ihre soziale Entwicklung zu fördern. Dabei stellt sich die Frage, welche Handlungsmöglichkeiten sich für den ASD bei einer Kindeswohlgefährdung anbieten.
Im Rahmen der folgenden wissenschaftlichen Arbeit soll daher der Versuch unternommen werden, die Handlungsfelder des ASD im Fall einer Kindeswohlgefährdung darzustellen. Im ersten Schritt wird der ASD mit seinen Aufgaben und Kernaufträgen vorgestellt. Um einen Zugang zum Thema Kinderschutz im ASD zu gewinnen wird daraufhin der Begriff
der Kindeswohlgefährdung und seine verschiedenen Formen vorgestellt. Dabei ist zu beachten, dass keine eindeutige Definition zum Begriff Kindeswohl vorliegt, und daher auch keine eindeutige Definition zum Begriff Kindeswohlgefährdung.
Anschließend wird dann der ASD im Zusammenhang mit dem Kinderschutz behandelt. Dabei wird der Fokus auf den Schutzauftrag, die rechtlichen Grundlagen, die Risikoeinschätzung und die Inobhutnahme gelegt. Abschließend erfolgt im Fazit eine Zusammenfassung der wichtigsten Ergebnisse.
Inhaltsverzeichnis
- Abkürzungsverzeichnis
- Einleitung
- Der allgemeine soziale Dienst
- Handlungsfeld des allgemeinen sozialen Dienstes im Jugendamt
- Schwerpunktaufgabe Beratung
- Hilfeplanung §36
- Hausbesuch
- Kindeswohlgefährdung
- Definition
- Formen von Kindeswohlgefährdung
- Der allgemeine soziale Dienst im Kinderschutz
- Schutzauftrag
- Rechtliche Grundlagen
- Risikoeinschätzung
- Inobhutnahme
- Fazit
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Handlungsmöglichkeiten des Allgemeinen Sozialen Dienstes (ASD) bei Kindeswohlgefährdung. Ziel ist es, die Aufgaben und Handlungsfelder des ASD im Kontext des Kinderschutzes darzustellen und zu analysieren.
- Der Allgemeine Soziale Dienst (ASD) und seine Aufgaben
- Der Begriff der Kindeswohlgefährdung und seine verschiedenen Ausprägungen
- Der Schutzauftrag des ASD und die damit verbundenen rechtlichen Grundlagen
- Die Risikoeinschätzung im Rahmen des Kinderschutzes
- Die Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen als Maßnahme des ASD
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der Kindeswohlgefährdung und die Rolle des Allgemeinen Sozialen Dienstes (ASD) ein. Sie betont das Recht jedes jungen Menschen auf Förderung seiner Entwicklung und verweist auf die Herausforderungen des ASD angesichts von Kindeswohlgefährdungen und den damit verbundenen medialen und gesellschaftlichen Drucks. Die Arbeit skizziert den Aufbau und die Zielsetzung der Untersuchung.
2. Der ASD: Dieses Kapitel beschreibt den Allgemeinen Sozialen Dienst (ASD) und seine vielfältigen Aufgaben innerhalb des Jugendamtes. Es hebt die Unterschiede in der Organisation und den Aufgaben des ASD bundesweit hervor und betont seine zentrale Rolle als Anlaufstelle für junge Menschen, Familien und Fachkräfte. Die Kernaufgaben des ASD, wie Beratung, Hilfeplanung, und die Wahrnehmung des Schutzauftrags bei Kindeswohlgefährdung, werden im Detail erläutert, wobei die entsprechenden Paragrafen des SGB VIII als Rechtsgrundlage genannt werden. Das Kapitel verdeutlicht den Spagat zwischen Beratungs- und Schutzfunktion des ASD.
3. Kindeswohlgefährdung: Dieses Kapitel befasst sich mit dem komplexen Begriff der Kindeswohlgefährdung. Es thematisiert das Fehlen einer eindeutigen Definition von Kindeswohl und Kindeswohlgefährdung und beleuchtet die verschiedenen Formen, in denen Kindeswohlgefährdung auftreten kann. Der Fokus liegt auf der Notwendigkeit einer differenzierten Betrachtungsweise, da die Interpretation der Kindeswohlgefährdung von Fall zu Fall variieren kann. Das Kapitel bildet die Grundlage für das Verständnis der nachfolgenden Kapitel zum Kinderschutz.
4. Der allgemeine soziale Dienst im Kinderschutz: Dieses Kapitel konzentriert sich auf die Rolle des ASD im Kinderschutz. Der Schutzauftrag des ASD wird detailliert erläutert, inklusive der relevanten rechtlichen Grundlagen. Die Risikoeinschätzung als wichtiges Instrument zur Beurteilung von Gefährdungssituationen wird ebenso behandelt wie die Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen als ultima ratio. Die Kapitel unterstreicht die komplexe Abwägung zwischen dem Eingreifen zum Schutz des Kindes und dem Respekt vor dem Recht der Eltern auf elterliche Fürsorge.
Schlüsselwörter
Kindeswohlgefährdung, Allgemeiner Sozialer Dienst (ASD), Jugendamt, SGB VIII, Schutzauftrag, Hilfeplanung, Risikoeinschätzung, Inobhutnahme, Beratung, Kinderschutz, rechtliche Grundlagen.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Handlungsmöglichkeiten des Allgemeinen Sozialen Dienstes bei Kindeswohlgefährdung
Was ist der Inhalt dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert die Handlungsmöglichkeiten des Allgemeinen Sozialen Dienstes (ASD) im Jugendamt bei Kindeswohlgefährdung. Sie beschreibt die Aufgaben und Handlungsfelder des ASD im Kinderschutz, beleuchtet den Begriff der Kindeswohlgefährdung und deren verschiedene Formen, erklärt den Schutzauftrag des ASD inklusive der rechtlichen Grundlagen, die Risikoeinschätzung und die Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen.
Welche Themen werden im Einzelnen behandelt?
Die Arbeit umfasst folgende Themen: Der Allgemeine Soziale Dienst (ASD) und seine Aufgaben im Jugendamt (Beratung, Hilfeplanung, Hausbesuche, §36 SGB VIII); Der Begriff der Kindeswohlgefährdung und seine verschiedenen Ausprägungen; Der Schutzauftrag des ASD und die damit verbundenen rechtlichen Grundlagen (SGB VIII); Die Risikoeinschätzung im Rahmen des Kinderschutzes; Die Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen als Maßnahme des ASD.
Wie ist die Arbeit aufgebaut?
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, die die Thematik und die Zielsetzung der Untersuchung beschreibt. Es folgen Kapitel zum ASD und seinen Aufgaben, zur Kindeswohlgefährdung, und zur Rolle des ASD im Kinderschutz. Jedes Kapitel enthält eine Zusammenfassung. Die Arbeit schließt mit einem Literaturverzeichnis und einem Schlüsselwortverzeichnis ab.
Was sind die Kernaussagen der einzelnen Kapitel?
Kapitel 1 (Einleitung): Einführung in die Thematik Kindeswohlgefährdung und die Rolle des ASD, Herausforderungen des ASD, Aufbau und Zielsetzung der Arbeit. Kapitel 2 (Der ASD): Beschreibung des ASD, seiner Aufgaben im Jugendamt, der Beratungs- und Schutzfunktion, und der rechtlichen Grundlagen (SGB VIII). Kapitel 3 (Kindeswohlgefährdung): Definition und verschiedene Formen von Kindeswohlgefährdung, Notwendigkeit einer differenzierten Betrachtung. Kapitel 4 (Der ASD im Kinderschutz): Schutzauftrag des ASD, rechtliche Grundlagen, Risikoeinschätzung und Inobhutnahme als ultima ratio.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Kindeswohlgefährdung, Allgemeiner Sozialer Dienst (ASD), Jugendamt, SGB VIII, Schutzauftrag, Hilfeplanung, Risikoeinschätzung, Inobhutnahme, Beratung, Kinderschutz, rechtliche Grundlagen.
Wo finde ich detaillierte Informationen zu den einzelnen Themen?
Die detaillierten Informationen zu den einzelnen Themen finden Sie in den jeweiligen Kapiteln der Arbeit, die in der HTML-Datei oben ausführlich zusammengefasst sind. Das Inhaltsverzeichnis bietet einen Überblick über die einzelnen Kapitel und Unterpunkte.
Für wen ist diese Arbeit relevant?
Diese Arbeit ist relevant für Fachkräfte im Jugendamt, Sozialarbeiter, Studenten der Sozialarbeit und Sozialpädagogik sowie alle, die sich mit dem Thema Kinderschutz und Kindeswohlgefährdung auseinandersetzen.
- Arbeit zitieren
- Selen Olgun (Autor:in), 2021, ASD im Kinderschutz. Welche Handlungsmöglichkeiten bieten sich bei einer Kindeswohlgefährdung für den allgemeinen sozialen Dienst an?, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1180872