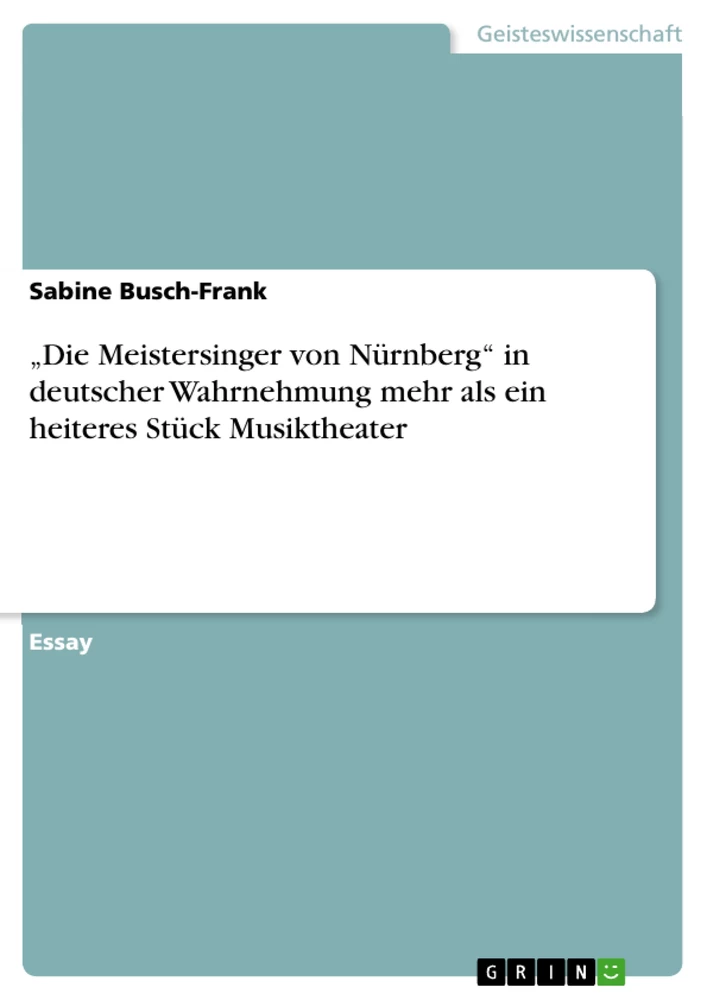„Gewiss, es ist viel 'Hitler' in Wagner“, resignierte der Dichter Thomas Mann 1950 im
amerikanischen Exil – und tatsächlich ist Wagners Werk oft noch heute bei Intellektuellen in
Deutschland trotz seines Ruhmes als Schöpfer des 'Gesamtkunstwerkes' und der Bayreuther
Festspiele verpönt. Gerade das Vorspiel zu den Meistersingern von Nürnberg und die
Schlussansprache des Hans Sachs auf der Festwiese werden sogar von manchen
Opernfreunden mit geradezu körperlichem Unbehagen gehört. Schon der zeitgenössische
Rezensent Eduard Hanslick bezeichnete die Musik zu Beginn des ersten Aktes als
„blutrünstig“:
Das donnernde C-Dur, der gewaltige Einsatz des Tutti-Klangkörpers, die rhythmischen
Marschmusikanklänge im Schlagwerk und der fanfarenartige Gebrauch des Blechs zu Beginn
des Vorspiels wirken viel zu dominant und martialisch für eine musikalische Komödie aus
dem romantisierten Nürnberg der Reformation. Zudem hat sich mit den Jahren eine immer
getragenere musikalische Auffassung des Orchestervorspiels eingebürgert – hatte Wagner
selbst nur etwa 8 Minuten dafür benötigt, wählen die Dirigenten seit den 20-er Jahren deutlich
langsamere Tempi, die die Dauer des Präludiums um bis zu zwei Minuten verlängern.
Inhaltsverzeichnis
- „Die Meistersinger von Nürnberg“ in deutscher Wahrnehmung mehr als ein heiteres Stück Musiktheater
- Musikalisch ist das Vorspiel in C-Dur gehalten
- Im weiteren Verlauf des Vorspiels wird dann auch die zunächst so drastische Tonsprache milder
- Wagner war schließlich, obwohl bei Beginn der Nationalsozialistischen Herrschaft in Deutschland bereits seit 50 Jahren tot, einer der gern zitierten kulturell-ideologischen Leitsterne des faschistischen Regimes
- Dabei hatte die Wirkungsgeschichte der Meistersinger zu Wagners Lebzeiten eine ganz andere Tendenz
- Tatsächlich trat der Nürnberger Sängerstreit seinen Siegeszug durch Europa an
- In Deutschland wurden die Regieauffassungen während des Dritten Reiches, wie zu erwarten war, stetig politischer
- Zumindest im deutschen Sprach- und Kulturkreis hat also die Aufführungstradition und die Auffassung des Werkes als deutsche Festoper auf die Rezeption großen Einfluss genommen
- Letztere wurde in den vergangenen Jahrzehnten auch in der Theaterwissenschaft wiederholt diskutiert
- Über die Jahrzehnte ist im Rahmen solcher gedanklicher Aufarbeitung des 'Dritten Reiches' in (West-)Deutschland der eigentliche Gehalt des Werkes auf der Opernbühne wie in der Forschung in den Hintergrund geraten
- Tatsächlich sind die Meistersinger als einziges von Wagners großen Werken, für welches er die Handlung komplett selbst entworfen hat, in mehrfacher Hinsicht theaterwissenschaftlich bedeutsam
- Die Meistersinger sprengen die Gattung einer Komischen Oper
- Vielleicht stehen den Meistersinger also auch szenisch noch viele neue Auffassungen bevor
- Schließlich schrieb auch Wagner in einem Brief an Liszt: „Kinder! Macht Neues!\"
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Dieser Text analysiert die Rezeption und Inszenierung von Richard Wagners Oper „Die Meistersinger von Nürnberg“ im deutschen Sprachraum. Er untersucht die Entwicklung der Interpretation des Werkes im Laufe der Zeit, insbesondere im Kontext des Nationalsozialismus und der Nachkriegszeit. Darüber hinaus werden die musikalischen Besonderheiten des Vorspiels und die Bedeutung der Figur des Hans Sachs im Hinblick auf die zentrale Thematik des Werks beleuchtet.
- Die Rolle von Richard Wagners Musik im Nationalsozialismus und die instrumentalisierung seiner Werke durch das Nazi-Regime
- Die Rezeption und Interpretation von „Die Meistersinger von Nürnberg“ im Laufe der Zeit, insbesondere in Bezug auf die deutsche Identität und die Frage nach dem Umgang mit der Vergangenheit
- Die musikalische Gestaltung des Vorspiels und seine Bedeutung für die Gesamtkomposition der Oper
- Die Figur des Hans Sachs als Vertreter der Tradition und des deutschen Meistergesangs
- Die Auseinandersetzung mit der Figur des Sixtus Beckmesser im Kontext der antisemitischen Strömungen in Wagners Werk
Zusammenfassung der Kapitel
Der Text beginnt mit einer Analyse des Vorspiels zu den Meistersingern, wobei die musikalischen Besonderheiten und ihre Bedeutung im Kontext der gesamten Oper beleuchtet werden. Im weiteren Verlauf wird die Rezeption des Werkes im Laufe der Zeit untersucht, insbesondere in Bezug auf die instrumentalisierung durch das Nazi-Regime und die anschließende Entnazifizierung. Es wird gezeigt, wie die Interpretation des Werkes durch die politischen und gesellschaftlichen Entwicklungen in Deutschland beeinflusst wurde.
Der Text beleuchtet außerdem die verschiedenen Regieauffassungen der Oper und die damit verbundenen Debatten um die Interpretation der Figuren und der Handlung. Ein besonderes Augenmerk liegt dabei auf der Figur des Hans Sachs und seiner Bedeutung für die Thematik des Werkes. Schließlich wird die Frage nach dem antisemitischen Gehalt der Figur des Beckmesser diskutiert und die entsprechende Forschung in der Theaterwissenschaft zusammengefasst.
Schlüsselwörter
Richard Wagner, Die Meistersinger von Nürnberg, Rezeption, Inszenierung, Nationalsozialismus, Entnazifizierung, Hans Sachs, Sixtus Beckmesser, Musiktheater, deutsche Identität, Kunst und Tradition, Antisemitismus
Häufig gestellte Fragen
Warum ist die Rezeption von Wagners „Meistersingern“ in Deutschland belastet?
Das Werk wurde im Nationalsozialismus ideologisch instrumentalisiert, insbesondere durch die Schlussansprache des Hans Sachs, was bis heute Unbehagen auslösen kann.
Welche musikalischen Merkmale hat das Vorspiel der Oper?
Es ist in C-Dur gehalten, nutzt einen gewaltigen Tutti-Klangkörper und Marschmusikanklänge, was oft als martialisch empfunden wird.
Wer ist die Figur des Hans Sachs?
Hans Sachs vertritt die Tradition des deutschen Meistergesangs und fungiert als Brücke zwischen alter Kunst und notwendiger Neuerung.
Gibt es antisemitische Aspekte in der Oper?
Die Figur des Sixtus Beckmesser wird in der Theaterwissenschaft oft im Kontext antisemitischer Strömungen in Wagners Werk diskutiert.
Ist „Die Meistersinger von Nürnberg“ eine reine Komödie?
Obwohl als heiteres Stück konzipiert, sprengt das Werk die Gattung der Komischen Oper durch seine tiefgehende kulturelle und politische Symbolik.
- Citation du texte
- Dr. Sabine Busch-Frank (Auteur), 2008, „Die Meistersinger von Nürnberg“ in deutscher Wahrnehmung mehr als ein heiteres Stück Musiktheater, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/118100