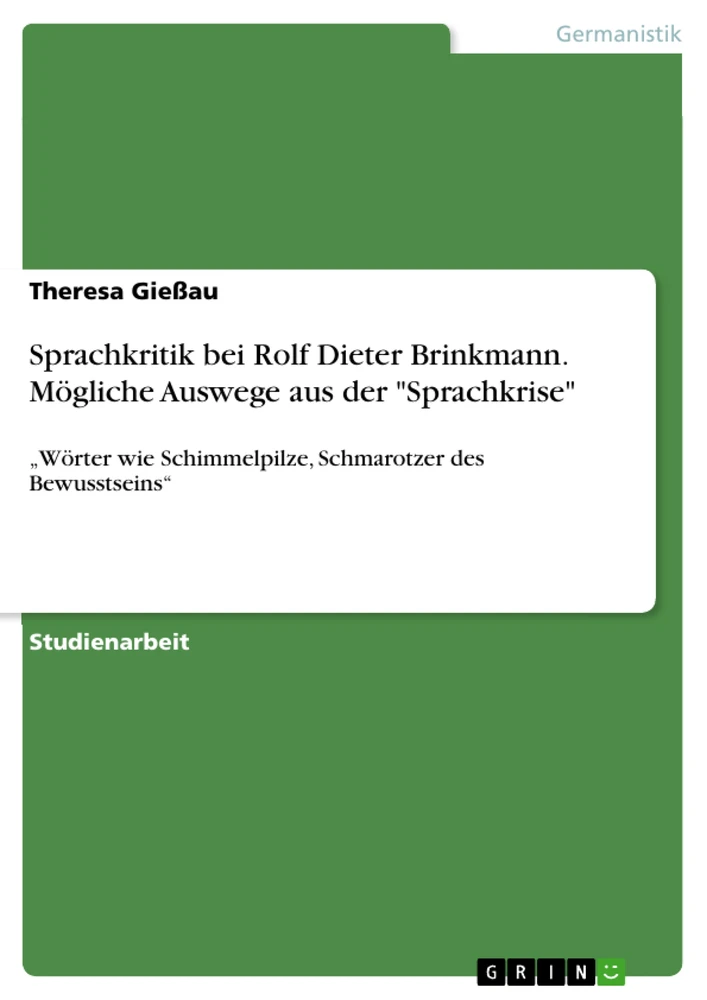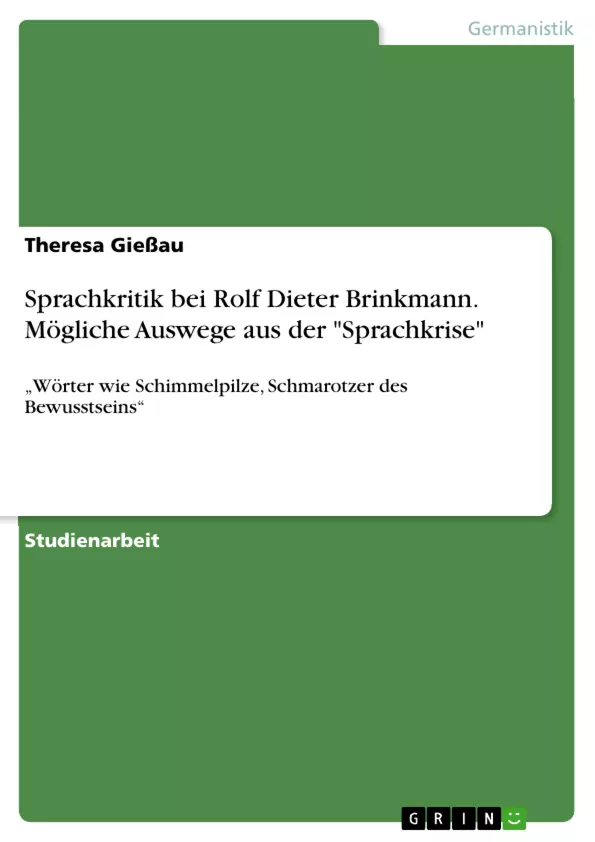Die vorliegende Seminararbeit setzt sich zum Ziel, aus der Fülle an Material, die Rolf Dieter Brinkmanns Essays, Briefe und Notizen bereithalten, seine sprachkritischen Grundgedanken herauszuarbeiten, in einen geordneten Zusammenhang zu bringen und nach Lösungswegen aus der Sprachproblematik zu suchen. Paradoxerweise verfügt der Dichter trotz der Ablehnung von Sprache über ein unglaublich reichhaltiges Repertoire an sprachlich verfasstem Material. Diese Banalität motiviert dazu, sich Brinkmanns potentielle Lösungswege aus der Sprachproblematik anzuschauen. Konnte er einen Ausweg aus der 'Sprachkrise' finden? Wenn ja: Wie sah dieser aus? Welche Mittel waren dazu nötig? Wie hatte Literatur Brinkmann zufolge auszusehen? Eine Betrachtung seiner expliziten Forderungen und Darlegungen sowie der Techniken seiner Arbeit werden zeigen, ob es für Brinkmann eine Versöhnung mit dem 'Problemkind Sprache' geben konnte.
Das wichtigste und natürlichste Werkzeug eines Schriftstellers ist seine Sprache. Ohne das sprachliche System, ohne Lexeme, Satzstrukturen und eine zugrundeliegende Grammatik kann kein literarisches Werk gelingen. Mit Sprache kreieren Dichter und Autoren Kunstwerke von unschätzbarem Wert, die aus dem kulturellen Erbe einer Gesellschaft nicht mehr wegzudenken sind. Was aber tun, wenn sich der Schreibende nicht länger auf sein fundamentalstes Arbeitsmittel – die Sprache – verlassen kann? Wenn Sprache unzuverlässig wird, oder dem, was sie ausdrücken soll, nicht länger gerecht wird – den Gegenstand womöglich verzerrt darstellt? Eine solche 'Sprachkrise' ist aber nicht bloß ein Phänomen vergangener Jahrhunderte. Auch Rolf Dieter Brinkmann, Dichter aus Vechta und Zeit seines Lebens gefeiert als „die Ikone deutscher Popliteratur“, sah sich vor einer ähnlichen Problematik.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Sprachkritische Einflüsse: Von Burroughs, Fiedler, Mauthner und Benn
- William S. Burroughs
- Leslie A. Fiedler
- Fritz Mauthner
- Gottfried Benn
- Sprachkritische Ansichten: Die Essays und Materialbände Rolf Dieter Brinkmanns
- Kritik an der europäisch-abendländischen Literatur und dem Literaturbetrieb
- Sprache ist sinnlos
- Sprache verfälscht und entfernt vom Leben
- Sprache als Zwangssystem
- Sprachkritische Auswege: Wahrnehmen, Erweitern, Reflektieren – eine Lösung?
- Intermedialität
- Erweiterung
- Die Bedeutung des Augenblicks
- Subjektivität und Sinnlichkeit
- Selbstreflexion
- 'Wer kommt schon ganz raus?' – Die Unumgänglichkeit der Sprache
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Seminararbeit untersucht die sprachkritischen Grundgedanken von Rolf Dieter Brinkmann. Sie analysiert seine Essays, Briefe und Notizen, um seine Kritik an der Sprache zu beleuchten und nach möglichen Lösungswegen zu suchen. Die Arbeit verfolgt dabei den Ansatz, die Entwicklung seiner Gedanken zu untersuchen und seinen Bezug zur Popkultur der späten Fünfziger und frühen Sechziger Jahre zu beleuchten.
- Die Unzulänglichkeit der Sprache und ihre Uneigentlichkeit
- Die 'geschichtliche Vorbelastung' der Sprache durch Traditionen und Regelwerke
- Die Bedeutung der amerikanischen Beat- und Underground-Szene für Brinkmanns Denken
- Die Suche nach Alternativen zur Sprache in der Kunst
- Die Rolle der Intermedialität und der Subjektivität in Brinkmanns Werk
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, die die Bedeutung der Sprache für Schriftsteller und die Problematik einer 'Sprachkrise' beleuchtet. Anschließend werden die sprachkritischen Einflüsse von William S. Burroughs, Leslie A. Fiedler, Fritz Mauthner und Gottfried Benn auf Brinkmanns Denken beleuchtet. In einem weiteren Kapitel werden Brinkmanns eigene sprachkritische Thesen herausgearbeitet, indem drei seiner Essays und ein Materialband analysiert werden. Schließlich werden Brinkmanns mögliche Lösungswege aus der 'Sprachkrise' beleuchtet, einschließlich seiner Kritik an der Sprache, seiner Auseinandersetzung mit der Intermedialität und seiner Forderung nach einer Erweiterung der Wahrnehmung.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit Themen wie Sprachkritik, Popliteratur, Beat Generation, Intermedialität, Subjektivität, Sinnlichkeit, Selbstreflexion und der 'Sprachkrise' in der Literatur. Zentrale Figuren sind Rolf Dieter Brinkmann, William S. Burroughs, Leslie A. Fiedler, Fritz Mauthner und Gottfried Benn. Schlüsselbegriffe sind u.a. Cut-up-Technik, Dekonstruktion, 'geschichtliche Vorbelastung', Popkultur, 'unsichtbare Generation', 'Sprachproblematik', 'Sprachkrise' und 'Erkundungen für die Präzisierung des Gefühls für einen Aufstand'.
Häufig gestellte Fragen
Was versteht Rolf Dieter Brinkmann unter der 'Sprachkrise'?
Brinkmann kritisiert die Unzulänglichkeit der Sprache, die er als 'geschichtlich vorbelastet' und als ein Zwangssystem empfindet, das die Wirklichkeit eher verfälscht als abbildet.
Welche Autoren beeinflussten Brinkmanns Sprachkritik?
Wichtige Einflüsse stammen von William S. Burroughs (Cut-up-Technik), Leslie A. Fiedler, Fritz Mauthner und Gottfried Benn.
Welche Lösungswege suchte Brinkmann aus der Sprachproblematik?
Er experimentierte mit Intermedialität, der Erweiterung der Sinneswahrnehmung, Subjektivität und der Fokussierung auf den unmittelbaren Augenblick.
Warum wird Brinkmann als 'Ikone der Popliteratur' bezeichnet?
Seine Auseinandersetzung mit der amerikanischen Beat- und Underground-Szene sowie sein radikaler Bruch mit traditionellen literarischen Formen prägten die deutsche Popkultur nachhaltig.
Ist eine Versöhnung mit der Sprache laut der Arbeit möglich?
Die Arbeit untersucht im letzten Kapitel die 'Unumgänglichkeit der Sprache' und hinterfragt, ob ein vollständiger Ausweg aus dem sprachlichen System für einen Schriftsteller überhaupt existiert.
- Citation du texte
- Theresa Gießau (Auteur), 2015, Sprachkritik bei Rolf Dieter Brinkmann. Mögliche Auswege aus der "Sprachkrise", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1181051