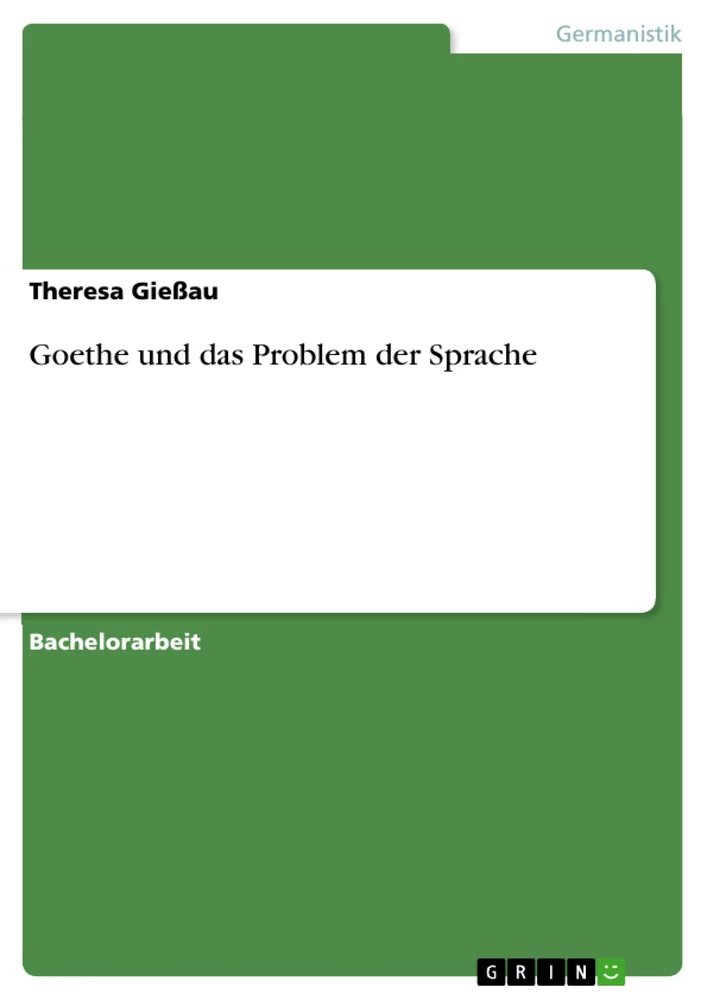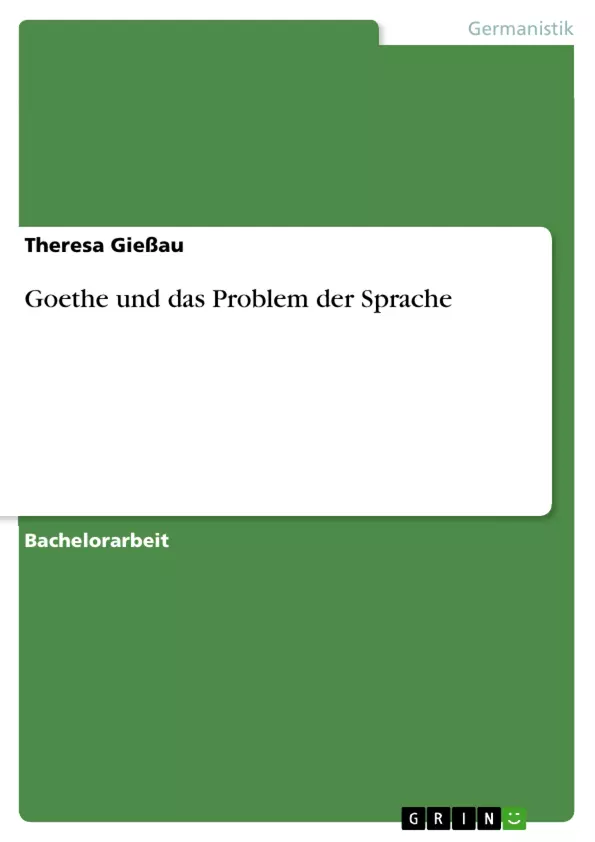Warum ist Goethe als Künstler an den anerkannten Mängeln der Sprache doch nicht gescheitert? Kunst als Ausweg(?), lautet der Ansatz, dem Goethe zu folgen schien und den es genauer zu untersuchen gilt. Ziel ist es, herauszufinden, wie ihm ein Weg aus der Sprachproblematik gelang, warum er sich dem Wort nicht verweigerte, oder sogar ins Schweigen verfiel. Immerhin war gerade die Sprache für Goethe als Künstler zeit seines Lebens das Medium, über das er sich seinen Mitmenschen am liebsten mitteilte.
Johann Wolfgang von Goethe veröffentlichte zwar Zeit seines Lebens kein eindeutig poetologisches oder sprachtheoretisches Werk. Seine kritischen Gedanken über das Unvermögen der Sprache finden sich jedoch, wenn auch unzusammenhängend und verstreut, überaus zahlreich in seinen Werken, Briefen und theoretischen Schriften. Sonderbar, mag der ein oder andere anmerken, denn ist nicht Goethe einer der berühmtesten, wenn nicht sogar der berühmteste und damit einer der sprachmächtigsten Schriftsteller, Dichter und Denker deutscher Lande?
Die intensive Arbeit mit und die gleichzeitige Verzweiflung über das Wort stehen tatsächlich in einem paradoxen Verhältnis. Es kommt die Frage auf, warum sich Goethe trotz seiner oftmals so kritischen Position gegenüber der Sprache während seiner Schaffenszeit in so vielfältiger Weise ebendieser Sprache bedient hat. Wie bringt er solch großartige Werke wie den 'Faust' zustande, wenn er im gleichen Atemzug das eben noch angewandte Sprachsystem als defizitär bezeichnet und daran verzweifelt? Eine Wanderung durch Goethes Werke und Schriften soll Klarheit in dieses Paradoxon bringen.
Inhaltsverzeichnis
- I. „Die abstrakten Worte (...) zerfielen mir im Mund wie modrige Pilze.“
- II. Sprachbewusstsein und Sprachkritik um 1800
- II. 1 Johann Gottfried Herder
- II.2 Georg Christoph Lichtenberg
- III. Goethe und das Problem der Sprache
- III.1 Sprache als 'Surrogat'
- III.2 „Der Widerstreit des Fixen und Beweglichen“
- III.3 Verpasste Verständigung
- IV. Poetische Sprache als Ausweg aus der Problematik? – Eine Schlussbetrachtung
- IV.1 Das kreative Potential dichterischer Sprache
- IV.2 Goethes Werke: Sein Versuch, „Sprache lebendig wachsen zu lassen“
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht Goethes komplexes Verhältnis zur Sprache, ein Paradoxon zwischen seiner sprachkritischen Haltung und seiner meisterhaften Anwendung derselben in seinen Werken. Sie beleuchtet Goethes Bewusstsein für die Unzulänglichkeiten der Sprache im Kontext der sprachphilosophischen Debatten um 1800, insbesondere im Vergleich zu Herder und Lichtenberg. Die Arbeit analysiert, wie sich Goethes Sprachskepsis in seinen Werken manifestiert und wie er trotz dieser Skepsis literarische Meisterwerke schuf.
- Goethes Sprachkritik und ihr Kontext im 18. und 19. Jahrhundert
- Sprache als „Surrogat“ bei Goethe: Die Grenzen sprachlicher Darstellung
- Der Widerstreit zwischen der fixierten und der beweglichen Sprache in Goethes Werk
- Kommunikationsprobleme und Missverständnisse in Goethes Werken
- Poetische Sprache als Lösungsansatz für Goethes Sprachproblematik
Zusammenfassung der Kapitel
I. „Die abstrakten Worte (...) zerfielen mir im Mund wie modrige Pilze.“: Dieses Kapitel führt in die Thematik der Sprachkrise ein, beginnend mit Hofmannsthals bekannter Metapher. Es stellt die Sprachskepsis der Moderne dar und hebt hervor, dass diese bereits bei Goethe, ein Jahrhundert zuvor, vorhanden war. Der scheinbare Widerspruch zwischen Goethes sprachkritischer Haltung und seinem Status als meisterhafter Schriftsteller wird als zentrale Fragestellung eingeführt. Das Kapitel legt den Grundstein für die nachfolgende Analyse von Goethes komplexem Verhältnis zur Sprache und seiner Auseinandersetzung mit deren Grenzen.
II. Sprachbewusstsein und Sprachkritik um 1800: Dieses Kapitel beleuchtet die sprachphilosophischen Strömungen des ausgehenden 18. und beginnenden 19. Jahrhunderts, um den Kontext für Goethes Sprachdenken zu schaffen. Es analysiert die Ansichten von Johann Gottfried Herder und Georg Christoph Lichtenberg hinsichtlich des Ursprungs, der Grenzen und der Möglichkeiten der Sprache. Die in diesem Kapitel dargestellten sprachkritischen Ansätze dienen als Vergleichsrahmen für die spätere Analyse von Goethes eigenen Positionen und bilden so die Grundlage des Verständnisses seiner Kritik an der Sprache.
III. Goethe und das Problem der Sprache: Dieses Kapitel konzentriert sich auf Goethes eigene Auseinandersetzung mit den Schwierigkeiten der Sprache. Es untersucht seine Sicht der Sprache als „Surrogat“, die Unzulänglichkeit der Sprache in der Naturwissenschaft und im zwischenmenschlichen Bereich, und beleuchtet die Problematik der Verständigung in Werken wie „Die Leiden des jungen Werthers“ und „Die Wahlverwandtschaften“. Der Abschnitt zeigt Goethes tiefe Reflexion über die Grenzen der sprachlichen Darstellung und deren Auswirkungen auf Kommunikation und Erkenntnis.
Schlüsselwörter
Goethe, Sprache, Sprachkritik, Sprachphilosophie, Herder, Lichtenberg, Kommunikation, „Surrogat“, poetische Sprache, Literatur, Sprachproblematik, Werther, Wahlverwandtschaften.
Häufig gestellte Fragen zu "Goethes komplexes Verhältnis zur Sprache"
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht Goethes komplexes und paradox wirkendes Verhältnis zur Sprache: seine sprachkritische Haltung steht im Gegensatz zu seiner meisterhaften Anwendung von Sprache in seinen Werken. Sie beleuchtet Goethes Bewusstsein für die Grenzen der Sprache im Kontext der sprachphilosophischen Debatten um 1800, insbesondere im Vergleich zu Herder und Lichtenberg. Die Analyse konzentriert sich darauf, wie sich Goethes Sprachskepsis in seinen Werken manifestiert und wie er trotz dieser Skepsis literarische Meisterwerke schuf.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Schwerpunktthemen: Goethes Sprachkritik im historischen Kontext des 18. und 19. Jahrhunderts; Sprache als "Surrogat" bei Goethe und die Grenzen sprachlicher Darstellung; der Widerstreit zwischen fixierter und beweglicher Sprache in Goethes Werk; Kommunikationsprobleme und Missverständnisse in seinen Werken; und schließlich poetische Sprache als möglicher Lösungsansatz für Goethes Sprachproblematik.
Welche Autoren werden neben Goethe behandelt?
Neben Goethe werden die sprachphilosophischen Ansichten von Johann Gottfried Herder und Georg Christoph Lichtenberg analysiert, um den Kontext von Goethes Sprachdenken zu verdeutlichen und einen Vergleichsrahmen für seine Positionen zu schaffen.
Welche Werke Goethes werden analysiert?
Die Arbeit bezieht sich explizit auf "Die Leiden des jungen Werthers" und "Die Wahlverwandtschaften", um die Problematik der Verständigung und die Grenzen der sprachlichen Darstellung in Goethes Werken zu veranschaulichen. Goethes Gesamtwerk wird jedoch als Hintergrund für die Betrachtung seines Versuchs, "Sprache lebendig wachsen zu lassen", herangezogen.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in vier Kapitel: Kapitel I führt in die Thematik der Sprachkrise ein und stellt die zentrale Forschungsfrage nach dem scheinbaren Widerspruch in Goethes Verhältnis zur Sprache vor. Kapitel II beleuchtet das sprachphilosophische Umfeld um 1800 mit Herder und Lichtenberg. Kapitel III konzentriert sich auf Goethes eigene Auseinandersetzung mit den Grenzen der Sprache. Kapitel IV bietet eine Schlussbetrachtung, die das kreative Potential dichterischer Sprache und Goethes Versuche, die Sprache lebendig zu gestalten, diskutiert.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Goethe, Sprache, Sprachkritik, Sprachphilosophie, Herder, Lichtenberg, Kommunikation, "Surrogat", poetische Sprache, Literatur, Sprachproblematik, Werther, Wahlverwandtschaften.
Welche zentrale Metapher wird verwendet?
Die Arbeit beginnt mit der Metapher Hofmannsthals: „Die abstrakten Worte (...) zerfielen mir im Mund wie modrige Pilze.“ Diese Metapher dient als Ausgangspunkt für die Betrachtung der Sprachskepsis und der Sprachproblematik, die bereits bei Goethe ein Jahrhundert zuvor vorhanden war.
- Quote paper
- Theresa Gießau (Author), 2013, Goethe und das Problem der Sprache, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1181065