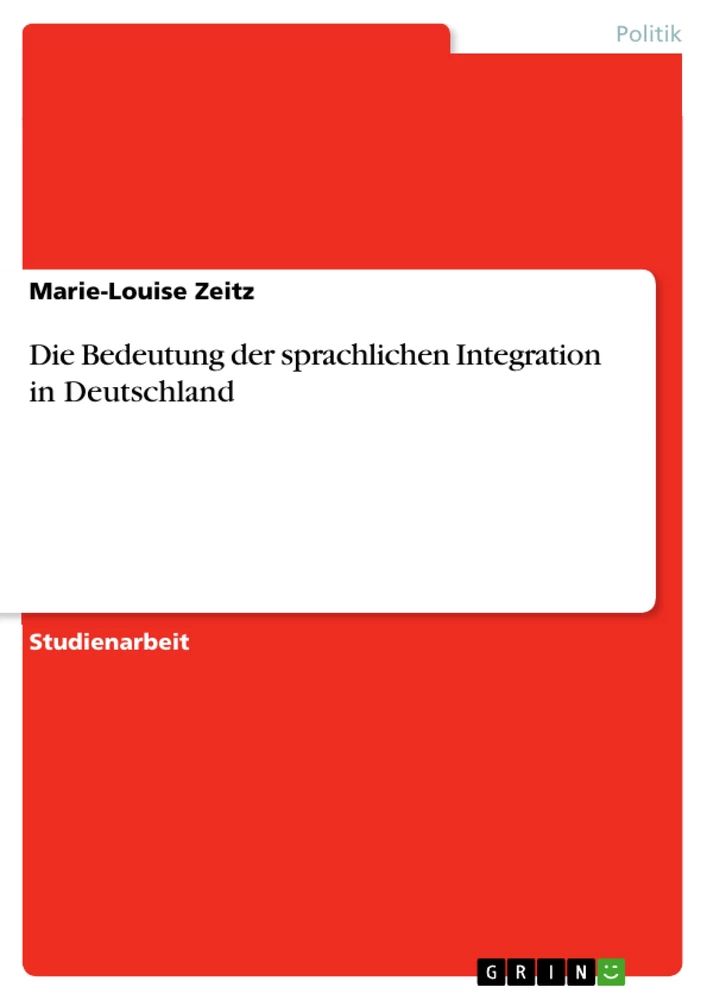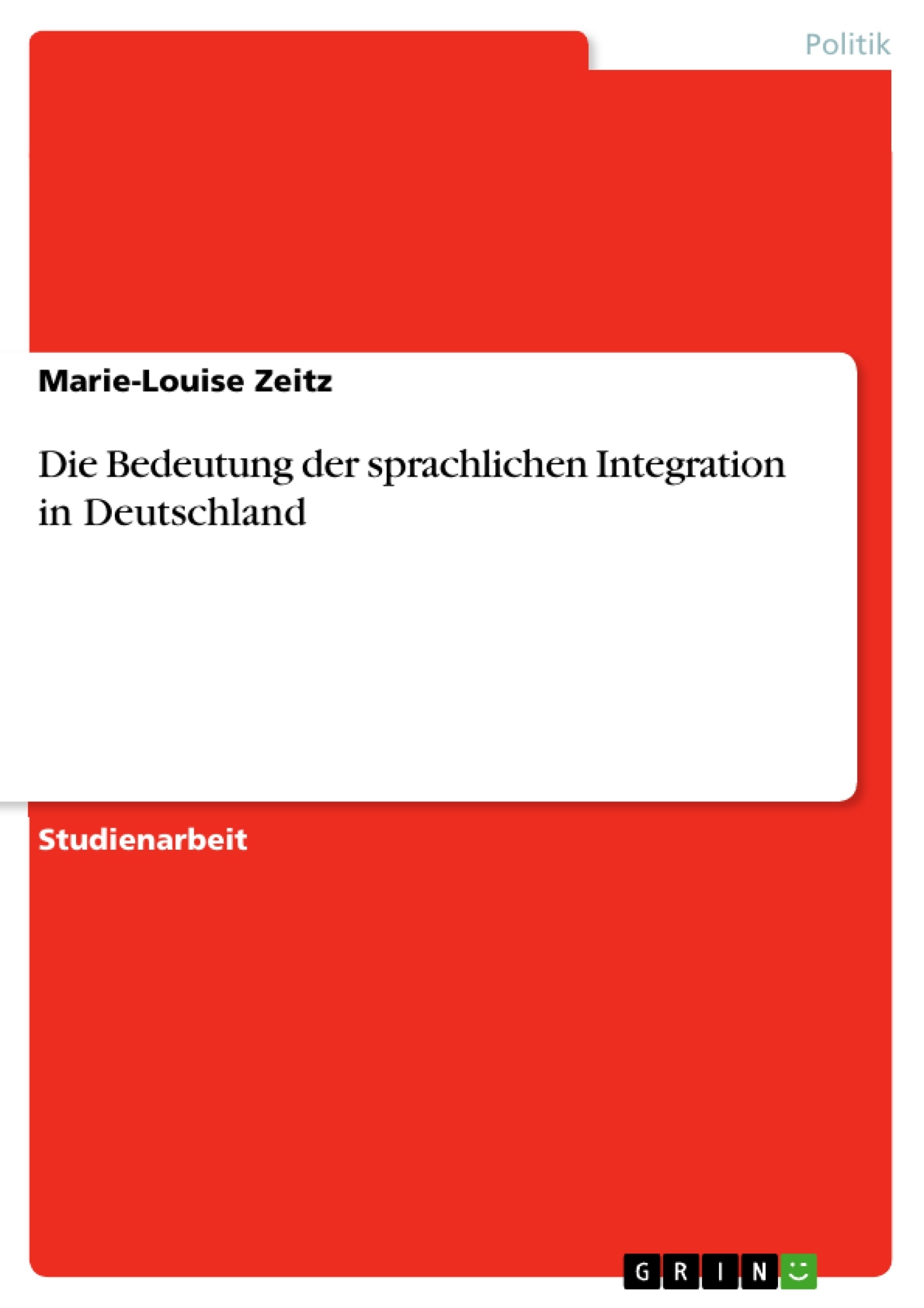Diese Arbeit stellt sich die Frage, welche komplexe und bedeutungsvolle Rolle „Sprache“ in der Integration einnimmt, was Integration überhaupt ist und inwiefern Experten wie zum Beispiel Sozialarbeiter darauf Einfluss nehmen können.
In dieser Arbeit wird sich explizit auf die Einwanderung in Deutschland bezogen sowie auch speziell auf die Migrationsbewegung von 2015. Das Augenmerk liegt dabei ganz besonders auf Flüchtlingen, die aus Syrien in die Bundesrepublik gekommen sind.
Historisch betrachtet gab es immer wieder Situationen, in denen einzelne Menschen oder auch ganze Menschengruppen ihre gewohnte Lebensumgebung verließen und auf Wanderungen gingen. Anlässe dafür waren für sie mitunter Krieg, Verfolgung, Naturphänomene oder generell die Hoffnung auf bessere Lebensperspektiven. Schon vor etwa 200.000 Jahren in Ostafrika, wo sich der Homo Sapiens entwickelte, begannen derartige Prozesse.
Bestimmte Gruppen dieser Menschen gaben ihre Heimat aus den unterschiedlichsten Gründen auf und ließen sich im Laufe der Jahrhunderte vor allem auch auf anderen Kontinenten nieder, wodurch sich die uns jetzt bekannten Gesellschaften herauskristallisieren konnten. Im Vergleich zu heutigen staatlichen und politischen Strukturen gab es zum Beginn der Menschheitsgeschichte weit weniger Hürden, wie etwa Staatsgrenzen, Sprachbarrieren, Zölle oder Bürokratie, sodass das wohl größte Erschwernis einer Wanderung vor 200.000 Jahren wahrscheinlich hauptsächlich geografischer Natur war. Dies änderte sich mit der Weiterentwicklung und Differenzierung unterschiedlicher Kulturen.
Über die Jahrhunderte hinweg bis heute gab und gibt es immer Wanderungen oder Bewegungen, welche zum Beispiel durch die zur Zeit aktuellen politischen oder religiösen Situationen ausgelöst wurden. Auch terminologisch ändert sich bis heute einiges. Wir sprechen jetzt nicht mehr nur von Wanderungen, sondern von Flüchtlingsbewegungen, Migrationsprozessen und Integration. Auch heutzutage muss der Weg vom Heimatland zum neuen Lebensort zwar nicht zwangsläufig mit einer Fluchtbewegung begründet sein, jedoch wirken viele Faktoren, die die Entscheidung beeinflussen, auf eine Person, Familie oder Gruppe ein.
Unabhängig von den Gründen, die die Menschen dazu bewegen, ihr Heimatland zu verlassen, stehen sie, am geografischen Ziel angekommen, vor vielen neuen Herausforderungen. Vor allem die Sprache eines neuen Landes kann eine große Hürde, aber auch eine große Chance sein.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Kapitel I: Theoretische Hinführung zu den Kernbegriffen der Integration
- 1.1 Begriffserklärung
- 1.1.1 Flüchtlinge und MigrantInnen
- 1.1.2 Migration und Integration
- 1.1.3 Sprachliche Integration
- 1.2 Zahlen und Fakten der Flüchtlingsbewegungen in Deutschland
- 1.2.1 Statistische Analyse
- 1.2.2 Rechtliche Rahmenbedingungen für Geflüchtete in Schule, Bildung und Beruf
- Kapitel II: Aktuelle Betrachtung der Perspektive der Flüchtlingsbewegungen
- 2.1 Politische Perspektive
- 2.2 Politische Perspektive aus Sicht der Flüchtenden
- 2.3 Bedeutung zentraler Organisationen in der Integrationsarbeit
- Kapitel III: Kontroversen und Probleme in der sprachlichen Integration in der BRD
- 3.1 Sprache und Bildung als aktueller sozialer und politischer Gegenstand
- 3.2 Zwischen Anspruch und Realität
- 3.3 Kulturelle Hindernisse sprachlicher Integration
- 3.3.1 Bildungsstandards
- 3.3.2 Familienverhältnisse und Geschlechterrollen
- Kapitel IV: Möglichkeiten und Chancen der sprachlichen Integration
- 4.1 Chancen für MigrantInnen
- 4.2 Wirtschaftliche Chancen des Aufnahmelandes Deutschlands
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Rolle von Sprache im Integrationsprozess von Flüchtlingen in Deutschland, insbesondere mit Blick auf die Migrationsbewegung von 2015. Der Fokus liegt dabei auf syrischen Flüchtlingen. Die Arbeit untersucht, inwieweit die Arbeit in Sprachbildungsstätten die Integration positiv oder negativ beeinflussen kann.
- Definition und Abgrenzung zentraler Begriffe wie Flüchtlinge, MigrantInnen und Integration
- Analyse der aktuellen Flüchtlingsbewegungen in Deutschland, insbesondere der Situation syrischer Flüchtlinge
- Untersuchung der politischen Perspektiven auf Integration sowohl aus Sicht des deutschen Staates als auch aus Sicht der Flüchtenden
- Bewertung der Rolle von Sprache in der Integration und deren Bedeutung für die erfolgreiche Arbeit in Sprachbildungsstätten
- Identifizierung von Herausforderungen und Chancen der sprachlichen Integration im Kontext kultureller Unterschiede und politischer Rahmenbedingungen
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel I: Theoretische Hinführung zu den Kernbegriffen der Integration
Dieses Kapitel legt den Grundstein für die Arbeit, indem es grundlegende Fachtermini wie Flüchtlinge, MigrantInnen und Integration definiert und analysiert. Es betrachtet die sprachliche Integration als Schlüsselfaktor für die Eingliederung in eine neue Gesellschaft und liefert einen Überblick über die Zahlen und Fakten der Flüchtlingsbewegungen in Deutschland. Auch die rechtlichen Rahmenbedingungen für Geflüchtete in Schule, Bildung und Beruf werden beleuchtet.
Kapitel II: Aktuelle Betrachtung der Perspektive der Flüchtlingsbewegungen
Dieses Kapitel stellt die unterschiedlichen Perspektiven auf die Integration von Flüchtlingen in Deutschland vor. Es betrachtet die politische Perspektive des deutschen Staates, die Sichtweise der Flüchtenden sowie die Bedeutung zentraler Organisationen in der Integrationsarbeit. Es wird das Zusammenspiel der verschiedenen Akteure und deren Einfluss auf die Integrationsprozesse beleuchtet.
Kapitel III: Kontroversen und Probleme in der sprachlichen Integration in der BRD
Dieses Kapitel untersucht die Kontroversen und Herausforderungen, die sich in der sprachlichen Integration von Flüchtlingen in Deutschland ergeben. Es betrachtet die Rolle von Sprache und Bildung im Kontext sozialer und politischer Rahmenbedingungen. Zudem werden kulturelle Hindernisse, wie beispielsweise Bildungsstandards und Familienstrukturen, analysiert, die den Integrationsprozess beeinflussen können.
Kapitel IV: Möglichkeiten und Chancen der sprachlichen Integration
Dieses Kapitel beleuchtet die Chancen und Möglichkeiten, die sich für MigrantInnen und das Aufnahmeland Deutschland durch die sprachliche Integration ergeben. Es analysiert die wirtschaftlichen Vorteile, die durch die Integration von MigrantInnen entstehen, und zeigt Perspektiven für eine gelingende Integration auf.
Schlüsselwörter
Flüchtlinge, MigrantInnen, Integration, Sprachliche Integration, Sprachbildungsstätten, Flüchtlingsbewegung, Deutschland, Syrien, Politische Perspektive, Kulturelle Hindernisse, Chancen, Herausforderungen.
Häufig gestellte Fragen
Welche Rolle spielt die Sprache beim Integrationsprozess?
Sprache gilt als Schlüsselfaktor für die gesellschaftliche Teilhabe, den Zugang zu Bildung und den Erfolg auf dem Arbeitsmarkt in Deutschland.
Was sind die größten kulturellen Hindernisse bei der sprachlichen Integration?
Unterschiedliche Bildungsstandards, familiäre Strukturen und Geschlechterrollen können den Erwerb der deutschen Sprache und die Integration beeinflussen.
Welche Chancen bietet sprachliche Integration für Deutschland?
Neben der sozialen Stabilität profitiert Deutschland wirtschaftlich durch die Integration qualifizierter Arbeitskräfte in den Arbeitsmarkt.
Wie unterscheiden sich die Begriffe Migration und Flucht?
Während Migration oft freiwillig zur Verbesserung der Lebensumstände erfolgt, ist Flucht eine erzwungene Bewegung aufgrund von Krieg, Verfolgung oder Gewalt.
Was leisten Sprachbildungsstätten für Flüchtlinge?
Sie vermitteln nicht nur die Sprache, sondern fungieren auch als Orte der kulturellen Orientierung und Vorbereitung auf Schule und Beruf.
- Citar trabajo
- Marie-Louise Zeitz (Autor), 2019, Die Bedeutung der sprachlichen Integration in Deutschland, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1181586