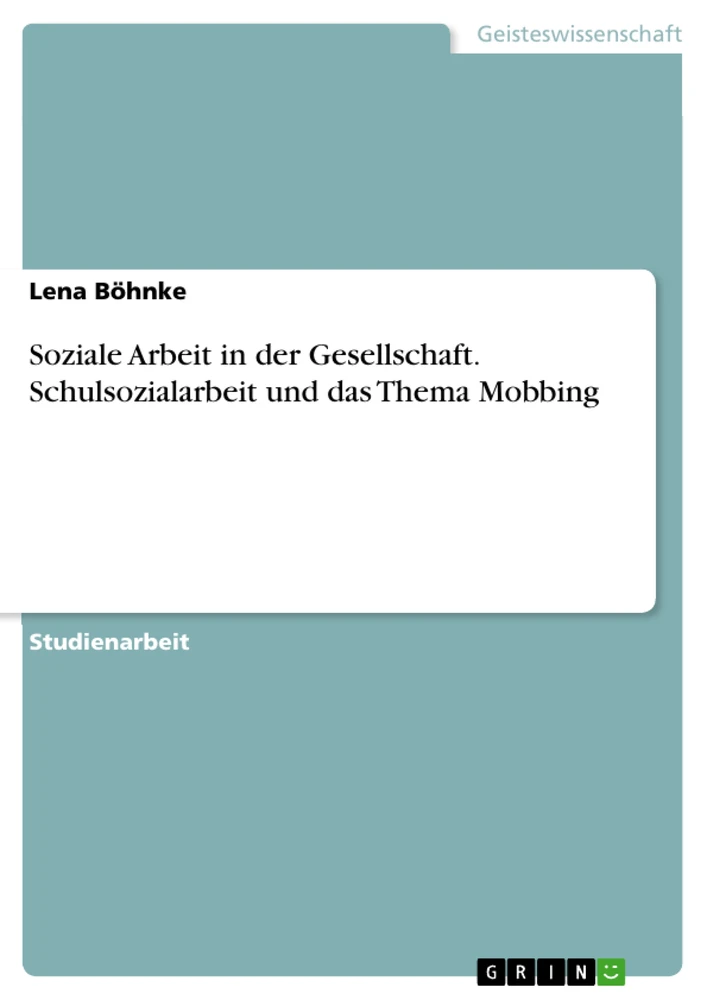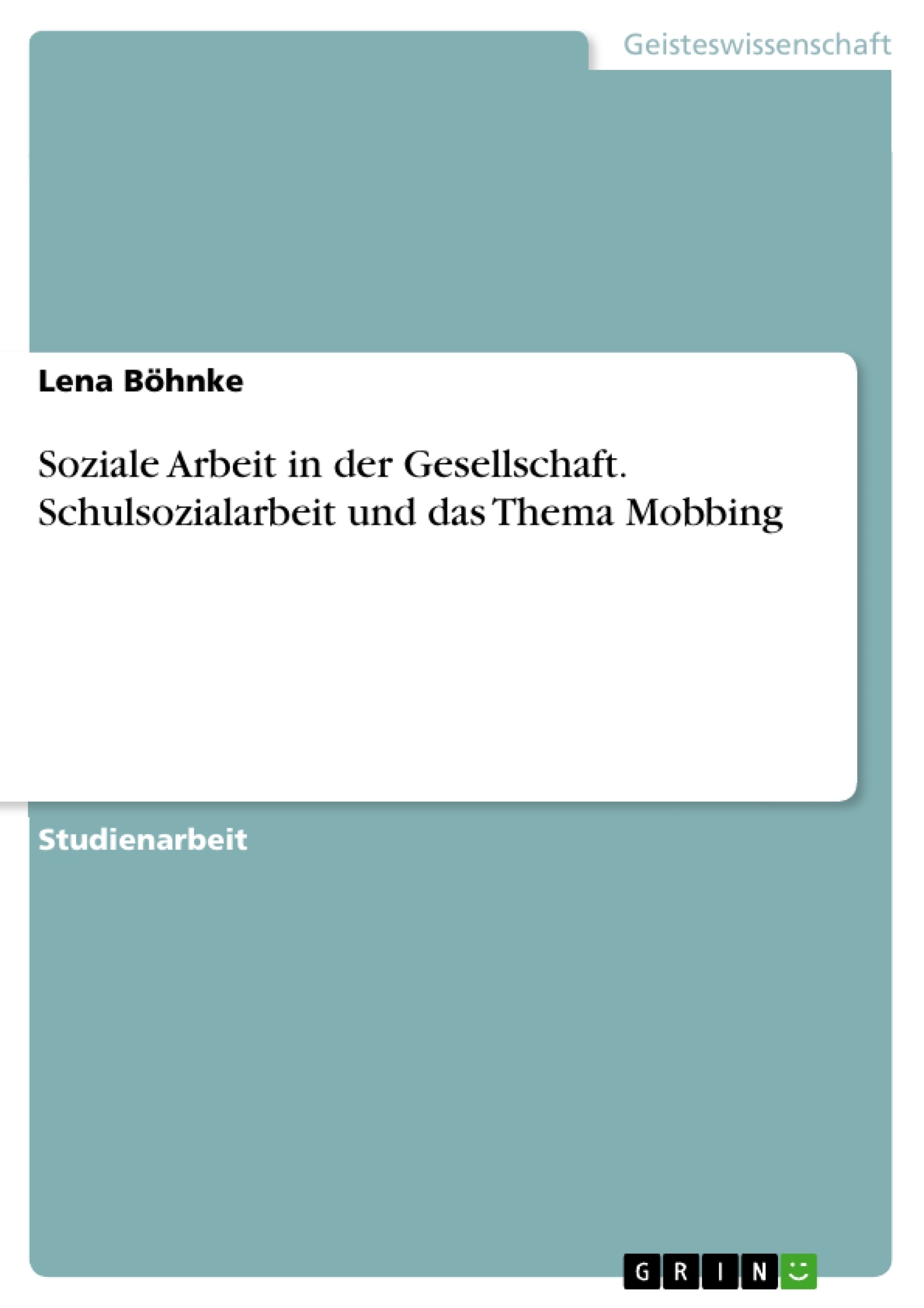Die vorliegende Arbeit behandelt das Thema „Schulsozialarbeit und das Thema Mobbing an Schulen“. Ziel der Arbeit ist es, herauszufinden, wie weit verbreitet das Phänomen Mobbing ist, welche Ursachen und Folgen daraus einstehen und welche wichtige Rolle die Schulsozialarbeit bei der Prävention und Verbesserung von Mobbing an Schulen spielt.
Zunächst einmal wird darauf eingegangen, worum es sich bei dem Begriff „Mobbing“ handelt. Betrachtet werden dabei die Ursachen und Formen von Mobbing und die daraus entstehenden, teils langwierigen oder schweren, Folgen für die Opfer. Weiter wird die Häufigkeit von Mobbing an deutschen Schulen benannt und wird, anhand einer Studie, verdeutlicht.
Daraufhin wird erläutert, worum es bei der Schulsozialarbeit geht und worum es sich dabei handelt. Die Schulsozialarbeit wird hier definiert und es wird um die rechtlichen Grundlagen, die das Achte Sozialgesetzbuch (SGB VIII) für diese Arbeit gibt, gehen. Es wird also auf die rechtlichen Pflichten und auf die Aufgaben von Schulsozialarbeitern eingegangen.
Abschließend wird die Mobbingprävention und inwiefern die Schulsozialarbeit innerhalb dieser tätig werden kann, in den Blick genommen. Es wird erläutert, was der Begriff Prävention bedeutet und auf Handlungsmöglichkeiten der Schulsozialarbeiter eingegangen werden. Als Beispiel eines Präventionsprogramms, wird dabei das „fairplayer“ Programm vorgestellt.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Definition von Mobbing
- 2.1 Ursachen für Mobbing an Schulen
- 2.2 Formen von Mobbing an Schulen
- 2.3 Folgen von Mobbing
- 2.4 Häufigkeit von Mobbing an Deutschen Schulen
- 3 Definition von Schulsozialarbeit
- 3.1 Rechtliche Grundlagen
- 3.2 Aufgaben der Schulsozialarbeit
- 4 Mobbingprävention in der Schule
- 4.1 Der Begriff Prävention
- 4.2 Mobbingprävention durch Schulsozialarbeit
- 4.3 Anti-Mobbing Methoden - Das Programm „fairplayer“
- 4.3.1 Ziele und Hintergrund
- 4.3.2 Inhalt und Methoden
- 5 Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht das Phänomen Mobbing an Schulen und die Rolle der Schulsozialarbeit in der Prävention. Ziel ist es, die Verbreitung von Mobbing, seine Ursachen und Folgen zu beleuchten und den Beitrag der Schulsozialarbeit zur Verbesserung der Situation zu analysieren. Die Arbeit beleuchtet verschiedene Aspekte des Themas.
- Definition und Erscheinungsformen von Mobbing (inkl. Cybermobbing)
- Ursachen von Mobbing aus Täter- und Opferperspektive
- Folgen von Mobbing für Betroffene
- Rechtliche Grundlagen und Aufgaben der Schulsozialarbeit
- Konzepte und Methoden der Mobbingprävention durch Schulsozialarbeit
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema Mobbing an Schulen ein und betont seine Aktualität und Verbreitung. Sie verweist auf die steigende Gewaltbereitschaft unter Schülern und die damit verbundenen weitreichenden Folgen für die Betroffenen. Die Arbeit setzt sich zum Ziel, die Ausbreitung von Mobbing zu untersuchen, Ursachen und Folgen zu analysieren und die Bedeutung der Schulsozialarbeit in der Prävention herauszustellen. Die Einleitung verweist auf die anschließende Struktur der Arbeit, die sich mit der Definition von Mobbing, der Schulsozialarbeit und schließlich der Mobbingprävention auseinandersetzt.
2 Definition von Mobbing: Dieses Kapitel definiert den Begriff "Mobbing" und unterscheidet ihn von gewöhnlichen Konflikten. Es werden verschiedene Formen von Mobbing, einschließlich Cybermobbing, erläutert. Die Definition von Mobbing umfasst vorsätzliche, negative Handlungen einer oder mehrerer Personen gegenüber einem schwächeren Individuum, die über einen längeren Zeitraum andauern. Cybermobbing wird als eine besondere Form beschrieben, die durch die Anonymität des Internets gekennzeichnet ist und oft zu einer verschärften Situation führt. Das Kapitel unterstreicht den sozialen Aspekt von Mobbing, an dem neben Tätern und Opfern auch Mitläufer beteiligt sind.
3 Definition von Schulsozialarbeit: Dieses Kapitel beleuchtet die Schulsozialarbeit und deren rechtliche Grundlagen im achten Sozialgesetzbuch (SGB VIII). Es beschreibt die Aufgaben und Pflichten von Schulsozialarbeitern und deren Rolle im Schulsystem. Der Fokus liegt auf der Definition der Schulsozialarbeit und der rechtlichen Rahmenbedingungen, die ihre Arbeit bestimmen. Die gesetzlichen Grundlagen werden erläutert, um die Position und die Aufgaben der Schulsozialarbeit im Kontext des Themas Mobbing zu verdeutlichen.
4 Mobbingprävention in der Schule: Dieses Kapitel konzentriert sich auf die Mobbingprävention und die Rolle der Schulsozialarbeit in diesem Bereich. Es definiert den Begriff Prävention und präsentiert verschiedene Handlungsmöglichkeiten für Schulsozialarbeiter. Ein detailliertes Beispiel für ein Präventionsprogramm, das "fairplayer"-Programm, wird vorgestellt. Der Kapitel beschreibt Ziele, Methoden und Inhalte dieses Programms, um die praktische Umsetzung von Präventionsmaßnahmen aufzuzeigen.
Schlüsselwörter
Mobbing, Schulsozialarbeit, Cybermobbing, Prävention, SGB VIII, Anti-Mobbing-Programme, Gewaltprävention, Soziales Klima, Schülerwohl, Intervention.
Häufig gestellte Fragen zu: Mobbingprävention durch Schulsozialarbeit
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit befasst sich mit dem Phänomen Mobbing an Schulen und der Rolle der Schulsozialarbeit in der Prävention. Sie untersucht die Verbreitung von Mobbing, seine Ursachen und Folgen und analysiert den Beitrag der Schulsozialarbeit zur Verbesserung der Situation.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt verschiedene Aspekte von Mobbing und Schulsozialarbeit, darunter die Definition und Erscheinungsformen von Mobbing (einschließlich Cybermobbing), die Ursachen aus Täter- und Opferperspektive, die Folgen für Betroffene, die rechtlichen Grundlagen und Aufgaben der Schulsozialarbeit sowie Konzepte und Methoden der Mobbingprävention durch Schulsozialarbeit.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel: Einleitung, Definition von Mobbing, Definition von Schulsozialarbeit, Mobbingprävention in der Schule und Fazit. Jedes Kapitel befasst sich mit einem spezifischen Aspekt des Themas.
Was wird unter Mobbing verstanden?
Mobbing wird definiert als vorsätzliche, negative Handlungen einer oder mehrerer Personen gegenüber einem schwächeren Individuum, die über einen längeren Zeitraum andauern. Cybermobbing wird als eine besondere, durch Anonymität des Internets gekennzeichnete Form beschrieben.
Welche Formen von Mobbing werden beschrieben?
Die Arbeit beschreibt verschiedene Formen von Mobbing, einschließlich Cybermobbing, und beleuchtet den sozialen Aspekt, an dem neben Tätern und Opfern auch Mitläufer beteiligt sind.
Welche Folgen hat Mobbing?
Die Arbeit beleuchtet die weitreichenden Folgen von Mobbing für die Betroffenen, die durch die steigende Gewaltbereitschaft unter Schülern verstärkt werden.
Welche Rolle spielt die Schulsozialarbeit?
Die Schulsozialarbeit spielt eine zentrale Rolle in der Mobbingprävention. Die Arbeit beschreibt die rechtlichen Grundlagen der Schulsozialarbeit im SGB VIII, ihre Aufgaben und Pflichten im Schulsystem und ihre Möglichkeiten im Umgang mit Mobbing.
Welche Präventionsmethoden werden vorgestellt?
Die Arbeit stellt verschiedene Handlungsmöglichkeiten für Schulsozialarbeiter in der Mobbingprävention vor und beschreibt detailliert das "fairplayer"-Programm mit seinen Zielen, Methoden und Inhalten als Beispiel für eine praktische Umsetzung von Präventionsmaßnahmen.
Welche rechtlichen Grundlagen werden betrachtet?
Die Arbeit erläutert die rechtlichen Grundlagen der Schulsozialarbeit im achten Sozialgesetzbuch (SGB VIII).
Welche Schlüsselwörter sind relevant?
Schlüsselwörter sind: Mobbing, Schulsozialarbeit, Cybermobbing, Prävention, SGB VIII, Anti-Mobbing-Programme, Gewaltprävention, Soziales Klima, Schülerwohl, Intervention.
- Citar trabajo
- Lena Böhnke (Autor), 2021, Soziale Arbeit in der Gesellschaft. Schulsozialarbeit und das Thema Mobbing, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1181603