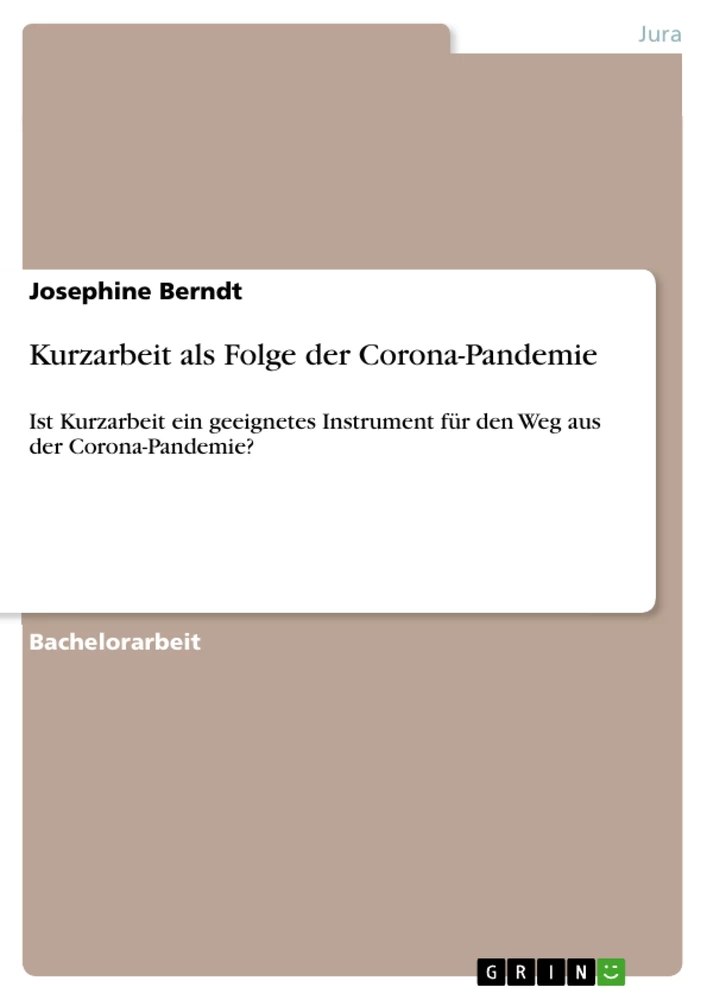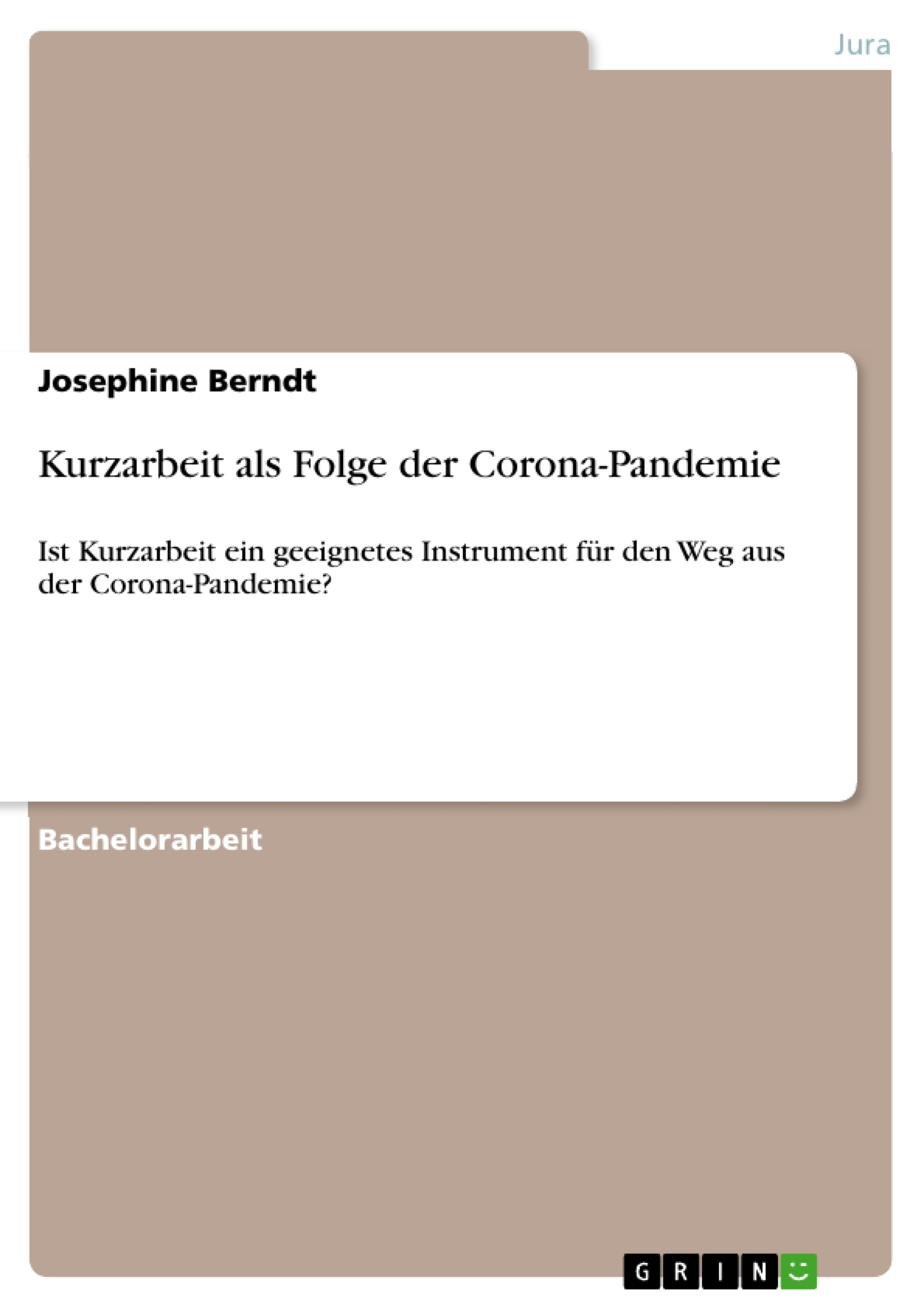Diese Arbeit soll die Kurzarbeit in Verbindung mit dem Kurzarbeitergeld als arbeitsmarktpolitisches Instrument beschreiben, dessen Wirkungsfähigkeit für Unternehmen während der Corona-Pandemie darstellen und einstufen, wie es Unternehmen unterstützen kann, die Krise zu überstehen und welche wirtschaftlichen Folgen die Corona-Pandemie mit sich gebracht hat. Welche wirtschaftlichen Folgen hat die Corona-Pandemie und die daraus folgenden Anordnungen von Kurzarbeit durch die in Existenzangst befindlichen Arbeitgeber, deren Betriebe aufgrund entsprechender Verordnungen geschlossen werden mussten? Was ist Kurzarbeit und das Coronavirus eigentlich und wer hat das Coronavirus zu einer Pandemie erklärt und welche Folgen sind damit einhergegangen? Hier wird auch auf das Infektionsschutzgesetz eingegangen und anhand des Verhältnismäßigkeitsgrundsatz geprüft.
Inhaltsverzeichnis
- Inhaltsverzeichnis
- Abbildungsverzeichnis
- Abkürzungsverzeichnis
- Einleitung
- Aufbau der Arbeit
- Ziel der Arbeit
- Rechtsgrundlagen der Kurzarbeit
- Covid-19 Vom Virus zur Pandemie
- Der Rechtsstaat während der Corona-Pandemie
- Infektionsschutzgesetz
- Folgen der Anwendung des Infektionsschutzgesetzes
- Entwicklung der Kurzarbeit – Corona-Pandemie vs. Finanzkrise 2008/2009
- Struktur und Funktion der Kurzarbeit
- Voraussetzungen für die Einführung von Kurzarbeit
- Arbeitsrechtlichen Voraussetzungen für die Einführung von Kurzarbeit
- Arbeitsvertragliche Kurzarbeitsklauseln und Zusatzvereinbarungen zum Arbeitsvertrag
- Betriebsvereinbarung
- Tarifliche Kurzarbeitsklauseln
- Sozialrechtliche Voraussetzungen für den Anspruch auf Kurzarbeitergeld
- Erheblicher Arbeitsausfall
- Wirtschaftliche Gründe
- Unabwendbares Ereignis
- Vorübergehender Arbeitsausfall
- Unvermeidbarer Arbeitsausfall
- Einsatz von Urlaubsguthaben
- Arbeitszeitkonten
- Betriebliche Voraussetzungen
- Persönliche Voraussetzungen
- Kurzarbeitergeld
- Verfahren zur Bewilligung von Kurzarbeitergeld
- Anzeige des Arbeitsausfalls
- Antrag auf Kurzarbeitergeld
- Höhe, Dauer und Verbeitragung des Kurzarbeitergeldes
- Zuschüsse zum Kurzarbeitergeld durch den Arbeitgeber
- Betriebsbedingte Kündigung trotz Kurzarbeit
- Gesetzliche Änderungen aufgrund der Corona-Pandemie - Gesetz zur befristeten krisenbedingten Verbesserung der Regelungen für das Kurzarbeitergeld
- Gesetz zur befristeten krisenbedingten Verbesserung der Regelungen für das Kurzarbeitergeld
- § 1 KugV – Senkung der Anforderungen für die Gewährung von Kurzarbeitergeld
- § 2 KugV – Erstattung von Sozialversicherungsbeiträgen
- § 3 KugV - Öffnung von Kurzarbeit für Leiharbeitnehmerinnen und Leiharbeitnehmer
- Entfall der Pflicht zum vorrangigen Einsatz negativer Arbeitszeitsalden
- Nebentätigkeit und Kurzarbeitergeld
- Stufenweise Erhöhung des Kurzarbeitergeldes
- Förderung der beruflichen Weiterbildung im Strukturwandel und zur Weiterentwicklung der Ausbildungsförderung
- Ähnliche Modelle der Kurzarbeit in anderen europäischen Staaten
- Modell der Kurzarbeit in England
- Modell der Kurzarbeit in Schweden
- Modell der Kurzarbeit in Österreich
- Auswirkungen der Corona-Pandemie auf den Arbeitsmarkt und die Wirtschaft
- Vorteile und Nachteile der Kurzarbeit
- Fazit
- Rechtsgrundlagen und Funktionsweise der Kurzarbeit
- Auswirkungen der Corona-Pandemie auf den Arbeitsmarkt und die Wirtschaft
- Vorteile und Nachteile der Kurzarbeit als Kriseninstrument
- Gesetzliche Anpassungen im Kontext der Pandemie
- Vergleichende Betrachtung von Kurzarbeitsmodellen in anderen europäischen Ländern
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit beschäftigt sich mit der Kurzarbeit im Kontext der Corona-Pandemie und analysiert ihre Eignung als Instrument zur Bewältigung der durch die Pandemie bedingten wirtschaftlichen Herausforderungen.
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, die den Aufbau und die Zielsetzung der Arbeit erläutert. Anschließend werden die Rechtsgrundlagen der Kurzarbeit vorgestellt, wobei der Fokus auf die relevanten Gesetze und Vorschriften im Zusammenhang mit Kurzarbeit liegt.
Kapitel VII beleuchtet die Covid-19 Pandemie und ihre Auswirkungen auf den Rechtsstaat. Es werden die wichtigsten Maßnahmen des Infektionsschutzgesetzes und ihre Folgen für die Wirtschaft und den Arbeitsmarkt diskutiert.
Kapitel VIII analysiert die Struktur und Funktion der Kurzarbeit im Allgemeinen und im Besonderen im Kontext der Corona-Pandemie. Dabei werden die Voraussetzungen für die Einführung von Kurzarbeit sowohl aus arbeitsrechtlicher als auch aus sozialrechtlicher Sicht beleuchtet.
In Kapitel IX wird das Kurzarbeitergeld im Detail betrachtet. Es werden die Verfahren zur Bewilligung des Kurzarbeitergeldes sowie die Höhe, Dauer und Verbeitragung des Kurzarbeitergeldes erläutert.
Kapitel X widmet sich der Frage der betriebsbedingten Kündigung trotz Kurzarbeit. Es wird untersucht, ob und unter welchen Voraussetzungen eine Kündigung trotz Kurzarbeit rechtmäßig ist.
Kapitel XI befasst sich mit den gesetzlichen Änderungen, die im Kontext der Corona-Pandemie auf das Kurzarbeitergeld eingeführt wurden. Es werden die wichtigsten Anpassungen des Gesetzes zur befristeten krisenbedingten Verbesserung der Regelungen für das Kurzarbeitergeld (KugV) analysiert.
Kapitel XII bietet einen vergleichenden Blick auf ähnliche Modelle der Kurzarbeit in anderen europäischen Staaten wie England, Schweden und Österreich.
Kapitel XIII untersucht die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf den Arbeitsmarkt und die Wirtschaft.
In Kapitel XIV werden die Vorteile und Nachteile der Kurzarbeit als Kriseninstrument zusammengefasst und bewertet.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit dem Thema Kurzarbeit und beleuchtet seine Relevanz im Kontext der Corona-Pandemie. Die wichtigsten Schlüsselwörter sind daher Kurzarbeit, Corona-Pandemie, Arbeitsmarkt, Wirtschaft, Rechtsgrundlagen, Sozialrecht, Kurzarbeitergeld, Arbeitsausfall, Covid-19, Infektionsschutzgesetz, Kriseninstrument, Gesetz zur befristeten krisenbedingten Verbesserung der Regelungen für das Kurzarbeitergeld (KugV), Europäische Union, Vergleichende Analyse.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Zweck von Kurzarbeit in einer Pandemie?
Kurzarbeit dient als arbeitsmarktpolitisches Instrument, um Entlassungen bei vorübergehendem Arbeitsausfall zu vermeiden und Unternehmen in Krisenzeiten finanziell zu entlasten.
Welche Voraussetzungen müssen für Kurzarbeitergeld erfüllt sein?
Es muss ein erheblicher Arbeitsausfall aus wirtschaftlichen Gründen oder aufgrund eines unabwendbaren Ereignisses vorliegen, der vorübergehend und unvermeidbar ist.
Wie wurde das Kurzarbeitergeld während Corona verbessert?
Durch das KugV wurden Anforderungen gesenkt, Sozialversicherungsbeiträge erstattet und das Kurzarbeitergeld stufenweise erhöht sowie für Leiharbeitnehmer geöffnet.
Ist eine Kündigung trotz Kurzarbeit möglich?
Die Arbeit untersucht, unter welchen rechtlichen Bedingungen betriebsbedingte Kündigungen trotz laufender Kurzarbeit zulässig bleiben.
Welche Rolle spielt das Infektionsschutzgesetz?
Es bildete die rechtliche Grundlage für Betriebsschließungen, was wiederum den massiven Bedarf an Kurzarbeit auslöste und rechtlich auf seine Verhältnismäßigkeit geprüft wurde.
- Citation du texte
- Josephine Berndt (Auteur), 2021, Kurzarbeit als Folge der Corona-Pandemie, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1181640