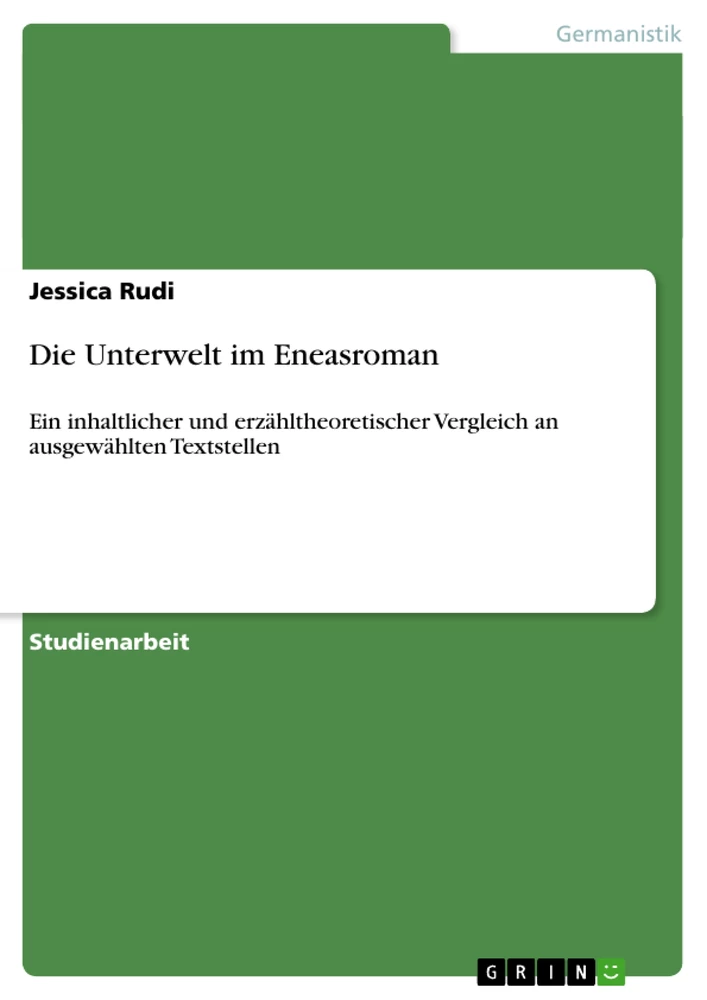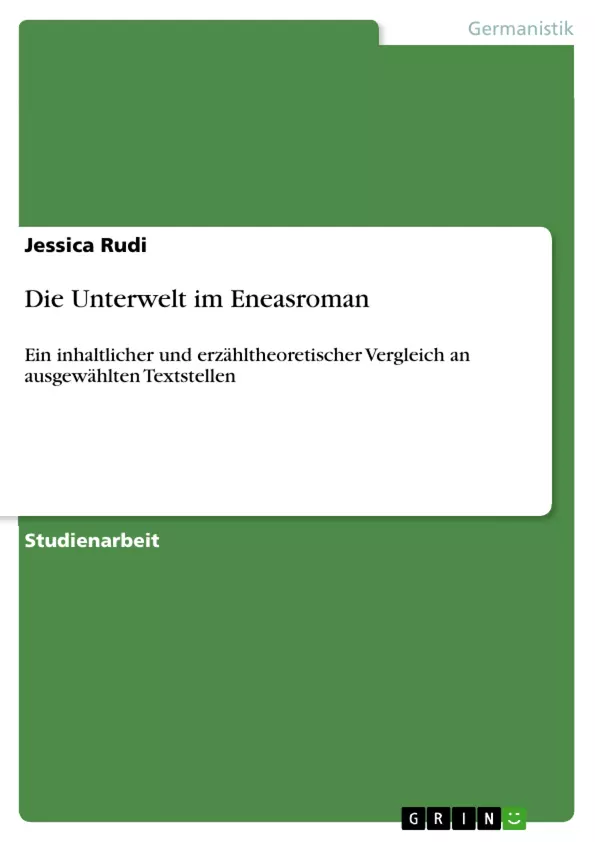Die folgende Arbeit betrachtet die Unterwelt des Eneasromans von Heinrich von Veldeke. Im ersten Kapitel wird der Text Veldekes mit der antiken Aeneis Vergils und mit dem mittelalterlichen Roman d'Eneas, dessen Autor nicht bekannt ist, verglichen. Das Hauptaugenmerk liegt darauf, wie die mittelalterlichen Autoren mit dem antiken Stoff der Aeneis umgegangen sind. An ausgewählten Textstellen soll aufgezeigt werden, welche Teile des Textes und welche Topoi sie einer christlichen Adaptation unterzogen haben und welche Elemente des antiken Stoffes anverwandelt wurden. [...] Das zweite Kapitel behandelt den Eneasroman unter dem Blickpunkt der Erzählstruktur. Die Frage wird untersucht, ob und inwieweit Veldeke bzw. der Anonymus die Struktur seiner Vorlagen übernommen hat und inwiefern er eine eigene Konzepte entwickelt hat. Weiter ist relevant ob und in wieweit die mittelalterlichen Autoren Vergils narrative Anachronien übernommen oder verändert haben, mit welcher Absicht sie dies getan haben und welchen Konsequenzen daraus folgen. Im darauf folgenden Unterkapitel steht die Frage nach der verwendeten Erzählperspektive. Das letzte Unterkapitel beschäftigt sich mit der Frage nach der Fiktionalität; welche Signale und rhetorische Mittel hat Veldeke benutzt im Umgang mit den Vorlagen? Welche Indizien sprechen dafür, dass Veldeke die Vorlagen als Fiktion behandelt hat und welche sprechen dagegen?
Inhaltsverzeichnis
- Einführung
- I. Die Unterwelt
- 1.1 Vorbereitung zur Katabasis: Die Sibylle
- 1.2 Katabasis
- 1.2.1 Dido
- 1.2.2 Elysium
- 1.2.3 ...
- 1.3 Anabasis: Das Tor der Träume
- II. Die Erzählkonzepte in der Unterwelt der Eneasromane mit Blick auf die vergilische Vorlage
- 2.1 Erzählstruktur und -konzeption
- 2.2 Narrative Anachronien
- 2.3 Erzählperspektive
- 2.4 Authentizität und Glaubwürdigkeit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Darstellung der Unterwelt im Eneasroman von Heinrich von Veldeke im Vergleich zu Vergils Aeneis und dem mittelalterlichen Roman d'Eneas. Die Hauptziele sind die Analyse der Adaption des antiken Stoffes durch die mittelalterlichen Autoren, die Identifizierung christlicher Adaptionen und Veränderungen antiker Elemente, sowie die Erforschung der Gründe für diese Veränderungen. Die Analyse fokussiert auf ausgewählte Textstellen.
- Vergleich der Darstellung der Unterwelt in den drei Texten (Vergil, Veldeke, Roman d'Eneas).
- Analyse der christlichen Adaptionen und Veränderungen antiker Topoi.
- Untersuchung der Erzählstruktur und -konzeption im Eneasroman von Veldeke.
- Analyse der Erzählperspektive und der Frage nach der Fiktionalität.
- Erforschung der Gründe für die Übernahme und Veränderung der Vorlage durch die mittelalterlichen Autoren.
Zusammenfassung der Kapitel
Einführung: Die Arbeit vergleicht die Darstellung der Unterwelt im Eneasroman von Heinrich von Veldeke mit der Vergilschen Aeneis und dem mittelalterlichen Roman d'Eneas. Sie untersucht, wie mittelalterliche Autoren den antiken Stoff adaptiert und christlich interpretiert haben, und analysiert die Auswahl und Veränderung von Textstellen. Der Fokus liegt auf der Begegnung mit der Sibylle, Didos Selbstmord, dem Elysium, Anchises und dem Reinkarnationskonzept, sowie dem Ausgang aus der Unterwelt.
I. Die Unterwelt: Dieses Kapitel analysiert verschiedene Aspekte der Unterweltdarstellung in Veldekes Eneasroman im Vergleich zu seinen Vorlagen. Die Vorbereitung auf die Katabasis wird durch die Begegnung mit der Sibylle beleuchtet, wobei die Unterschiede in ihrer Darstellung (Aussehen, Funktion, Beziehung zu Apollo) in den drei Texten herausgearbeitet werden. Die Katabasis selbst wird anhand von Schlüsselbegebenheiten untersucht, einschließlich Eneas' Begegnung mit Dido und die Beschreibung des Elysiums, wobei der Umgang der mittelalterlichen Dichter mit Didos Selbstmord und die Vereinbarkeit des Elysiums mit mittelalterlich-christlichen Vorstellungen im Mittelpunkt stehen. Schließlich wird die Anabasis, insbesondere der Ausgang aus der Unterwelt und die Symbolik der beiden Tore, behandelt. Der Vergleich der Texte verdeutlicht die unterschiedlichen Interpretationen und Adaptionen des antiken Stoffes im Mittelalter.
II. Die Erzählkonzepte in der Unterwelt der Eneasromane mit Blick auf die vergilische Vorlage: Dieses Kapitel konzentriert sich auf die erzähltechnischen Aspekte von Veldekes Eneasroman im Vergleich zu Vergils Aeneis. Es analysiert die Erzählstruktur und -konzeption, untersucht, inwieweit Veldeke bzw. der anonyme Autor des Roman d'Eneas die Struktur ihrer Vorlagen übernommen oder eigene Konzepte entwickelt haben. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf den narrativen Anachronien und deren möglicher Absicht und Konsequenzen. Abschließend wird die Erzählperspektive und die Frage nach der Fiktionalität des Werkes behandelt, indem die rhetorischen Mittel untersucht werden, die Veldeke im Umgang mit seinen Vorlagen eingesetzt hat.
Schlüsselwörter
Heinrich von Veldeke, Eneasroman, Aeneis, Roman d'Eneas, Unterwelt, Katabasis, Anabasis, Sibylle, Dido, Elysium, Anchises, Reinkarnation, Erzählstruktur, Erzählperspektive, Fiktionalität, christliche Adaption, antiker Stoff, Topoi, mittelalterliche Literatur.
Häufig gestellte Fragen zum Eneasroman von Heinrich von Veldeke
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit vergleicht die Darstellung der Unterwelt im Eneasroman von Heinrich von Veldeke mit Vergils Aeneis und dem mittelalterlichen Roman d'Eneas. Sie analysiert die Adaption des antiken Stoffes durch mittelalterliche Autoren, christliche Adaptionen und Veränderungen antiker Elemente, und die Gründe für diese Veränderungen. Der Fokus liegt auf ausgewählten Textstellen, insbesondere der Begegnung mit der Sibylle, Didos Selbstmord, dem Elysium, Anchises und dem Reinkarnationskonzept.
Welche Texte werden verglichen?
Die Arbeit vergleicht drei Texte: den Eneasroman von Heinrich von Veldeke, Vergils Aeneis und den mittelalterlichen Roman d'Eneas. Der Vergleich konzentriert sich auf die Darstellung der Unterwelt und die erzähltechnischen Aspekte.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themenschwerpunkte: den Vergleich der Unterweltdarstellung in den drei Texten; die Analyse christlicher Adaptionen und Veränderungen antiker Topoi; die Untersuchung der Erzählstruktur und -konzeption im Eneasroman von Veldeke; die Analyse der Erzählperspektive und der Frage nach der Fiktionalität; und die Erforschung der Gründe für die Übernahme und Veränderung der Vorlage durch die mittelalterlichen Autoren.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einführung und zwei Hauptkapitel. Das erste Kapitel analysiert die Darstellung der Unterwelt (Katabasis und Anabasis) in den drei Texten, mit Fokus auf die Begegnung mit der Sibylle, Dido, dem Elysium und Anchises. Das zweite Kapitel konzentriert sich auf die Erzählkonzepte, einschließlich Erzählstruktur, narrativen Anachronien, Erzählperspektive und Fiktionalität.
Welche Schlüsselbegebenheiten werden im Detail untersucht?
Die Arbeit untersucht im Detail die Begegnung mit der Sibylle (ihren Aussehen, Funktion und Beziehung zu Apollo), Didos Selbstmord und die unterschiedliche Behandlung dieses Themas in den drei Texten, die Beschreibung des Elysiums und seine Vereinbarkeit mit mittelalterlich-christlichen Vorstellungen, sowie den Ausgang aus der Unterwelt (die Symbolik der Tore).
Welche Aspekte der Erzähltechnik werden analysiert?
Die Analyse der Erzähltechnik umfasst die Erzählstruktur und -konzeption, narrative Anachronien und ihre möglichen Absichten und Konsequenzen, die Erzählperspektive und die Frage nach der Fiktionalität des Werkes. Die Arbeit untersucht auch die rhetorischen Mittel, die Veldeke im Umgang mit seinen Vorlagen eingesetzt hat.
Welche Schlussfolgerungen werden gezogen?
Die Arbeit zieht Schlussfolgerungen über die Adaption und Interpretation des antiken Stoffes durch mittelalterliche Autoren, die Rolle christlicher Einflüsse auf die Darstellung der Unterwelt, und die Entwicklung der Erzähltechniken im mittelalterlichen Eneasroman im Vergleich zu seiner antiken Vorlage.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt?
Schlüsselwörter: Heinrich von Veldeke, Eneasroman, Aeneis, Roman d'Eneas, Unterwelt, Katabasis, Anabasis, Sibylle, Dido, Elysium, Anchises, Reinkarnation, Erzählstruktur, Erzählperspektive, Fiktionalität, christliche Adaption, antiker Stoff, Topoi, mittelalterliche Literatur.
- Arbeit zitieren
- Jessica Rudi (Autor:in), 2007, Die Unterwelt im Eneasroman , München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/118166