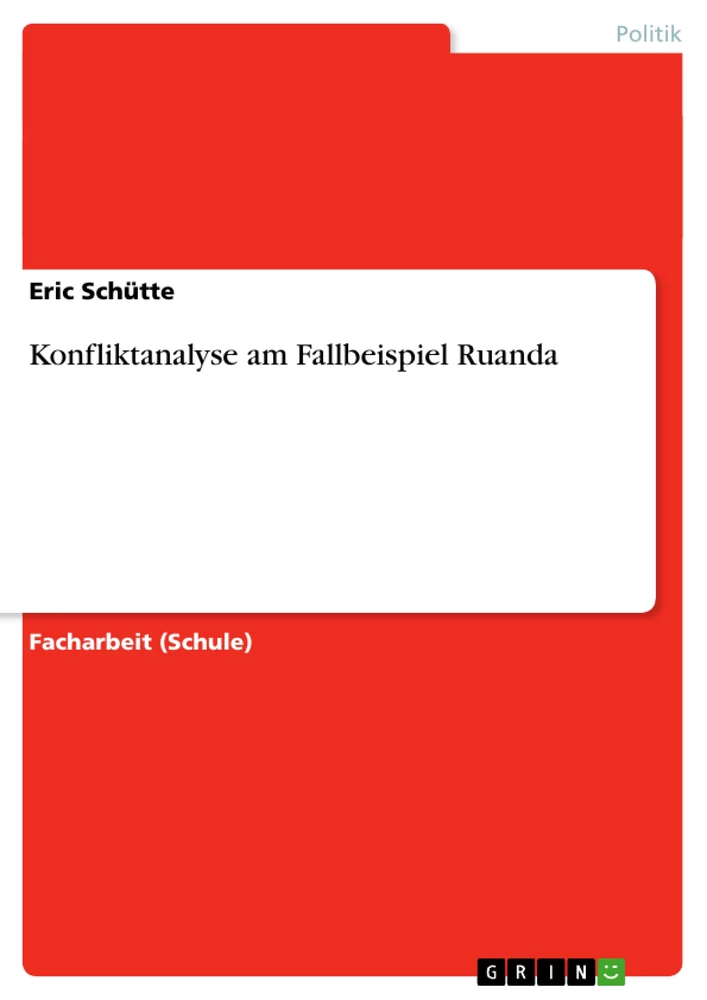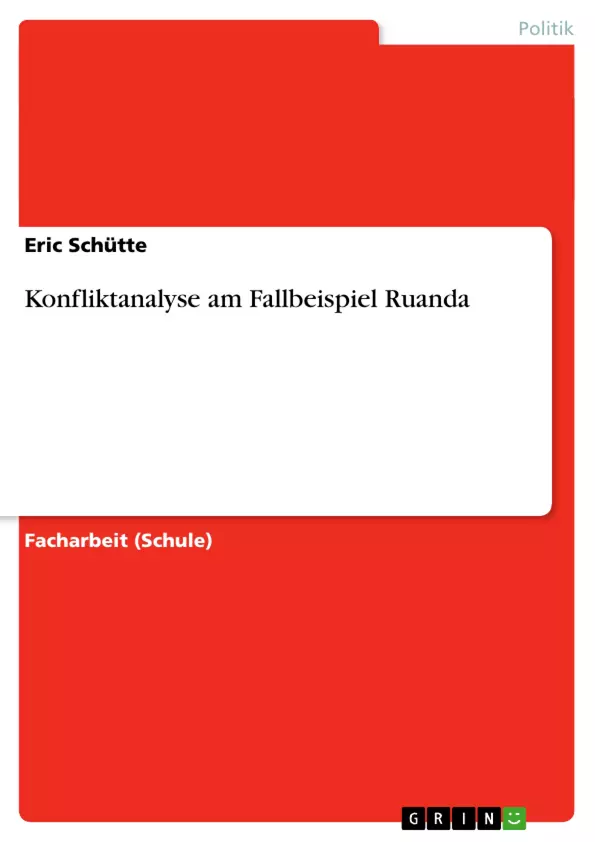Fast nun schon 14 Jahre nach dem Genozid in Ruanda befindet sich die Bevölkerung des zentralafrikanischen Landes immer noch in einem traumatisierten, schockhaften Zustand. Im Jahr 1994 kam es zwischen extremistischen Hutus einerseits und RPF Rebellen anderseits zu völkermordähnlichen Ausschreitungen, von welchen vor allem die Tutsi-Bevölkerung, aber auch der Hutu-Anteil betroffen waren. Innerhalb von 100 Tagen wurden mehr Menschen auf brutalster Weise getötet und hingerichtet, als vergleichsweise im Holocaust. Schätzungen reichen von mindestens 500.000 bis zu 1.000.000 Toten. Parallel dazu brachte der Bürgerkrieg eine Flüchtlingswelle hervor, die ca. 3 Millionen Menschen zählte (fast die Hälfte der ruandischen Bevölkerung), welche zum Teil noch bis heute andauert. Geht man heute durch das Land, so findet man immer noch geisterhafte Orte vor, Orte, in denen Ruinen und Leichenberge an die schrecklichen Auswirkungen des Völkermords von vor vierzehn Jahren auf brutalste Weise erinnern. Noch hat die neue Regierung in Ruanda nicht genügend finanzielle Mittel, um Gedenkstätten oder Friedhöfe zu errichten, auf denen die Opfer des Massakers ihren ersehnten Frieden finden könnten.
Das Thema „aktuelle Konflikte und Spannungen im Kontext von 1994“ sind in der ruandischen Bevölkerung Tabu-Themen, gegenüber denen nur wenige sich differenziert äußern. Meistens werden verallgemeinerte Antworten gegeben, wie „hier gibt es keine sozialen/gesellschaftlichen Konflikte“ oder „mangelnde Reintegration von Rückkehrern und Flüchtlingen war nur bis Ende der 1990er Jahre ein Problem, all das ist heute abgeschlossen“. Doch noch immer ist den Menschen ein tiefsitzender Schock anzumerken, welcher zu ängstlich ist, um sich zu zeigen doch zu stark, als das er verblassen könnte. [...]
Eric Schütte 15.03.2008
Klasse 13
Fach: Politische Bildung
Konfliktanalyse am Fallbeispiel Ruanda
“Here in Rwanda we are still in war.
Not in the literally sense of “war”,
but we are still in alert
and we have to be prepared.”
(Ruandischer Intellektueller, September 2003)
Fast nun schon 14 Jahre nach dem Genozid in Ruanda befindet sich die Bevölkerung des zentralafrikanischen Landes immer noch in einem traumatisierten, schockhaften Zustand. Im Jahr 1994 kam es zwischen extremistischen Hutus einerseits und RPF Rebellen anderseits zu völkermordähnlichen Ausschreitungen, von welchen vor allem die Tutsi-Bevölkerung, aber auch der Hutu-Anteil betroffen waren. Innerhalb von 100 Tagen wurden mehr Menschen auf brutalster Weise getötet und hingerichtet, als vergleichsweise im Holocaust. Schätzungen reichen von mindestens 500.000 bis zu 1.000.000 Toten. Parallel dazu brachte der Bürgerkrieg eine Flüchtlingswelle hervor, die ca. 3 Millionen Menschen zählte (fast die Hälfte der ruandischen Bevölkerung), welche zum Teil noch bis heute andauert. Geht man heute durch das Land, so findet man immer noch geisterhafte Orte vor, Orte, in denen Ruinen und Leichenberge an die schrecklichen Auswirkungen des Völkermords von vor vierzehn Jahren auf brutalste Weise erinnern. Noch hat die neue Regierung in Ruanda nicht genügend finanzielle Mittel, um Gedenkstätten oder Friedhöfe zu errichten, auf denen die Opfer des Massakers ihren ersehnten Frieden finden könnten.
Das Thema „aktuelle Konflikte und Spannungen im Kontext von 1994“ sind in der ruandischen Bevölkerung Tabu-Themen, gegenüber denen nur wenige sich differenziert äußern. Meistens werden verallgemeinerte Antworten gegeben, wie „hier gibt es keine sozialen/gesellschaftlichen Konflikte“ oder „mangelnde Reintegration von Rückkehrern und Flüchtlingen war nur bis Ende der 1990er Jahre ein Problem, all das ist heute abgeschlossen“. Doch noch immer ist den Menschen ein tiefsitzender Schock anzumerken, welcher zu ängstlich ist, um sich zu zeigen doch zu stark, als das er verblassen könnte.(1)
Das gegenwärtige Programm der ruandischen Regierung, in ihrem Land eine Phase der politischen, ökonomischen und sozialen Konsolidierung einzuläuten und somit „Einheit und Versöhnung“ herzustellen, zeigt jedoch wenig Resonanz und Ergebnisse. Repressivität und Unsicherheit kennzeichnen die Verhaltensweisen der Einwohner. Diese Unsicherheit ist vor allem im Kontext des durch die Regierung angesetzten Programms der nationalen Einheit und Versöhnung zu sehen, welches Vereinbarungen hinsichtlich des zu verwendenden Sprachgebrauchs vorgibt. Durch die offizielle Abschaffung der Begriffe „Hutu“ und „Tutsi“ werden von den Menschen neue Konstrukte geschaffen, welche vielmehr der Verschleierung und Unterdrückung der dabei hervorgerufenen Emotionen dienen, als dass sie einer Versöhnung entgegenkommen könnten. So existieren weiterhin soziale Differenzen und verhasste Gefühle zwischen den Bevölkerungsgruppen, welche den endgültigen Frieden und demokratische Gleichberechtigung unmöglich machen.
Betrachtet man allein die Statistiken des Bürgerkriegs von 1994 und die heutigen Folgen, so stellt sich ganz von selbst die Frage, wie es zu einer solchen Eskalation kommen konnte. Wo liegen die historischen Wurzeln in diesem Konflikt, wie hat er sich entwickelt und wie konnte es zu einer solchen Ausuferung kommen? Hatte die internationale Gemeinschaft, welche doch den Frieden auf der Welt bewahren soll, geschlafen?
Diese Fragen möchte ich in der folgenden Konfliktanalyse beantworten.
Als erstes sind die historischen Wurzeln und die Entwicklung des Konfliktes zu betrachten. In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts bildete sich unter den staatlichen Zentralisierungstendenzen des Königreichs eine erste Differenzierung zwischen den Bevölkerungsgruppen heraus. Die Tutsi, welche vorwiegend Viehwirtschaft betrieben, erlangten zunehmend Macht und wurden immer mehr mit in die Politik und Verwaltung miteinbezogen. Die Hutu, die hauptsächlich dem Ackerbau nachgingen, etablierten sich als beherrschte Bevölkerungsschicht unter den Tutsi. Eine dritte Bevölkerungsgruppe, nämlich die Twa, die als Jäger und Sammler galten, spielten in der Entwicklung dieser Differenzierung eher eine unbedeutende Rolle und werden in meiner Konfliktanalyse außen vorgelassen.
Als dann 1899 die Deutschen die Kolonialherrschaft über Ruanda erlangten, wurde die soziale und politische Unterscheidung der Bevölkerungsgruppen manifestiert. Die Deutschen begründeten die abgestuften Sozialbeziehungen in Ruanda mit der europäisch-rassistischen Hamitentheorie und banden die bereits etablierten Tutsi als lokale Machtträger in das System ihrer indirekten Herrschaft mit ein.
Nach dem Ersten Weltkrieg, als Ruanda den Deutschen durch den Versailler Vertrag abgesprochen und durch die Belgier übernommen wurde, wurde das System der ungleichen Machtverteilung auf Basis von rassistischen Unterschieden zwischen Tutsi und Hutu fortgesetzt. Als 1933/34 die Ausstellung von Ausweispapieren infolge einer Volkszählung erfolgte, wurde die ethnische Zugehörigkeit eines jeden festgelegt und somit die rassistische Biologisierung der Einwohner fixiert. Auch die Bildungsförderung durch katholische Missionarsschulen richtete sich nach dieser festgelegten Differenzierung. Während noch vor dem Zweiten Weltkrieg die Tutsi im Bildungswesen bevorzugt wurden, galt danach die besondere Förderung der Hutu aufgrund neuen ideologischer Grundsätze der katholischen Mission. Gefördert durch die nun auch den Hutu zugängliche Bildung, bildete sich ein Hutu-Klerus, der der Tusi-Herrschaft als Opposition entgegenstand.
In den 1950ern, als eine Dekolonisation Ruandas absehbar wurde, kam es zu ersten Parteigründungen entlang der ethnischen Grenzen. Dabei setzten die Tutsi-Parteien auf die Weiterführung ihrer Monarchie, während die Hutu durch Diffamierung der Tutsi-Hegemonie in ihren eigenen Reihen extremistische Politiker hervorbrachten. Als dann 1959 der Tutsi Monarch Rudahigwa starb, eskalierte die Situation zwischen den Bevölkerungsgruppen: Hunderte Menschen starben infolge von brutalen Auseinandersetzungen. Als diese durch die Belgier niedergeschlagen wurden, kam es zu einer neuen, paritätischen Besetzung der Ämter in Verwaltung und Politik.
1960/61 schwang die Politik aufgrund der Wahlsiege der Hutu vollkommen um. In der Hutu-Revolution von 1962 unter G. Kayibanda wurden hunderttausenden Tutsi ins benachbarte Ausland vertrieben. Als Kayibanda als die Macht übernahm, kristallisierte sich Ruanda als Einparteienstaat der Hutu heraus, welcher sich unabhängig von den Belgiern machte und die Einführung republikanischer Verhältnisse verfolgte. Bis 1967 kam es immer wieder zu Guerilla-Angriffen der Tutsi Rebellion aus dem Ausland, was zur Destabilisierung Ruandas beitrug. Die Antworten der Hutu darauf waren Vertreibung, Morde und Enteignungen, welche die Situation Ruandas für die nächsten Jahrzehnte prägen sollten.
1972 rollte eine neue Gewaltwelle gegen die Tutsi an, welche ca. 150.000 Tote hervorbrachte. Als dann im folgenden Jahr der Präsident versuchte, die Gewalttaten zu unterbinden, stürzten extremistische Hutu diesen und Habyarimana ergriff die Macht. Dieser läutete eine neue Ära der nationalen Politik ein und förderte vorerst die Unterbindung von Konflikten und die Bildung einer Einheitspartei zwischen Tutsi und Hutu, die MRND. Dennoch wurden Tutsi-Bürger weiterhin diskriminiert und aus öffentlichen Ämtern ausgeschlossen.
Bis Mitte der 80er Jahre erlebte Ruanda einen wirtschaftlichen Aufschwung, welcher dann durch eine abrupte Staatskrise abgelöst wurde. Grund dafür waren eine wirtschaftliche Depression aufgrund des gesunkenen Kaffeepreises (welcher zu den Hauptexportmittel Ruandas zählt), ein starkes Bevölkerungswachstum, Knappheit der Landesressourcen, Arbeitslosigkeit in der Industrie und eine erstärkende Inflation. Die Staatskrise untergrub die Autorität Habyarimanas. Sie führte zur Bildung oppositioneller Gruppen, die den Kurs des Präsidenten kritisierten. Diese Gruppen, die insbesondere in den südlichen Landesteilen Rückhalt hatten, forderten eine Demokratisierung und das Ende der Monopolisierung der Macht durch Vertraute Habyarimanas. Das Ausland unterstützte diese Forderungen und forderte, das mittlerweile 30 Jahre alte Flüchtlingsproblem zu lösen. Schätzungen besagen, dass Anfang der 1990er Jahre zirka 600.000 Tutsi als Flüchtlinge im Ausland lebten.
Einen weiteren Faktor für die Loyalitätskrise der Staatsmacht stellten Gerüchte über eine bevorstehende, erneute Invasion von Tutsi-Rebellen dar, die sich in Uganda zur Ruandisch-Patriotischen Front (RPF) formiert hatten. Die Vermutungen bestätigten sich am 1. Oktober 1990, als die RPF von Uganda aus den Angriff auf Ruanda startete. Mit diesem Feldzug begann ein Bürgerkrieg, der erst mit dem militärischen Sieg der RPF im Juli 1994 enden sollte. Habyarimana bat Belgien, Frankreich und Zaire um militärische Unterstützung. Die jeweiligen Regierungen gingen dem Hilferuf nach und versetzten die Regierungsarmee Ruandas in die Lage, den ersten Angriff der RPF zurückzuschlagen. Nach dem ersten Sieg der Koalitionstruppen blieben jedoch nur die französischen Militärs zurück.
Nach ersten geheimen Versuchen der politischen Elite um den Präsidenten, die Demokratisierung Ruandas zu blockieren, kam es letztendlich im April 1992 zu einer Machtteilung mit den entstehenden neuen Parteien per Koalitionsregierung und der MRND. Zu den neuen Parteien gehörte zudem eine, die bereit war, die bestehende Herrschaft der Hutu mit radikalen Mitteln zu verteidigen. Die Coalition pour la Défense de la République (CDR), gegründet von Personen aus dem Umkreis des Präsidenten, plädierte für eine Vertreibung der Tutsi und baute ab 1992 die Miliz Impuzamugambi auf. Die Präsidentenpartei MRND organisierte im selben Jahr die Interahamwe.
Von Oktober 1990 bis April 1994 wurden Tutsi und Hutu-Oppositionelle immer wieder Opfer von Gewalt und Massakern, die als Rache für militärische Erfolge der RPF deklariert wurden. Diese Menschenrechtsverletzungen, bei denen etwa 2000 Tutsi und etliche Hutu getötet wurden, gelten als Vorläufer des Völkermords.
1992 gelang der RPF die Ausweitung ihrer Einflusszone. Sie beherrschte jetzt die nördliche Präfektur Byumba, die als „Brotkorb“ Ruandas galt. Dieser Erfolg zwang die ruandische Regierung dazu, ab Mitte 1992 in den Friedensprozess von Arusha einzutreten, der den Frieden für Ruanda versprach. Im Kern ging es bei den Verhandlungen in Arusha um die Frage der Rückkehr der ruandischen Flüchtlinge und die Rückführung ihres früheren Eigentums, um die Frage der Machtteilung zwischen der MRND, den anderen ruandischen Parteien und der RPF, um die Demobilisierung der Armeen und ihre Synthese zu einem gemeinsamen Militärapparat. Doch immer wieder wurden die Verhandlungen durch wieder aufgenommene Kampfhandlungen unterbrochen oder durch Parteimitglieder der MRND und CDR unterlaufen.
Ein weiteres Kernelement des Arusha-Abkommens bestand in der Aufstellung von UN-Friedentruppen in Ruanda, um die Verhandlungsergebnisse abzusichern. Der kanadische General Roméo Dallaire befehligte ab Oktober 1993 die UNAMIR, die von Beginn an mit erheblichen Problemen kämpfte. Presseorgane der Hutu-Extremisten unterstellten dem belgischen Kontingent der UNAMIR, auf Seiten der Rebellen zu stehen. Der Großteil der Blauhelmtruppe, die Ende März 1994 eine Stärke von zirka 2500 Mann erreichte, waren Soldaten aus Ghana und Bangladesch. Die militärischen Fähigkeiten und Ressourcen insbesondere der Bengalen erwiesen sich in den kommenden Monaten oft als unzureichend. Die Finanzierung der Truppe war über lange Monate ungesichert. Eine weitere Schwierigkeit lag im Mandat. Die UNAMIR hatte einen Auftrag nach Kapitel VI der Charta der Vereinten Nationen. Allein die Förderung des Friedens, eine so genannte Friedensmission, war möglich, nicht die Erzwingung des Friedens gegen eine oder mehrere Kriegsparteien – ein solches Vorgehen hätte ein Mandat nach Kapitel VII der Charta erfordert.
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in der Konfliktanalyse am Fallbeispiel Ruanda?
Die Konfliktanalyse am Fallbeispiel Ruanda untersucht die historischen Wurzeln, die Entwicklung und die Eskalation des Konflikts in Ruanda, der 1994 im Völkermord gipfelte. Sie behandelt die Rolle der verschiedenen Bevölkerungsgruppen (Tutsi, Hutu, Twa), die Kolonialgeschichte (deutsche und belgische Herrschaft), die politischen Entwicklungen nach der Unabhängigkeit und die Rolle der internationalen Gemeinschaft.
Welche Rolle spielten die Tutsi und Hutu in der Entwicklung des Konflikts?
Im späten 19. Jahrhundert, unter dem Königreich, kam es zu einer Differenzierung zwischen den Bevölkerungsgruppen. Die Tutsi, die vorwiegend Viehzucht betrieben, erlangten zunehmend Macht und wurden in Politik und Verwaltung einbezogen. Die Hutu, die hauptsächlich Ackerbau betrieben, wurden zur beherrschten Bevölkerungsschicht unter den Tutsi. Die Kolonialmächte verstärkten diese Unterscheidung durch die Hamitentheorie und die Einbindung der Tutsi in die indirekte Herrschaft.
Wie beeinflusste die Kolonialzeit den Konflikt?
Die deutschen und belgischen Kolonialherren verstärkten die sozialen und politischen Unterschiede zwischen Tutsi und Hutu. Die Deutschen nutzten die Hamitentheorie, um die abgestuften Sozialbeziehungen zu rechtfertigen. Die Belgier setzten das System fort und führten 1933/34 Ausweispapiere ein, die die ethnische Zugehörigkeit festlegten. Nach dem Zweiten Weltkrieg förderten die Belgier zunächst die Tutsi im Bildungswesen, später die Hutu, was zur Bildung eines Hutu-Klerus führte, der sich gegen die Tusi-Herrschaft stellte.
Welche Ereignisse führten zur Eskalation in den 1990er Jahren?
Eine Wirtschaftskrise in den 1980er Jahren, die durch fallende Kaffeepreise, Bevölkerungswachstum, Ressourcenknappheit und Arbeitslosigkeit ausgelöst wurde, untergrub die Autorität von Präsident Habyarimana. Es bildeten sich Oppositionsgruppen, die Demokratisierung forderten und das Flüchtlingsproblem (ca. 600.000 Tutsi im Ausland) anprangerten. Die Ruandisch-Patriotische Front (RPF), bestehend aus Tutsi-Rebellen, startete 1990 einen Angriff von Uganda aus, was zu einem Bürgerkrieg führte.
Welche Rolle spielten radikale Gruppen und Propaganda?
Die Coalition pour la Défense de la République (CDR) und die Interahamwe (Miliz der MRND) vertraten radikale Positionen und propagierten die Vertreibung der Tutsi. Der Hass-Sender Radio-Télévision Libre des Mille Collines (RTML) verbreitete Propaganda gegen die Tutsi und trug maßgeblich zur Eskalation der Gewalt bei.
Was war das Arusha-Abkommen und warum scheiterte es?
Das Arusha-Abkommen war ein Friedensprozess, der 1992 begann und darauf abzielte, den Bürgerkrieg zu beenden, die Rückkehr von Flüchtlingen zu ermöglichen, die Macht zu teilen und die Armeen zu demobilisieren. Die Verhandlungen wurden jedoch immer wieder durch Kampfhandlungen und die Obstruktion durch radikale Parteimitglieder der MRND und CDR unterbrochen.
Welche Rolle spielten die UN-Friedenstruppen (UNAMIR)?
Die UNAMIR unter General Roméo Dallaire wurde 1993 eingesetzt, um das Arusha-Abkommen abzusichern. Die Truppe hatte jedoch ein begrenztes Mandat, unzureichende Ressourcen und wurde durch Propaganda der Hutu-Extremisten behindert. Sie konnte den Völkermord nicht verhindern.
Wie sieht die Situation in Ruanda nach dem Völkermord aus?
Die Bevölkerung Ruandas befindet sich immer noch in einem traumatisierten Zustand. Die Regierung versucht, "Einheit und Versöhnung" herzustellen, jedoch gibt es weiterhin Repressivität und Unsicherheit. Die offizielle Abschaffung der Begriffe "Hutu" und "Tutsi" dient oft eher der Verschleierung von Konflikten als der Versöhnung.
- Arbeit zitieren
- Eric Schütte (Autor:in), 2008, Konfliktanalyse am Fallbeispiel Ruanda, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/118267