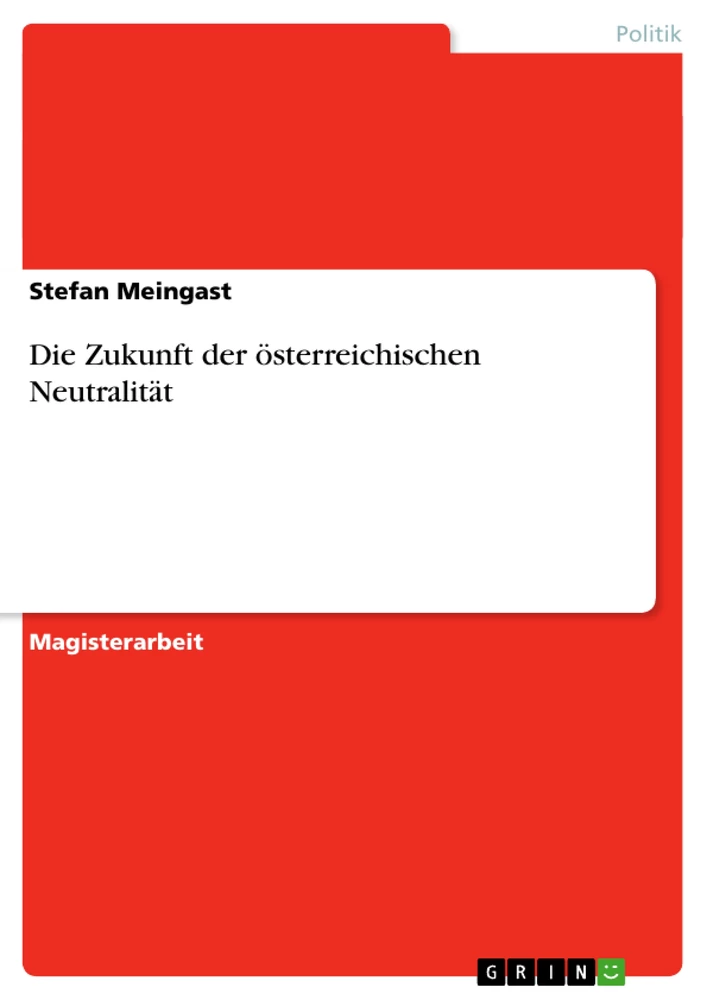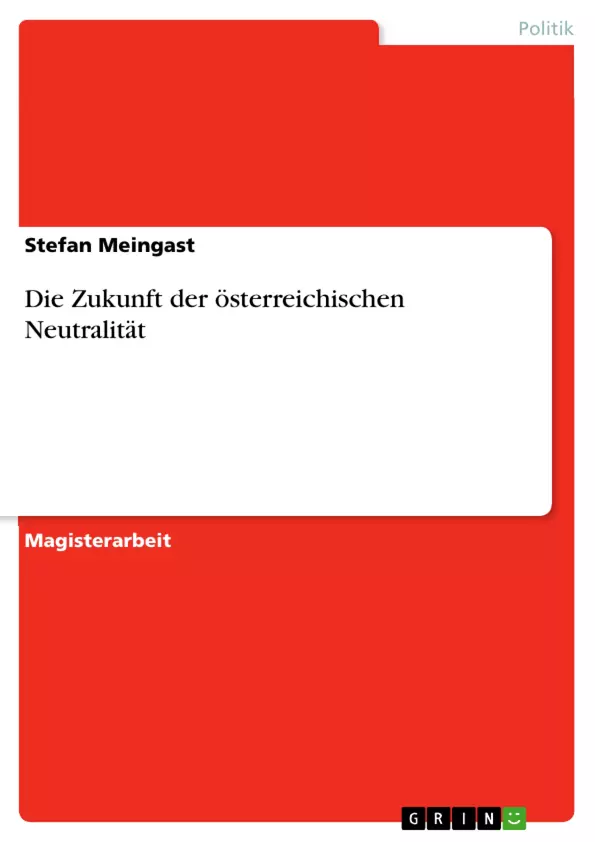Seit 1955 ist Österreich „immerwährend neutral“. Der in der Verfassung verankerte Status brachte dem Land die Unabhängigkeit und den Abzug der alliierten Besatzungstruppen. Es bedeutete jedoch auch eine eingeschränkte Außenpolitik. Jahrzehntelang konnte Österreich keine solchen Beziehungen zu Europa aufbauen, wie man sich das wirtschaftlich aber auch militärisch wünschte. Das Ende des Ost-West-Konflikts brachte schließlich jene Bewegungsfreiheit, die bis dahin gefehlt hatte. Wenn die Neutralität in ihrer Geschichte auch immer Veränderungen unterworfen war, mit dem Ende der Bipolarität entwickelte sich ein internationales Staatensystem, wie es vorher keines gegeben hatte. Die „postmoderne Welt“, wie sie Robert Cooper nennt, ist geprägt von gegenseitiger Einmischung in innenpolitische Angelegenheiten, einer allgemeinen Ablehnung staatlicher Gewalt und einer auf Transparenz beruhenden Sicherheit. Für Österreich stellte sich die Frage, ob die Neutralität, deren rechtliche Normen ihren Ursprung im 19. Jahrhundert haben, der neuen Situation angepasst werden kann – oder ihr auch angepasst nicht gerecht wird. Nach der Auflösung der Blöcke hat Österreich sein Neutralitätsverständnis, wie es bis dahin entwickelt worden war, gewandelt. Das Land sucht nach einer Neudefinition seiner sicherheitspolitischen Prämissen und tendenziell ist eine Abkehr von der Neutralität feststellbar. NATO und EU scheinen in dieser Hinsicht den Anforderungen der „Post-moderne“ besser zu entsprechen. Für die österreichische Bevölkerung reichen aber sicherheitspolitische Argumente nicht aus, denn neutral zu sein ist zu einem Bestandteil der nationalen Identität geworden. Eine Abschaffung der Neutralität wird weiterhin von einer Mehrzahl der Österreicher abgelehnt. Dennoch ist aufgrund des neuen staatlichen Umfelds unwahrscheinlich, dass Österreich die Neutralität in Zukunft erhalten kann. Aus diesen Rahmenbedingungen lässt sich eine These schlussfolgern, die in der vorliegenden Untersuchung bearbeitet werden soll:
Österreich wird seine Neutralität wegen der Bedeutung für die Bevölkerung zwar nicht kurzfristig, so doch mittel- bis langfristig wegen sicherheitspolitischer Mängel aufgeben.
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung:,,Ne-uter\" - keiner von beiden
- These
- Methode
- Untersuchungsaufbau
- Verwendete Materialien
- Neutralitätsrecht
- Völkerrechtliche Quellen
- Die Neutralitätsarten
- ,,GEWÖHNLICHE\" NEUTRALITÄT
- ,,IMMERWÄHRENDE““ NEUTRALITÄT
- Rechte und Pflichten des Neutralen
- PRIMÄRE PFLICHTEN DES NEUTRALEN
- RECHTE DES NEUTRALEN
- SEKUNDÄRE PFLICHTEN DES IMMERWÄHREND NEUTRALEN
- Revision des Neutralitätsrechts
- II. Die Geschichte der Neutralität in Österreich
- Die Genese
- DER NEUTRALITÄTSGEDANKE IN DER ZWISCHENKRIEGSZEIT (1918-1938)
- 1945 BIS 1953 – BLOCKFREIHEIT ODER NEUTRALITÄT ?
- 1953 BIS 1955 – VERKNÜPFUNG VON STAATSVERTRAG UND NEUTRALITÄT
- ANNUS MIRABILIS
- ,,FREIWILLIGE“ NEUTRALITÄT?
- Die Entwicklung des Neutralitätsgedankens seit 1955
- DIE KONSOLIDIERUNGS-PHASE (1955 – 1970)
- Das Neutralitätsverständnis 1955
- Der Beitritt zur UNO
- Die Ungarnkrise 1956
- EGKS, EG und EFTA
- DIE INTERNATIONALE PHASE (1970 – 1983)
- Die SPÖ-Alleinregierung
- Österreich im Sicherheitsrat
- DIE PRAGMATISCHE PHASE (1983 - 1991)
- DIE REDUKTIONISTISCHE PHASE (SEIT 1991)
- Der Zweite Golfkrieg
- Der EU-Beitritt
- ZUSAMMENFASSUNG
- III. Die Zukunft der österreichischen Neutralität
- Die sicherheitspolitische Dimension
- NEUTRALITÄT ALS SICHERHEITSSTRATEGIE
- SICHERHEITSPOLITIK IN ÖSTERREICH VON 1955 BIS 1989
- DER ERWEITERTE SICHERHEITSBEGRIFF
- DIE GEMEINSAME AUSSEN- UND SICHERHEITSPOLITIK (GASP)
- Der Vertrag von Maastricht
- Der Vertrag von Amsterdam
- Der Vertrag von Nizza
- DIE MÖGLICHEN OPTIONEN
- Aufrechterhaltung der Neutralität
- Aufgabe der Neutralität
- DER SICHERHEITSPOLITISCHE „OPTIONENBERICHT“
- DIE NEUE,,SICHERHEITS- UND VERTEIDIGUNGSDOKTRIN“
- Die psychologisch-projektive Dimension
- EINE IDENTITÄT STIFTENDE INSTITUTION
- DIE FUNKTIONEN DER NEUTRALITÄT
- MISSINTERPRETATIONEN DER ÖSTERREICHISCHEN NEUTRALITÄT
- IV. Resümee
- V. Quellen- und Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Magisterarbeit untersucht die Zukunft der österreichischen Neutralität. Ziel ist es, auf Basis einer empirisch-analytischen Methode eine Prognose über die zukünftige Entwicklung des Neutralitätsstatus Österreichs abzugeben. Die Arbeit berücksichtigt sowohl die völkerrechtlichen Grundlagen als auch die historische Entwicklung der Neutralität in Österreich.
- Völkerrechtliche Grundlagen der Neutralität
- Historische Entwicklung der österreichischen Neutralität
- Sicherheitspolitische Dimension der Neutralität
- Psychologisch-projektive Dimension der Neutralität (Identitätsaspekt)
- Mögliche zukünftige Entwicklungen der österreichischen Neutralität
Zusammenfassung der Kapitel
I. Einleitung:,,Ne-uter\" - keiner von beiden: Die Einleitung präsentiert die These der Arbeit: Österreich wird seine Neutralität mittel- bis langfristig aufgrund sicherheitspolitischer Mängel aufgeben, obwohl sie für die Bevölkerung von großer Bedeutung ist. Die Methodik wird als empirisch-analytisch beschrieben, wobei der Fokus auf der Analyse der Entwicklung der Neutralität liegt, ohne den Rückgriff auf politische Theorien aufgrund der instabilen Sicherheitslage. Der Aufbau der Arbeit folgt dem Prinzip vom Allgemeinen zum Speziellen.
II. Die Geschichte der Neutralität in Österreich: Dieses Kapitel untersucht die Genese der österreichischen Neutralität, beginnend mit dem Neutralitätsgedanken in der Zwischenkriegszeit und fortführend bis zur Entwicklung des Neutralitätsgedankens nach 1955. Es analysiert verschiedene Phasen der österreichischen Neutralität, von der Konsolidierungsphase bis zur reduktionistischen Phase, und beleuchtet wichtige Ereignisse wie den Beitritt zur UNO, die Ungarnkrise 1956, die EG-Beitrittsfrage und den Zweiten Golfkrieg. Die verschiedenen Phasen und Ereignisse werden im Kontext der sich wandelnden internationalen Beziehungen analysiert.
Schlüsselwörter
Österreichische Neutralität, Völkerrecht, Sicherheitspolitik, Internationale Beziehungen, Postmoderne Weltordnung, Nationale Identität, EU, NATO, Historische Entwicklung, Zukunftsprognose.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Magisterarbeit: "Ne-uter" - keiner von beiden: Die Zukunft der österreichischen Neutralität
Was ist das Thema der Magisterarbeit?
Die Magisterarbeit untersucht die Zukunft der österreichischen Neutralität. Das zentrale Ziel ist es, auf Basis einer empirisch-analytischen Methode eine Prognose über die zukünftige Entwicklung des Neutralitätsstatus Österreichs abzugeben.
Welche Methoden werden in der Arbeit verwendet?
Die Arbeit verwendet eine empirisch-analytische Methode. Der Fokus liegt auf der Analyse der Entwicklung der Neutralität, ohne den Rückgriff auf politische Theorien aufgrund der instabilen Sicherheitslage. Der Aufbau folgt dem Prinzip vom Allgemeinen zum Speziellen.
Welche Aspekte der österreichischen Neutralität werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die völkerrechtlichen Grundlagen der Neutralität, die historische Entwicklung der österreichischen Neutralität, die sicherheitspolitische Dimension, die psychologisch-projektive Dimension (Identitätsaspekt) und mögliche zukünftige Entwicklungen.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel: I. Einleitung, II. Die Geschichte der Neutralität in Österreich, III. Die Zukunft der österreichischen Neutralität, IV. Resümee und V. Quellen- und Literaturverzeichnis. Kapitel I stellt die These (Österreich wird seine Neutralität mittel- bis langfristig aufgeben), die Methodik und den Untersuchungsaufbau vor. Kapitel II analysiert die historische Entwicklung der Neutralität, während Kapitel III die sicherheitspolitischen und psychologisch-projektiven Dimensionen der Neutralität und mögliche Zukunftsoptionen beleuchtet. Kapitel IV fasst die Ergebnisse zusammen.
Welche historischen Phasen der österreichischen Neutralität werden untersucht?
Die Arbeit untersucht die Genese der österreichischen Neutralität von der Zwischenkriegszeit (1918-1938) bis zur Gegenwart. Es werden verschiedene Phasen unterschieden: die Konsolidierungsphase (1955-1970), die internationale Phase (1970-1983), die pragmatische Phase (1983-1991) und die reduktionistische Phase (seit 1991). Wichtige Ereignisse wie der Beitritt zur UNO, die Ungarnkrise 1956, der Zweite Golfkrieg und der EU-Beitritt werden analysiert.
Welche sicherheitspolitischen Aspekte werden betrachtet?
Die sicherheitspolitische Dimension der Neutralität wird im Kontext der gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik (GASP) der EU, der Verträge von Maastricht, Amsterdam und Nizza, sowie der "Sicherheits- und Verteidigungsdoktrin" untersucht. Die Arbeit diskutiert auch die Frage, ob die Neutralität als Sicherheitsstrategie weiterhin geeignet ist.
Welche Rolle spielt die nationale Identität im Zusammenhang mit der Neutralität?
Die Arbeit beleuchtet die psychologisch-projektive Dimension der Neutralität, d.h. die Bedeutung der Neutralität als identitätsstiftende Institution für die österreichische Bevölkerung. Mögliche Missinterpretationen der österreichischen Neutralität werden ebenfalls diskutiert.
Welche Schlussfolgerung zieht die Arbeit?
Die Arbeit argumentiert, dass Österreich seine Neutralität mittel- bis langfristig aufgrund sicherheitspolitischer Mängel aufgeben wird, obwohl sie für die Bevölkerung von großer Bedeutung ist. Die genaue Begründung und die detaillierte Argumentation finden sich im Haupttext.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Österreichische Neutralität, Völkerrecht, Sicherheitspolitik, Internationale Beziehungen, Postmoderne Weltordnung, Nationale Identität, EU, NATO, Historische Entwicklung, Zukunftsprognose.
- Citation du texte
- Stefan Meingast (Auteur), 2002, Die Zukunft der österreichischen Neutralität, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/11829