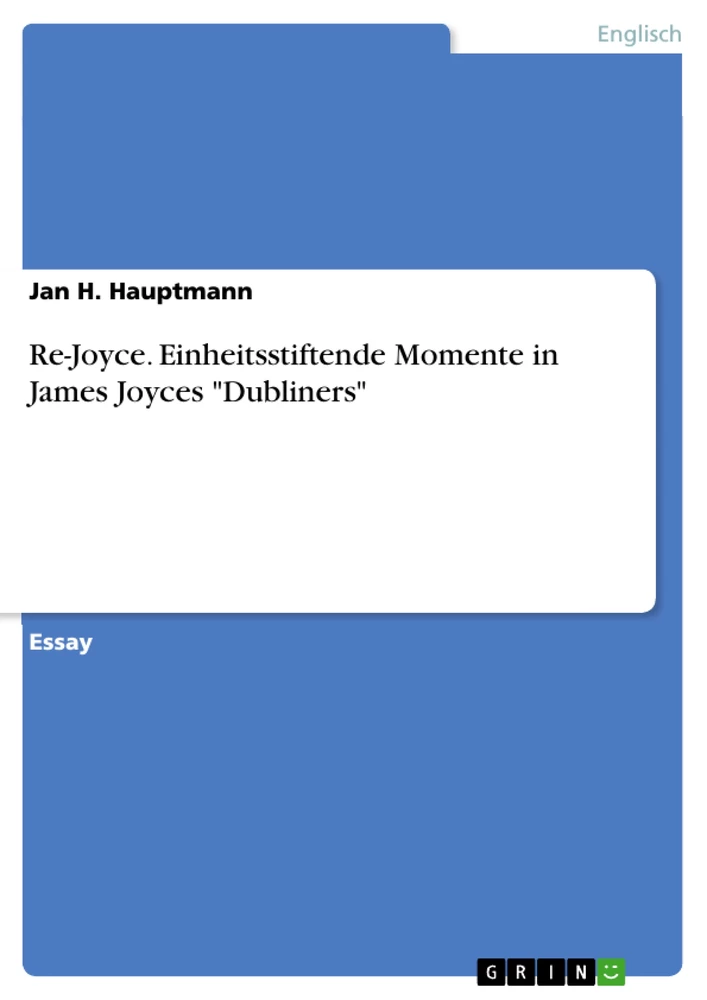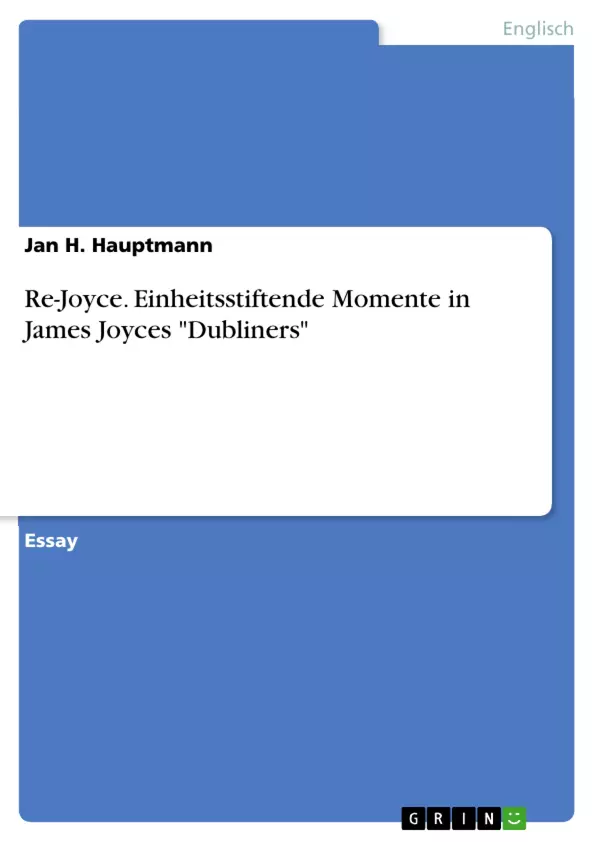JAMES JOYCES Erzählsammlung Dubliners wurde im Jahre 1914 erstmals in Buchform veröffentlicht, obgleich 14 der darin enthaltenen Geschichten bereits in den Jahren 1902 bis 1906 fertig gestellt worden waren. Ursprünglich sollten die Geschichten in der Zeitschrift The Irish Homestead abgedruckt werden, doch war die Resonanz der Leser auf die kritische Haltung des Autors gegenüber Irland und Dublin und den negativen Tenor zunächst ausgesprochen schlecht. Ein weiteres Hindernis, das der Veröffentlichung von JOYCES erstem bedeutendem Werk entgegen stand, war die Furcht der Verleger und Drucker vor der Zensur. Insbesondere wegen der politischen Erzählung Ivy Day in the Committee Room befürchteten sie eine Anklage wegen Majestätsbeleidigung und auch die verwendete Sprache erschien ihnen teilweise als unanständig. Durch die Vermittlung von EZRA POUND, der sich gegen den allgemeinen Vorwurf der Morbidität des Werkes äußerte, gelang JOYCE schließlich doch noch die Publikation. Bedingt durch die Verzögerung von beinahe einem Jahrzehnt kam zu den ursprünglichen Erzählungen noch eine weitere hinzu, und zwar die 1907 entstandene Geschichte The Dead, die sich formal und stilistisch etwas von den anderen abhebt. Aus literaturwissenschaftlicher Sicht macht eine typologische Einteilung von Dubliners gewissen Schwierigkeiten. Ein plot im klassischen Sinne ist kaum feststellbar. Die Geschichten sind statisch, verfügen teilweise über keinen Spannungsbogen und wollen sich – unter anderem wegen ihrer elliptischen Konstruktion – nicht recht in die übliche Vorstellung von Kurzgeschichten einfügen. HUGH KENNER et al. schlagen daher vor, das Werk eher als eine „multi-faceted novel“ zu betrachten. Obgleich sich das vorliegende Essay vorrangig mit der Frage beschäftigen möchte, inwieweit Dubliners als Kurzgeschichtensammlung gemeinsamen Inhalts oder episodenhafter Roman im Sinne entsprechender literaturwissenschaftlicher Definitionen zu betrachten ist, will es einheitsstiftende Momente und Motive der Erzählungen herausarbeiten, um die Zugehörigkeit der einzelnen Geschichten zu einem Ganzen näher zu beschreiben und zu erhellen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Thematische Zusammenhänge
- Autobiographische Einheit
- Gesellschaftliche und historische Einheit
- Einheitsstiftende Motivik und Symbolik
- Paralysis, gnomon und simony
- Teufelskreis der Grundmotive
- Der Kreis - zyklische Bewegung und Struktur
- Exil - Ausbruchsversuche aus dem Kreis der Paralyse
- Dubliners als Erzählzyklus
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Dieses Essay möchte die Einheitsstiftenden Momente in James Joyces Dubliners beleuchten. Es untersucht, ob das Werk als Kurzgeschichtensammlung oder episodenhafter Roman im Sinne literaturwissenschaftlicher Definitionen zu betrachten ist. Darüber hinaus werden zentrale Motive und Symbole aufgezeigt, die die einzelnen Geschichten zu einem Ganzen verbinden.
- Die autobiographischen, gesellschaftlichen und historischen Hintergründe der Erzählungen
- Die Rolle von Paralysis, gnomon und simony als wiederkehrende Motive
- Die Bedeutung des Teufelskreises als Strukturprinzip der Geschichten
- Die verschiedenen Formen des Exils als Ausdruck des Versuchs, der Paralyse zu entkommen
- Die Einordnung von Dubliners als Erzählzyklus
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Entstehung und den Kontext von Dubliners vor. Sie beleuchtet die Herausforderungen bei der Veröffentlichung des Werkes, die vom Autor selbst und der Öffentlichkeit wahrgenommen wurden. Die Einleitung verweist auf die besondere Struktur der Geschichten und die Schwierigkeit, sie in die klassische Kurzgeschichtenform einzuordnen.
Der erste Abschnitt, "Thematische Zusammenhänge", untersucht die verschiedenen Hintergründe der Erzählungen. Es wird gezeigt, wie autobiographische Ereignisse, gesellschaftliche Verhältnisse und historische Ereignisse sich auf das Gesamtwerk Dubliners auswirken.
Der zweite Abschnitt, "Einheitsstiftende Motivik und Symbolik", geht auf die wiederkehrenden Motive und Symbole in den Geschichten ein. Hier werden zentrale Konzepte wie Paralysis, gnomon und simony beleuchtet. Der Abschnitt analysiert auch den Teufelskreis der Grundmotive, der sich in den Geschichten wiederholt.
Der dritte Abschnitt, "Dubliners als Erzählzyklus", untersucht die Frage, ob das Werk als Kurzgeschichtensammlung oder episodenhafter Roman betrachtet werden kann.
Schlüsselwörter
Dubliners, James Joyce, Kurzgeschichte, Roman, Erzählzyklus, Einheit, Motivik, Symbolik, Paralysis, gnomon, simony, Teufelskreis, Exil, Gesellschaft, Geschichte, Autobiographie.
Häufig gestellte Fragen
Ist James Joyces „Dubliners“ ein Roman oder eine Kurzgeschichtensammlung?
Obwohl es eine Sammlung ist, wird es oft als „Erzählzyklus“ oder „episodenhafter Roman“ betrachtet, da die Geschichten durch gemeinsame Motive und Themen eng miteinander verknüpft sind.
Was bedeutet das Motiv der „Paralysis“ (Lähmung) in dem Werk?
Es ist das zentrale Thema von „Dubliners“ und beschreibt die moralische, geistige und gesellschaftliche Erstarrung der Bewohner Dublins am Anfang des 20. Jahrhunderts.
Was versteht Joyce unter einem „Gnomon“?
Ein Gnomon ist eine unvollständige geometrische Figur. Joyce nutzt dies als Symbol für das Unvollkommene und Lückenhafte im Leben seiner Charaktere.
Welche Rolle spielt das Motiv des „Exils“?
Viele Figuren versuchen, dem Teufelskreis der Paralyse durch Flucht oder Ausbruch (Exil) zu entkommen, scheitern jedoch meist an ihren eigenen inneren Fesseln.
Warum gab es Probleme bei der Veröffentlichung von „Dubliners“?
Verleger fürchteten die Zensur wegen der ungeschönten Sprache und der kritischen, teils als unanständig empfundenen Darstellung der irischen Gesellschaft und Politik.
- Quote paper
- Jan H. Hauptmann (Author), 2005, Re-Joyce. Einheitsstiftende Momente in James Joyces "Dubliners", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/118417