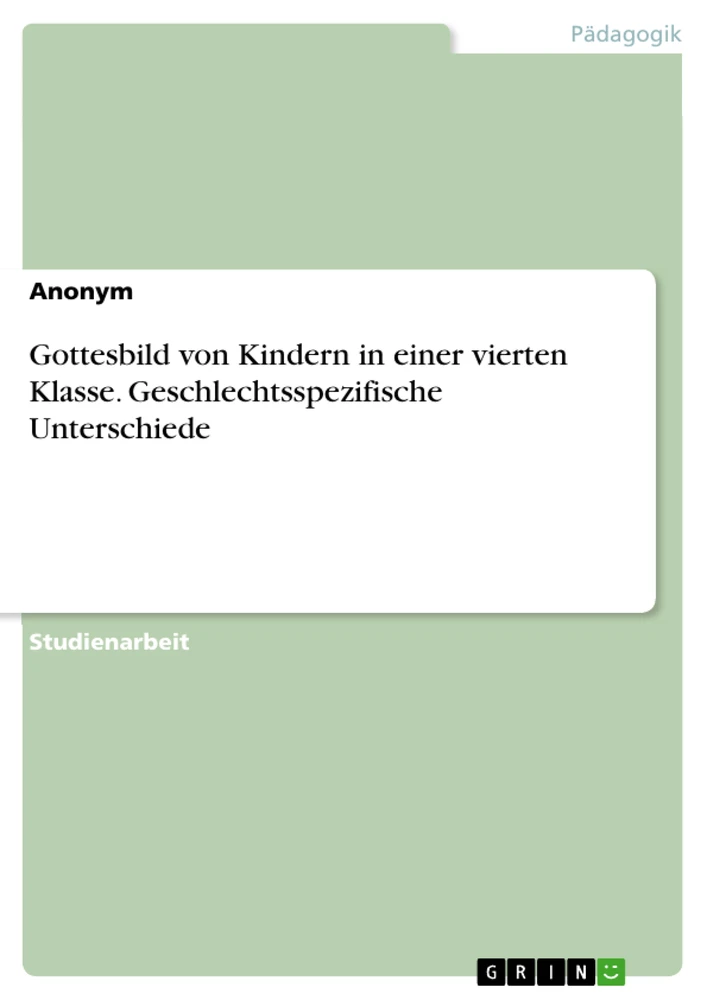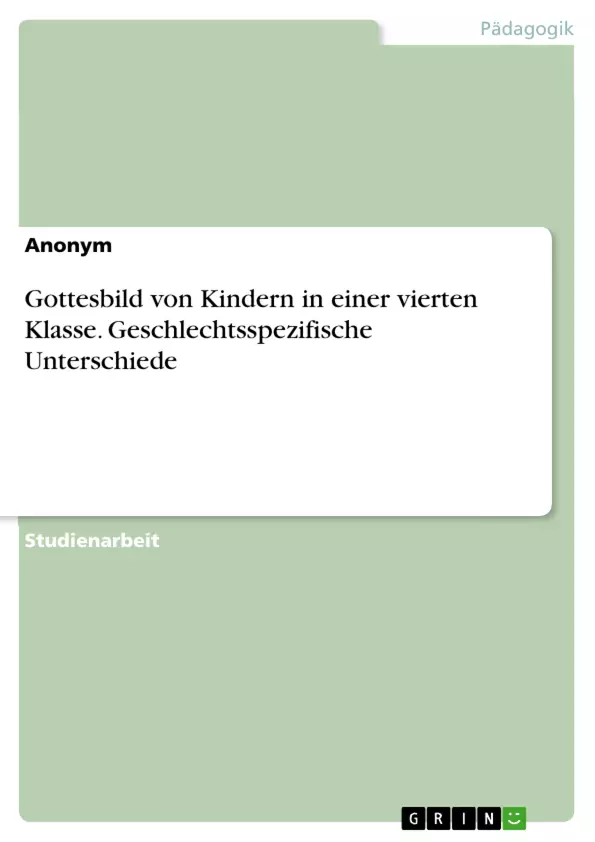Diese Arbeit beschäftigt sich mit kindlichen Gottesvorstellungen. Es wird besonders auf zwei Fragen eingegangen: Wie stellen sich Kinder Gott vor? Welche geschlechtsspezifischen Unterschiede weisen die gemalten Gottesbilder der Kinder einer vierten Klasse auf? Kinder nehmen am Religionsunterricht der Schule teil und das meistens mit großer Selbstverständlichkeit, sie besuchen den Kindergottesdienst und manche Eltern erzählen ihren Kinder biblische Geschichten, beten mit ihnen und feiern die christlichen Feste wie Weihnachten oder Ostern gemeinsam.
Auf der anderen Seite wachsen die Kinder mehr denn je mit Medien auf, wie Kinderbücher, DVDs und Fernsehsendungen. Jedes Medium vermittelt den Kindern Bilder, auch von Gott. All das nimmt Einfluss auf den kindlichen Glauben. Egal, ob Kinder eine religiöse Erziehung genießen oder ihnen dies nicht von Zuhause aus vorgelebt wird, jedes Kind macht sich ein Bild von dem Aussehen Gottes und stellt sich vor, wie Gott sein könnte. So entsteht ein mehr oder weniger konkretes Bild von Gott bei den Kindern und trotzdem gibt es keine deckungsgleiche Vorstellung.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Theoretische Einbettung
- Definition Gottesbild
- Entwicklungspsychologie
- Untersuchungen zum Gottesbild nach...
- ... Helmut Hanisch
- ... Anton Bucher
- Das Studienprojekt
- Die Fragestellung
- Allgemeine Voraussetzungen
- Das Forschungsdesign
- Die Erhebungsmethode
- Die Auswertungsmethode
- Darstellung und Diskussion der Ergebnisse
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit kindlichen Gottesvorstellungen und untersucht, wie Kinder sich Gott vorstellen und welche geschlechtsspezifischen Unterschiede in den gemalten Gottesbildern von Kindern einer vierten Klasse auftreten. Die Arbeit stützt sich auf die Ergebnisse von Helmut Hanisch und Anton A. Bucher, wobei deren Vorgehensweise und Methode ebenfalls beleuchtet werden.
- Kindliche Gottesvorstellungen
- Anthropomorphe und symbolische Gottesbilder
- Geschlechtsspezifische Unterschiede in der Darstellung Gottes
- Entwicklungspsychologische Aspekte des kindlichen Gottesbildes
- Kritische Betrachtung der Methoden von Hanisch und Bucher
Zusammenfassung der Kapitel
- Die Einleitung stellt die Fragestellungen des Studienprojekts vor und erläutert die Relevanz des Themas. Sie geht auf die unterschiedlichen Einflüsse auf das kindliche Gottesbild ein und beschreibt die spezifischen Forschungsfragen.
- Das Kapitel "Theoretische Einbettung" definiert den Begriff "Gottesbild" und stellt die relevanten Theorien zur Entwicklungspsychologie und religiösen Entwicklung vor. Es beleuchtet die Studien von Helmut Hanisch und Anton A. Bucher und ihre Erkenntnisse über die Gottesbilder von Kindern.
- Im Kapitel "Das Studienprojekt" werden die Fragestellungen des Studienprojekts spezifiziert und die allgemeine Situation der untersuchten vierten Klasse beschrieben. Es folgt eine Darstellung des Forschungsdesigns, der Erhebungsmethode und der Auswertungsmethode.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den Gottesbildern von Kindern, anthropomorphen und symbolischen Gottesdarstellungen, der Entwicklungspsychologie, den Studien von Helmut Hanisch und Anton A. Bucher, der methodischen Analyse und der Interpretation zeichnerischer Darstellungen von Kindern.
Häufig gestellte Fragen
Wie stellen sich Kinder in der vierten Klasse Gott vor?
Die Arbeit untersucht kindliche Gottesvorstellungen, die oft zwischen anthropomorphen (menschengestaltigen) und symbolischen Darstellungen variieren.
Gibt es geschlechtsspezifische Unterschiede bei den Gottesbildern?
Ja, die zentrale Forschungsfrage der Arbeit analysiert, welche Unterschiede in den Zeichnungen von Jungen und Mädchen einer vierten Klasse auftreten.
Welchen Einfluss haben Medien auf den kindlichen Glauben?
Kinderbücher, DVDs und Fernsehsendungen vermitteln den Kindern vorgefertigte Bilder, die ihre individuellen Vorstellungen von Gott beeinflussen können.
Auf welche Studien stützt sich die Arbeit?
Die Untersuchung basiert auf den theoretischen Grundlagen und Methoden von Helmut Hanisch und Anton Bucher.
Wie wurde das Studienprojekt methodisch durchgeführt?
Es wurde ein Forschungsdesign mit einer spezifischen Erhebungsmethode (Zeichnungen) und einer anschließenden Auswertungsmethode zur Interpretation der Bilder gewählt.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2015, Gottesbild von Kindern in einer vierten Klasse. Geschlechtsspezifische Unterschiede, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1184253