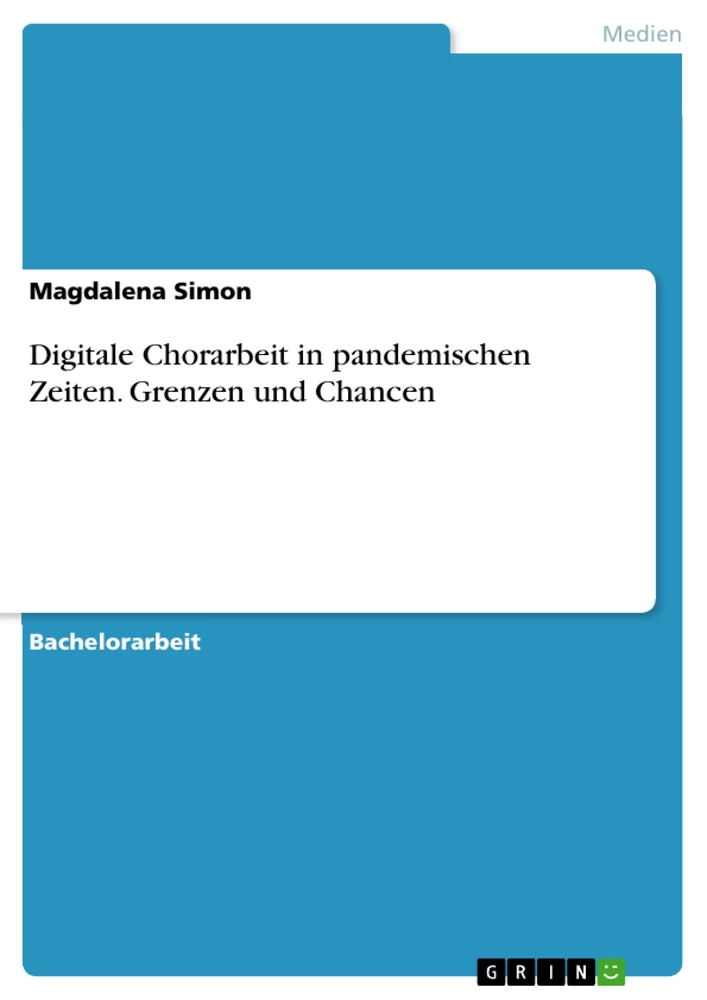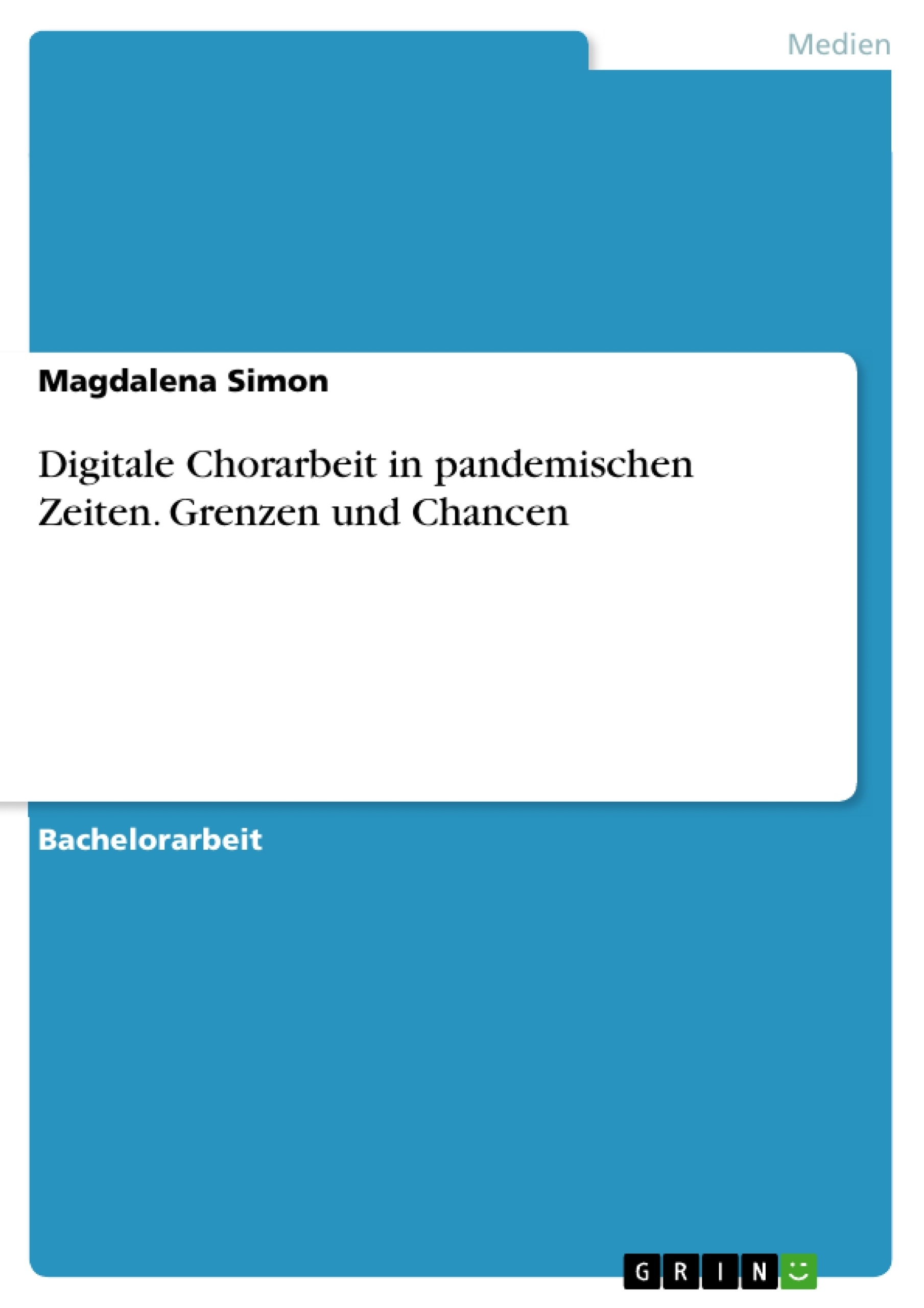Das Ziel der Arbeit ist es, Chorleiterinnen und Chorleitern neue Ideen zu geben, neue Wege aufzuzeigen und Anreize für das gemeinsame Musizieren in pandemischen Zeiten und darüber hinaus zu schaffen. Das Handbuch soll als Leitfaden dienen, um den Einstieg in die digitale Chorarbeit zu erleichtern und soll Chöre, Chorleiterinnen und Chorleiter auf ihrem Weg begleiten.
Der erste Teil dieser Arbeit beschäftigt sich vordergründig mit den Chören der ELKB zum Zeitpunkt Februar 2021, welche die Grundlage der Analysen und Folgerungen bilden. Neben den Statistiken zur digitalen Chorarbeit steht die kritische Betrachtung der Thematik im Vordergrund. Wo liegen die Vor- und Nachteile der digitalen Chorarbeit? Was kann auch über die pandemischen Zeiten hinaus gewinnbringend sein? Des weiteren werden die gängigen Videokonferenzprogramme hinsichtlich ihrer Eignung für die digitale Chorarbeit verglichen.
Es wird ein Einblick in die medienpsychologischen Hintergründe sowie in das Themengebiet der Therapie und Seelsorge innerhalb der Chorarbeit gegeben. Weshalb strengt die Chorarbeit im digitalen Raum an? Warum ist eine digitale Chorprobe aus seelsorgerlicher Sicht unbedingt notwendig? Abschließend wird die Rolle der Chorleitung vorgestellt und einen Einblick in die Probenmethodik im digitalen Raum gegeben. Wie verhalte ich mich als Chorleitung? Was sollte ich meinem Chor bieten? Wie gehe ich in einer digitalen Chorprobe methodisch vor?
Inhaltsverzeichnis
- Vorwort „Wir können nicht nicht singen“
- 1. Definition
- 2. Digitale Chorarbeit in der ELKB, Februar 2021
- 3. Kritische Betrachtung
- 3.1. Nachteile und Probleme
- 3.2. Vorteile und Chancen
- 4. Videokonferenz-Programme im Vergleich
- 4.1. Jamulus
- 4.2. Jitsi
- 4.3. Skype
- 4.4. Whatsapp Video
- 4.5. Zoom
- 4.6. Resümee und Zukunftsblick
- 5. Medienpsychologische Betrachtung
- 6. Therapie und Seelsorge
- 7. Die Rolle der Chorleitung
- 7.1. Persönlichkeit
- 7.2. Körpersprache und Dirigat
- 8. Digitale Chorprobenmethodik
- 8.1. Probenmethodische Unterschiede im Analogen und Digitalen
- 8.2. Digitale Probenmethodik im Erwachsenenchor
- 8.3. Digitale Probenmethodik im Kinderchor
- 9. Fallbeispiele
- 9.1. Projektchor Klangfarben
- 9.2. Kinderchor Die Ohrwurm-Kids
- Danksagung
- Anhang
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der digitalen Chorarbeit im Kontext der Corona-Pandemie und darüber hinaus. Sie untersucht die Grenzen und Chancen dieser neuen Form der Chorarbeit, insbesondere im Kontext der Evangelischen Landeskirche in Bayern (ELKB). Das Ziel ist es, Chorleiterinnen und Chorleitern sowie Sängerinnen und Sängern einen umfassenden Einblick in die Möglichkeiten und Herausforderungen der digitalen Chorarbeit zu geben und sie für diese neue Form des Chorgesangs zu begeistern.
- Herausforderungen und Chancen der digitalen Chorarbeit im Kontext der Corona-Pandemie
- Methoden und Möglichkeiten der digitalen Probenarbeit
- Die Rolle der Chorleitung in der digitalen Chorarbeit
- Psychologische Aspekte der digitalen Chorarbeit
- Seelsorge und Musiktherapie im digitalen Chorraum
Zusammenfassung der Kapitel
- Das Vorwort stellt die aktuelle Situation der Chorarbeit in Zeiten der Corona-Pandemie dar und betont die Notwendigkeit, neue Möglichkeiten des Singens zu finden.
- Kapitel 1 definiert den Begriff der digitalen Chorarbeit und beschreibt den aktuellen Stand der digitalen Chorarbeit in der ELKB.
- Kapitel 3 befasst sich mit den Vor- und Nachteilen der digitalen Chorarbeit. Es werden verschiedene Aspekte wie die technischen Herausforderungen, die Auswirkungen auf die musikalische Qualität und die Rolle der Chorleitung beleuchtet.
- Kapitel 4 bietet einen Vergleich verschiedener Videokonferenz-Programme, die für die digitale Chorarbeit geeignet sind.
- Kapitel 5 betrachtet die digitalen Chorproben aus medienpsychologischer Sicht und beleuchtet die Auswirkungen auf die Konzentration, Motivation und das Sozialverhalten der Sängerinnen und Sänger.
- Kapitel 6 beleuchtet die Rolle der Musiktherapie und Seelsorge im digitalen Chorraum.
- Kapitel 7 behandelt die besondere Rolle der Chorleitung in der digitalen Chorarbeit. Es werden Aspekte wie Persönlichkeit, Körpersprache und Dirigat im digitalen Raum betrachtet.
- Kapitel 8 beschäftigt sich mit der digitalen Probenmethodik. Es werden die Unterschiede zur analogen Chorarbeit dargestellt und verschiedene Methoden für die digitale Probenarbeit im Erwachsenen- und Kinderchor vorgestellt.
- Kapitel 9 stellt zwei Fallbeispiele aus der Praxis vor und illustriert die Anwendung der digitalen Chorarbeit in verschiedenen Chören.
Schlüsselwörter
Digitale Chorarbeit, Corona-Pandemie, Videokonferenz-Programme, Chorleitung, Probenmethodik, Medienpsychologie, Seelsorge, Musiktherapie, Evangelische Landeskirche in Bayern (ELKB).
Häufig gestellte Fragen
Was sind die Vorteile digitaler Chorarbeit?
Sie ermöglicht das gemeinsame Musizieren trotz Kontaktbeschränkungen, fördert die digitale Kompetenz und bietet seelsorgerliche Unterstützung.
Welche Videokonferenz-Programme eignen sich für Chöre?
Verglichen werden Jamulus (wegen geringer Latenz), Zoom, Jitsi, Skype und WhatsApp-Video.
Warum ist digitale Chorprobe seelsorgerlich wichtig?
Das gemeinsame Singen stärkt das Gemeinschaftsgefühl und hilft gegen Vereinsamung und psychische Belastungen während einer Pandemie.
Was muss die Chorleitung im digitalen Raum beachten?
Die Methodik muss angepasst werden, da direktes Zusammenklingen oft technisch schwierig ist; Fokus liegt auf Stimmbildung und Einzel-Feedback.
Gibt es Unterschiede zwischen Kinder- und Erwachsenenchor online?
Ja, die medienpsychologischen Anforderungen und die Aufmerksamkeitsspanne erfordern unterschiedliche methodische Herangehensweisen.
- Quote paper
- Magdalena Simon (Author), 2021, Digitale Chorarbeit in pandemischen Zeiten. Grenzen und Chancen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1184256