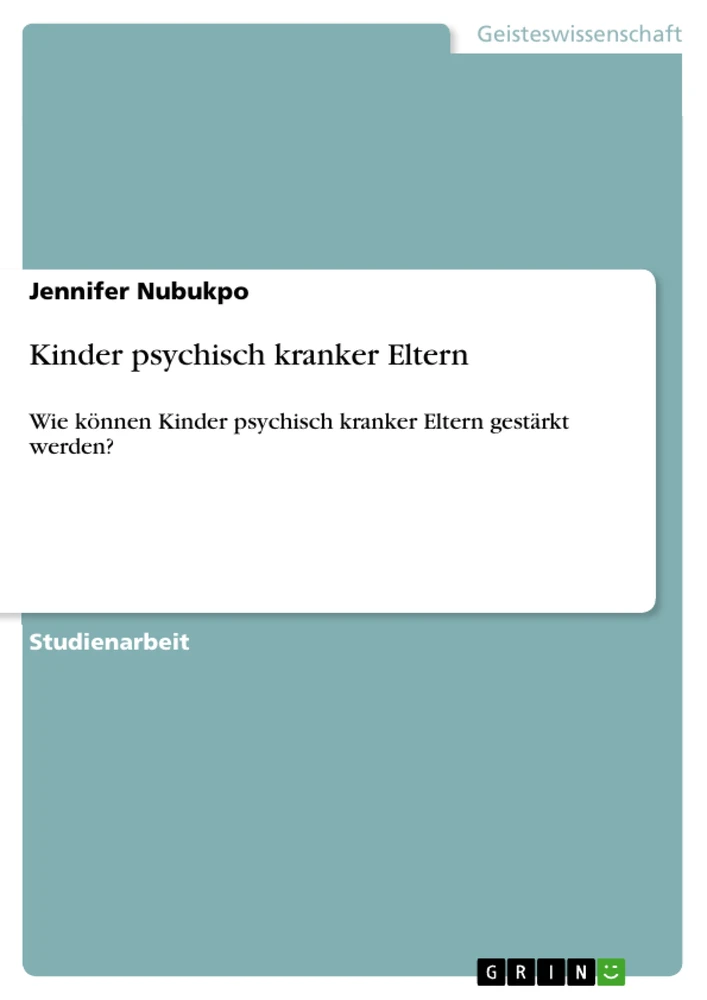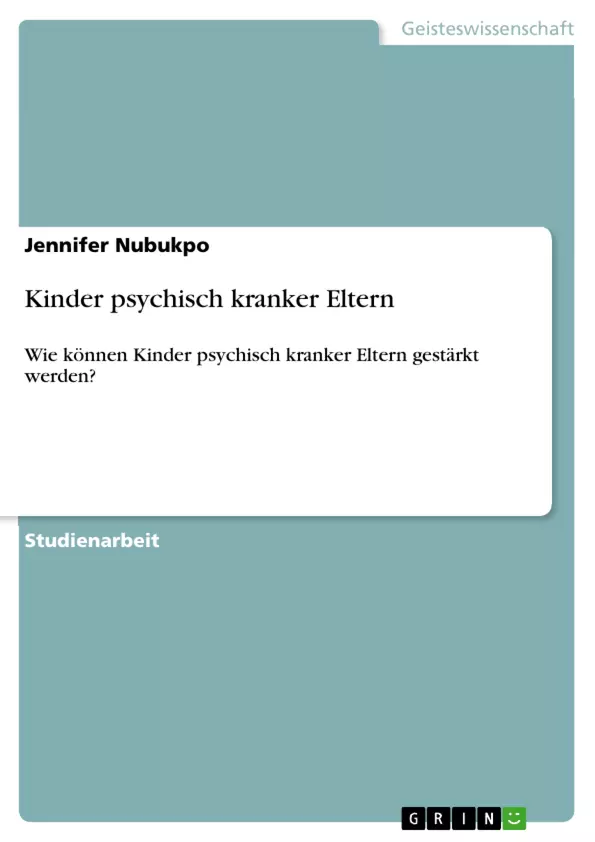In dieser Hausarbeit wird der Frage nachgegangen, wie Kinder psychisch kranker Eltern gestärkt werden können. Dazu wird zu Beginn der Arbeit der Begriff "psychische Erkrankungen" erklärt. Im Anschluss daran werden die Belastungsfaktoren von Kindern psychisch kranker Eltern erläutert. Dabei wird insbesondere auf die Parentifizierung, die Gefühle der Kinder, die Tabuisierung der Erkrankung und die Auswirkungen auf das Familiensystem eingegangen. Im weiteren Verlauf der Hausarbeit wird die mögliche Bewältigungsstrategie, Resilienz, die ergriffen werden kann, vorgestellt und Ressourcen als Schutzfaktor bei Kindern dargestellt. Infolgedessen werden Interventionen und präventive Angebote für die betroffenen Kinder und Eltern thematisiert. Hierbei wird spezifisch die Intervention Ressourcenaktivierung dargestellt. Das Fazit bildet den Abschluss der Arbeit.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Psychische Erkrankungen
- Belastungsfaktoren der Kinder psychisch kranker Eltern
- Parentifizierung
- Gefühle der Kinder
- Tabuisierung
- Auswirkungen auf das Familiensystem
- Resilienz
- Begriffsbestimmung
- Ressourcen als Schutzfaktoren bei Kindern
- Interventionen
- Ressourcenaktivierung
- Aktivierung personaler Ressourcen
- Aktivierung sozialer Ressourcen
- Förderung und Entwicklung familiärer Ressourcen
- Weitere Hilfeangebote für betroffene Kinder und Familien
- Ressourcenaktivierung
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit zielt darauf ab, die Belastungen und Herausforderungen, denen Kinder psychisch kranker Eltern gegenüberstehen, zu beleuchten. Es wird untersucht, wie diese Kinder gestärkt werden können und welche Ressourcen ihnen zur Verfügung stehen. Die Arbeit beleuchtet außerdem die Auswirkungen der elterlichen Erkrankung auf das Familiensystem und die Bedeutung von Resilienz als Bewältigungsstrategie.
- Die Auswirkungen psychischer Erkrankungen auf Kinder
- Parentifizierung und ihre Auswirkungen
- Resilienz als Schutzfaktor für Kinder
- Ressourcenaktivierung und ihre Rolle in Interventionen
- Hilfeangebote für betroffene Kinder und Familien
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Einleitung führt in das Thema „Kinder psychisch kranker Eltern“ ein und erläutert die Relevanz des Themas. Sie stellt die zentralen Fragestellungen und die Gliederung der Arbeit vor.
Psychische Erkrankungen
Dieses Kapitel definiert den Begriff „psychische Erkrankungen“ und erläutert die Häufigkeit und Verbreitung von psychischen Erkrankungen in der Gesamtbevölkerung. Es werden auch geschlechtsspezifische Unterschiede bei der Häufigkeit von psychischen Erkrankungen thematisiert.
Belastungsfaktoren der Kinder psychisch kranker Eltern
Dieser Abschnitt behandelt die spezifischen Herausforderungen, denen Kinder psychisch kranker Eltern ausgesetzt sind. Es wird auf die Parentifizierung, die Gefühle der Kinder und die Auswirkungen der Erkrankung auf das Familiensystem eingegangen.
Resilienz
Das Kapitel „Resilienz“ beleuchtet die Bedeutung von Resilienz als Bewältigungsstrategie für Kinder psychisch kranker Eltern. Es erklärt den Begriff der Resilienz und stellt verschiedene Ressourcen als Schutzfaktoren für Kinder vor.
Interventionen
Dieses Kapitel widmet sich verschiedenen Interventionen und präventiven Angeboten, die betroffenen Kindern und Familien helfen können. Es wird insbesondere auf die Ressourcenaktivierung als Interventionsform eingegangen.
Schlüsselwörter
Die Arbeit behandelt das Thema psychische Erkrankungen und die Auswirkungen auf Kinder. Wichtige Schlüsselbegriffe sind: psychische Erkrankungen, Belastungsfaktoren, Parentifizierung, Gefühle, Tabuisierung, Resilienz, Ressourcenaktivierung, Interventionen, Hilfeangebote.
- Arbeit zitieren
- Jennifer Nubukpo (Autor:in), 2021, Kinder psychisch kranker Eltern, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1184653