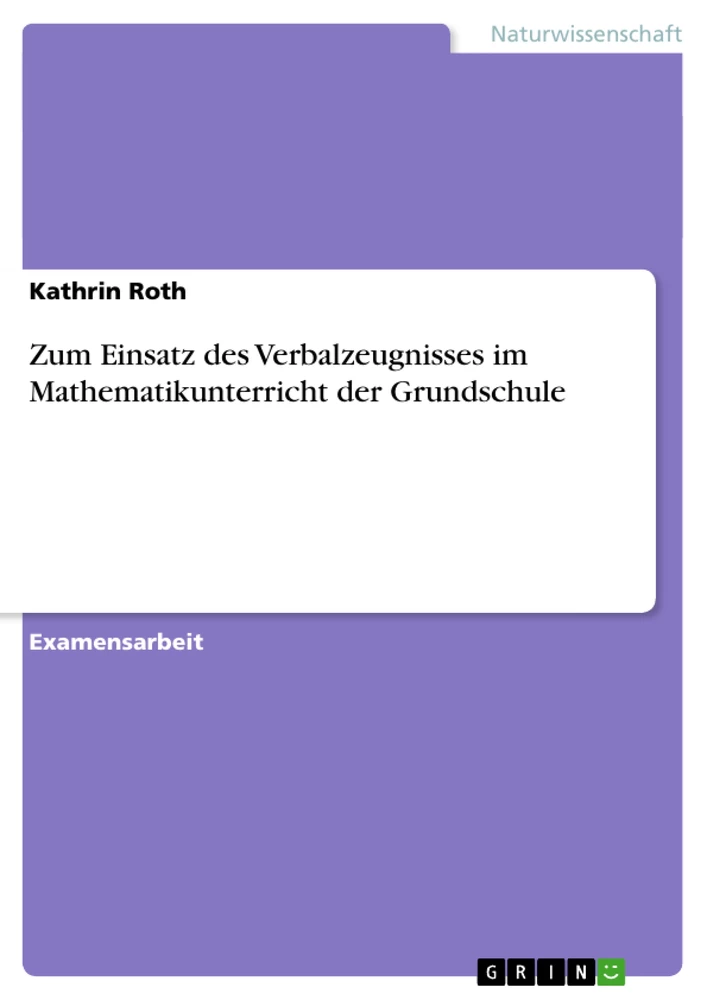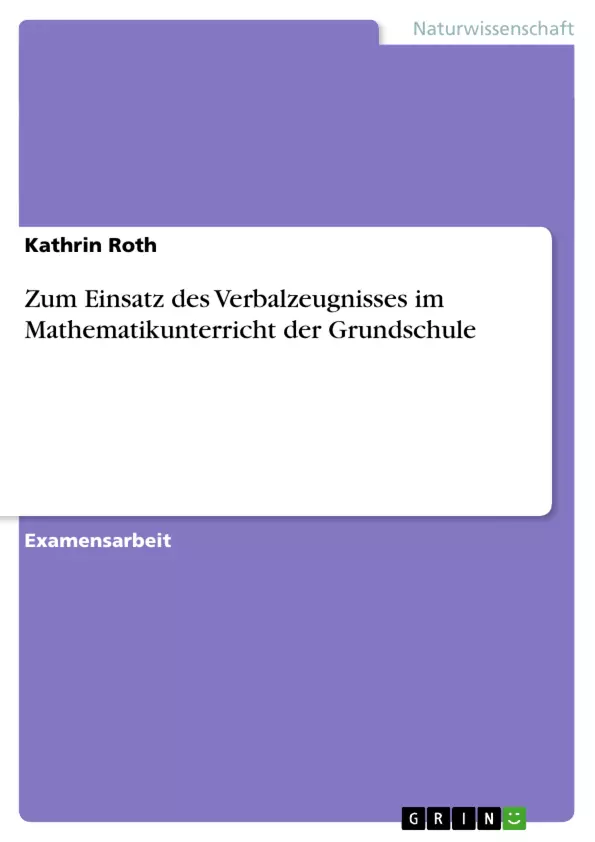In der Grundschule stellt "Lernen und Leisten" ein zentrales Thema dar. Dies interessiert, spätestens seitdem durch nationale und internationale Studien zur Leistungsfähigkeit des allgemeinen Schulwesens die angeblich geringe Leistungsfähigkeit unserer Schüler festgestellt wurde, sowohl die Öffentlichkeit als auch die Lehrerschaft.
Die Schule muss Leistungsschule sein, da die Leistung in unserem menschlichen Alltag allgegenwärtig ist. Genau deswegen muss geklärt werden, welche pädagogischen Mittel angestrebt werden müssen, um schulische Leistungen richtig zu fördern. Leistungsbeurteilung und -messung wird erst dann sinnvoll, wenn ihre pädagogische Bedeutung klar und eindeutig betont wird.
Dieser Aufgabe gerecht zu werden ist schwierig, denn die Leistungsbeurteilung der Schüler steht in einem Spannungsfeld zwischen der freien Entfaltung der Schülerpersönlichkeit einerseits und den Leistungsanforderungen der Gesellschaft andererseits. Deswegen ist sie, aber besonders die Zensurengebung, ein zentrales Thema der Schulpädagogik.
Nirgendwo anders gehen die Meinungen und Aussagen der Forschung, der Öffentlichkeit, der Eltern und Schüler so weit auseinander und nirgends ist die Kritik so heftig wie bei diesem Thema.
Wenn man die weitreichende Wirkung betrachtet, welche die schulische Leistungsbeurteilung für die Entwicklung und die Lebenschancen der einzelnen Schüler mit sich bringt, ist das auch nicht verwunderlich. Außerdem bietet nicht nur die Praxis der Leistungsbeurteilung Anlass zur Kritik, sondern auch deren Belastung mit objektiven Problemen.
Der pädagogische Begriff der Leistung muss folglich die Individualität aller Kinder berücksichtigen und den gesellschaftlichen Funktionen nicht die Überhand gewinnen lassen.
Vor allem das Fach Mathematik gilt heute neben dem Rechtschreiben als das Selektionsfach Nummer eins. Es besteht immer noch die fälschliche Meinung, dass sich die Lernerfolge objektiv beurteilen lassen, da es anscheinend nur richtige und falsche Antworten gibt.
Aber auch in Mathematik existiert meist mehr als nur der einzig korrekte Lösungsweg.
Die meisten Leistungsüberprüfungen konzentrieren sich auf den Wissens- oder Fertigkeitsbereich. So bedeutsam die Beherrschung von mathematischen Grundlagen auch ist, so wird ein Mathematikunterricht, welcher vor allem das automatische Abrufen von gespeicherten Wissenselementen und Handlungsweisen betont, der Prozesshaftigkeit des Faches bei weitem nicht gerecht.
[...]
Inhaltsverzeichnis
- 0 Einleitung
- 1 Zum Begriff der Leistung
- 1.1 Schulleistung
- 2 Leistung in der Schule. Warum?
- 2.1 Anthropologische Gründe
- 2.2 Das Leistungsprinzip in unserer Gesellschaft
- 2.3 Der Bildungsauftrag der Schule
- 3 Einführung in die Thematik der schulischen Leistungsbewertung
- 3.1 Zum Begriff der Leistungsmessung
- 3.2 Zum Begriff der Leistungsbewertung
- 3.3 Zum Begriff der Zensur
- 3.4 Herkunft von Noten und Wortzeugnissen
- 3.5 Bezugsnormen der Leistungsmessung
- 3.5.1 Der intraindividuelle Maßstab
- 3.5.2 Die soziale Norm
- 3.5.3 Die kriteriumsorientierte Bezugsnorm
- 3.6 Die Gütekriterien der Leistungsbewertung
- 3.6.1 Objektivität
- 3.6.2 Reliabilität
- 3.6.3 Validität
- 3.7 Die Aufgaben der Leistungsfeststellung
- 3.7.1 Die pädagogische Entwicklungsfunktionen
- 3.7.2 Die gesellschaftliche Steuerungsfunktionen
- 3.8 Die Problematik des Leistungsprinzips in der Schule
- 3.8.1 Subjektive Störfaktoren der Leistungsbeurteilung durch Zensuren
- 3.8.2 Gesellschaftliches und unpädagogisches Leistungsverständnis
- 4 Der pädagogische Leistungsbegriff in der Grundschule
- 4.1 Andere Bewertungsformen
- 4.2 Betonung des individuellen Lernfortschritts
- 4.3 Vermeidung von Wettbewerbssituationen
- 4.4 Produkt- und Prozessbezogenheit der Leistung
- 4.5 Leistung als problemmotiviertes Lernen
- 4.6 Erfolgmotivierendes Lernen
- 5 Allgemeines über die Verbalbeurteilung
- 5.1 Die verschiedenen Zeugnisregelungen der Primarstufe in den Bundesländern der Bundesrepublik Deutschland
- 5.2 Verbalbeurteilung an den Grundschulen in Bayern
- 5.3 Rechtsgrundlagen und amtliche Bestimmungen
- 5.4 Lernentwicklungsberichte statt Notenzeugnisse
- 5.4.1 Argumente, die für die Verbalbeurteilung sprechen
- 5.4.2 Argumente, die gegen die Verbalbeurteilung sprechen
- 6 Ziffernzeugnis oder Verbalbeurteilung im Mathematikunterricht der Grundschule?
- 6.1 Einführung in die Thematik der Leistungsbewertung im Mathematikunterricht der Grundschule
- 6.2 Der Mythos von der Objektivität der Noten
- 6.3 Heißt Verzicht auf Noten Verzicht auf Leistung?
- 6.4 Untersuchungen über die Art und Weise des Einsatzes des Verbalzeugnisses im Mathematikunterricht der Grundschule
- 6.4.1 Informative Aufgabenstellungen als Grundlage für Verbalbeurteilung
- 6.4.2 Von der Leistungswahrnehmung zur verbalen Darstellung
- 6.5 Mathematikleistungen verbal beurteilen ja, aber wie?
- 7 Praxisteil
- 7.1 Ergebnisse der Schülerbefragung der 3. Klasse
- 7.1.1 Methodisches Vorgehen und statistische Daten
- 7.1.2 Auswertung der Schülerbefragung
- 7.2 Ergebnisse der Elternbefragung
- 7.2.1 Methodisches Vorgehen und statistische Daten
- 7.2.2 Auswertung der Elternbefragung
- 7.3 Ergebnisse der Lehrerbefragung
- 7.3.1 Methodisches Vorgehen und statistische Daten
- 7.3.2 Auswertung der Lehrerbefragung
- 7.1 Ergebnisse der Schülerbefragung der 3. Klasse
- 8 Schlussgedanke
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Zulassungsarbeit befasst sich mit der Frage, wie Verbalzeugnisse im Mathematikunterricht der Grundschule sinnvoll eingesetzt werden können. Die Arbeit analysiert die unterschiedlichen Argumentationslinien für und gegen die Verwendung von Verbalzeugnissen. Zudem werden Ergebnisse einer empirischen Untersuchung vorgestellt, die die Sichtweisen von Schülern, Eltern und Lehrern auf die Verbalbeurteilung im Mathematikunterricht beleuchtet.
- Der Einsatz von Verbalzeugnissen in der Grundschule
- Die unterschiedlichen Argumentationslinien für und gegen die Verwendung von Verbalzeugnissen
- Die pädagogische Bedeutung der Leistungsbeurteilung im Mathematikunterricht
- Empirische Untersuchung der Sichtweisen von Schülern, Eltern und Lehrern
- Die Entwicklung und Gestaltung von geeigneten Instrumenten zur Verbalbeurteilung im Mathematikunterricht
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 1: Hier wird der Begriff der Leistung im Allgemeinen betrachtet und auf die Bedeutung von Schulleistung eingegangen.
- Kapitel 2: Dieser Teil der Arbeit befasst sich mit der Frage, warum Leistung in der Schule wichtig ist. Es werden anthropologische Gründe, das Leistungsprinzip in unserer Gesellschaft und der Bildungsauftrag der Schule betrachtet.
- Kapitel 3: In diesem Kapitel wird eine Einführung in die Thematik der schulischen Leistungsbewertung gegeben. Es werden verschiedene Begriffe wie Leistungsmessung, Leistungsbewertung und Zensur erläutert. Außerdem werden Bezugsnormen der Leistungsmessung (intraindividueller Maßstab, soziale Norm, kriteriumsorientierte Bezugsnorm) sowie die Gütekriterien der Leistungsbewertung (Objektivität, Reliabilität, Validität) behandelt. Abschließend werden die Aufgaben der Leistungsfeststellung (pädagogische Entwicklungsfunktionen, gesellschaftliche Steuerungsfunktionen) und die Problematik des Leistungsprinzips in der Schule (subjektive Störfaktoren, gesellschaftliches und unpädagogisches Leistungsverständnis) beleuchtet.
- Kapitel 4: Dieses Kapitel widmet sich dem pädagogischen Leistungsbegriff in der Grundschule. Es werden verschiedene Bewertungsformen, die Betonung des individuellen Lernfortschritts, die Vermeidung von Wettbewerbssituationen, die Produkt- und Prozessbezogenheit der Leistung, Leistung als problemmotiviertes Lernen und Erfolgmotivierendes Lernen thematisiert.
- Kapitel 5: Hier werden allgemeine Informationen über die Verbalbeurteilung gegeben. Es werden die verschiedenen Zeugnisregelungen der Primarstufe in den Bundesländern der Bundesrepublik Deutschland, die Verbalbeurteilung an den Grundschulen in Bayern, die Rechtsgrundlagen und amtliche Bestimmungen sowie die Einführung von Lernentwicklungsberichten statt Notenzeugnissen behandelt. Darüber hinaus werden Argumente für und gegen die Verbalbeurteilung diskutiert.
- Kapitel 6: In diesem Kapitel wird die Frage nach der Relevanz von Ziffernzeugnissen versus Verbalbeurteilung im Mathematikunterricht der Grundschule diskutiert. Es wird der Mythos von der Objektivität der Noten, die Bedeutung von Leistung im Kontext von Notenverzicht sowie Untersuchungen über die Art und Weise des Einsatzes des Verbalzeugnisses im Mathematikunterricht der Grundschule beleuchtet. Es werden außerdem informative Aufgabenstellungen als Grundlage für Verbalbeurteilung und die Übertragung von Leistungswahrnehmung in verbale Darstellung erörtert. Abschließend werden praktische Aspekte der verbalen Beurteilung von Mathematikleistungen behandelt.
- Kapitel 7: Dieser Teil der Arbeit beinhaltet Ergebnisse einer empirischen Untersuchung, die die Sichtweisen von Schülern, Eltern und Lehrern auf die Verbalbeurteilung im Mathematikunterricht der Grundschule erfasst.
Schlüsselwörter
Verbalzeugnis, Mathematikunterricht, Grundschule, Leistungsbewertung, Lernentwicklung, pädagogische Funktionen, Objektivität, Reliabilität, Validität, intraindividuelle Bezugsnorm, kriteriumsorientierte Bezugsnorm, Schülerbefragung, Elternbefragung, Lehrerbefragung
Häufig gestellte Fragen
Warum wird die Zensurgebung in der Grundschule kritisiert?
Kritiker bemängeln, dass Noten die freie Entfaltung der Persönlichkeit einschränken können und oft subjektiv sind. Die Leistungsbeurteilung steht im Spannungsfeld zwischen pädagogischer Förderung und gesellschaftlicher Selektion.
Was ist ein Verbalzeugnis?
Ein Verbalzeugnis (oder Lernentwicklungsbericht) beschreibt die Leistungen und Lernfortschritte eines Schülers in Textform, anstatt sie durch eine Ziffernote auszudrücken.
Ist Mathematik ein "objektives" Fach für Noten?
Obwohl oft geglaubt wird, dass es in Mathe nur "richtig" oder "falsch" gibt, betont die Arbeit, dass es meist mehrere Lösungswege gibt und ein reiner Fokus auf Ergebnisse der Prozesshaftigkeit des Lernens nicht gerecht wird.
Welche Bezugsnormen gibt es bei der Leistungsmessung?
Unterschieden wird zwischen der sozialen Norm (Vergleich mit anderen), der kriteriumsorientierten Norm (Erreichen festgesetzter Ziele) und dem intraindividuellen Maßstab (Vergleich mit der eigenen Vorleistung).
Was sagen Eltern und Lehrer zur Verbalbeurteilung?
Die Arbeit enthält eine empirische Untersuchung, die zeigt, dass Meinungen weit auseinandergehen. Während Pädagogen oft den individuellen Fortschritt betonen, fordern Teile der Öffentlichkeit und Eltern oft die vermeintliche Klarheit von Noten.
- Quote paper
- Kathrin Roth (Author), 2002, Zum Einsatz des Verbalzeugnisses im Mathematikunterricht der Grundschule, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/11847