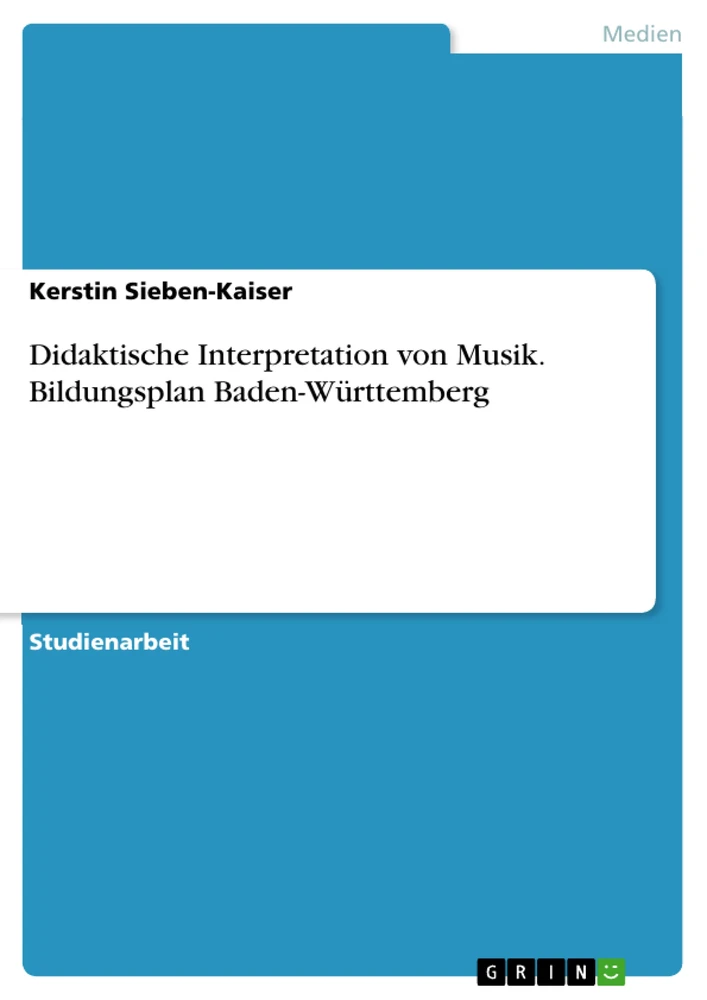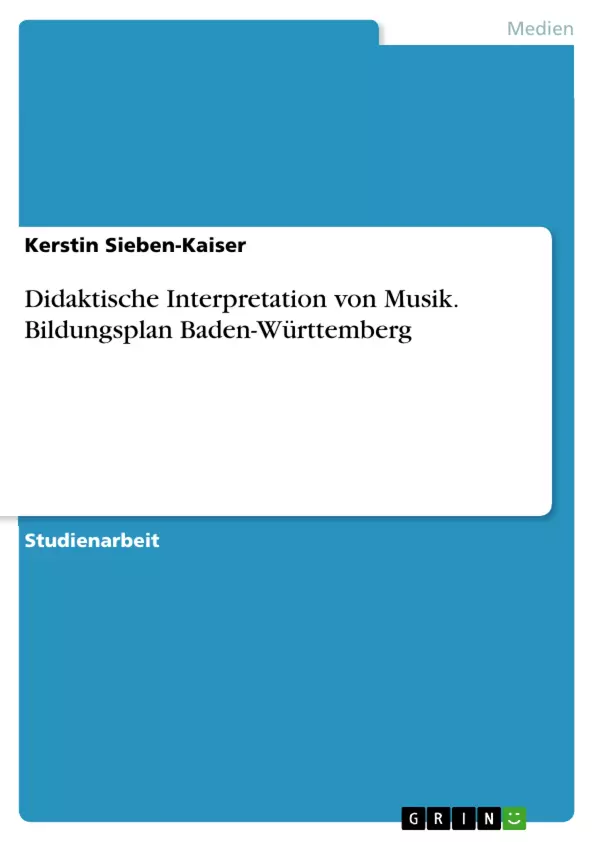Gegen die in den siebziger Jahren vorherrschende Verwissenschaftlichung und den rein rationalen Zugang zur Musik wandte sich auf der fünften Bundestagung des Verbandes deutscher Schulmusiker 1975 in Mainz neben Musikpädagogen wie Bernhard Binkowski und Richard Jakoby auch Karl Heinrich Ehrenforth mit der Forderung, stärker den Menschen in das Zentrum des didaktischen Prozesses zu stellen. 1976 knüpfte Christoph Richter an diese Überlegungen an, er forderte eine "Humanisierung" des Musikunterrichtes, der jedoch nicht ausschließlich schülerorientiert sein sollte, sondern eine Balance finden sollte zwischen wissenschaftlich - reflexiver Erschließung von Musik und einer subjektiv -individuellen, auf die Persönlichkeitsentwicklung des Schülers ausgerichteten Erfahrung mit und durch Musik.
Entscheidend für die Ermöglichung des individuellen Dialoges mit der Musik ist laut Ehrenforth, den Zuhörenden dort abzuholen, wo er nach Hörerwartung und Rezeptionsvermögen erwartet werden muss. Hier wird also deutlich nicht das
musikalische Werk allein in den Mittelpunkt des Interesses bzw. des didaktischen Geschehens gestellt und wissenschaftlich erschlossen und erklärt, sondern die Musik soll in einen Lebenszusammenhang gestellt werden, sodass Berührungspunkte zwischen Leben und Musik hergestellt bzw. aufgezeigt werden und der Hörer so durch die Verknüpfung mit ihm vertrauten Lebenserfahrungen persönlich involviert wird, sich gedanklich und emotional auf den erwähnten Dialog mit der Musik einlassen kann.
Inhaltsverzeichnis
- Situation des Musikunterrichtes vor Ehrenforth und Richter
- Zielsetzung der „Didaktischen Interpretation“
- Formulierung der theoretischen Grundlagen durch Ehrenforth
- Das zugrundeliegende hermeneutische Modell
- Theorie und Praxis des didaktischen Ansatzes in der Fortführung durch Richter
- Generelle Problematik der didaktischen Praxis
- Vermittlung zwischen Subjekt und Objekt; die drei (bzw. vier) Dimensionen der Erfahrung
- Die „Didaktische Brücke“
- Orientierung an der Schülerperspektive? - Die „Didaktische Interpretation im Spannungsfeld der Subjekt -, Objekt - und Prozessorientierung
- Conclusio
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Der Text „Didaktische Interpretation von Musik“ analysiert und beschreibt das musikdidaktische Konzept der „Didaktischen Interpretation“, das von Karl Heinrich Ehrenforth und Christoph Richter in den 1970er Jahren entwickelt wurde. Ziel des Textes ist es, die theoretischen Grundlagen dieses Ansatzes aufzuzeigen, seine Entwicklung und Anwendung in der Musikpädagogik zu beleuchten und die Bedeutung dieses Konzeptes für die Praxis des Musikunterrichts aufzuzeigen.
- Historische Entwicklung des Musikunterrichts
- Kritik an musikwissenschaftlichen und auditiv-wahrnehmungserzieherischen Konzepten
- Die hermeneutische Grundlage der „Didaktischen Interpretation“
- Die Rolle des verbalen Verstehens in der Musikpädagogik
- Die „Didaktische Interpretation“ im Spannungsfeld zwischen Subjekt-, Objekt- und Prozessorientierung
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 1: Situation des Musikunterrichtes vor Ehrenforth und Richter: Dieses Kapitel beleuchtet die Entwicklung des Musikunterrichts im Kontext der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland. Es stellt die unterschiedlichen musikpädagogischen Strömungen vor, die im Laufe der Zeit in den Vordergrund rückten, und analysiert deren Stärken und Schwächen. Dabei wird insbesondere auf die „kunstwerkorientierte“ Musikpädagogik und die „Auditive Wahrnehmungserziehung“ eingegangen.
- Kapitel 2: Zielsetzung der „Didaktischen Interpretation“: In diesem Kapitel werden die Beweggründe für die Entstehung des Konzepts der „Didaktischen Interpretation“ erläutert. Es werden die Kritikpunkte an den bestehenden musikdidaktischen Ansätzen genannt und die Ziele und Intentionen von Ehrenforth und Richter für einen neuartigen Zugang zum Musikverständnis im Unterricht dargestellt.
- Kapitel 3: Formulierung der theoretischen Grundlagen durch Ehrenforth: In diesem Kapitel wird die zentrale Rolle der Hermeneutik für die „Didaktische Interpretation“ beleuchtet. Ehrenforth's Konzept der „Didaktischen Interpretation“ wird im Detail vorgestellt, wobei die Abgrenzung von anderen Interpretationsformen und die Bedeutung des verbalen Verstehens im Fokus stehen.
- Kapitel 4: Das zugrundeliegende hermeneutische Modell: Dieses Kapitel erklärt das hermeneutische Modell, das dem Ansatz der „Didaktischen Interpretation“ zugrunde liegt. Die Bedeutung des Dialogs zwischen Musik und Mensch und die „zirkelhafte Dialogstruktur mit dem Ziel der Horizontverschmelzung“ werden erläutert.
- Kapitel 5: Theorie und Praxis des didaktischen Ansatzes in der Fortführung durch Richter: Dieses Kapitel beleuchtet die Weiterentwicklung des „Didaktischen Interpretations“-Konzepts durch Christoph Richter. Die Problematik der Vermittlung von Musik durch Sprache und die Bedeutung der verschiedenen Dimensionen der Erfahrung werden dargestellt. Die „Didaktische Brücke“ als zentrale Komponente des didaktischen Ansatzes wird erläutert.
- Kapitel 6: Orientierung an der Schülerperspektive? - Die „Didaktische Interpretation im Spannungsfeld der Subjekt -, Objekt - und Prozessorientierung: In diesem Kapitel wird die Frage der Schülerorientierung im Kontext der „Didaktischen Interpretation“ beleuchtet. Das Konzept wird im Spannungsfeld zwischen Subjekt-, Objekt- und Prozessorientierung verortet und die Relevanz der Schülerperspektive für den Musiklernprozess diskutiert.
Schlüsselwörter
Die zentralen Begriffe und Themen des Textes umfassen die „Didaktische Interpretation“, die Hermeneutik, das musikdidaktische Konzept, die Vermittlung von Musik, die Schülerperspektive, die Rolle des verbalen Verstehens, die Bedeutung des Dialogs und die verschiedenen Dimensionen der Erfahrung. Der Text befasst sich mit der historischen Entwicklung des Musikunterrichts in Deutschland, der Kritik an bestehenden Ansätzen und der Suche nach einem neuen musikpädagogischen Modell, das den Menschen in den Mittelpunkt stellt.
- Quote paper
- Kerstin Sieben-Kaiser (Author), 2005, Didaktische Interpretation von Musik. Bildungsplan Baden-Württemberg, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1184883