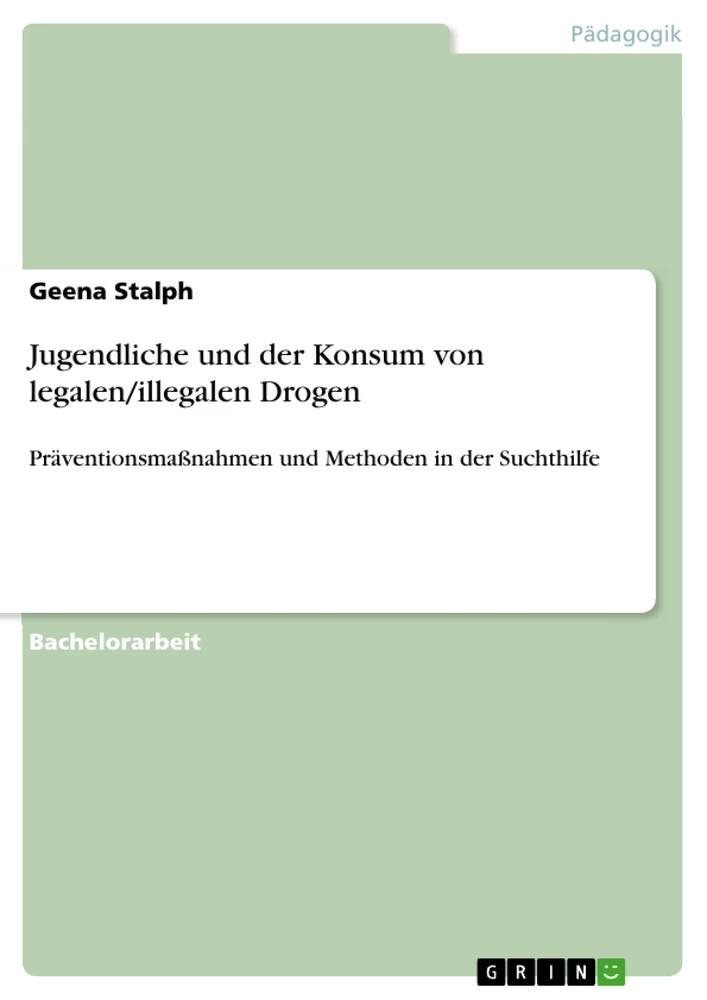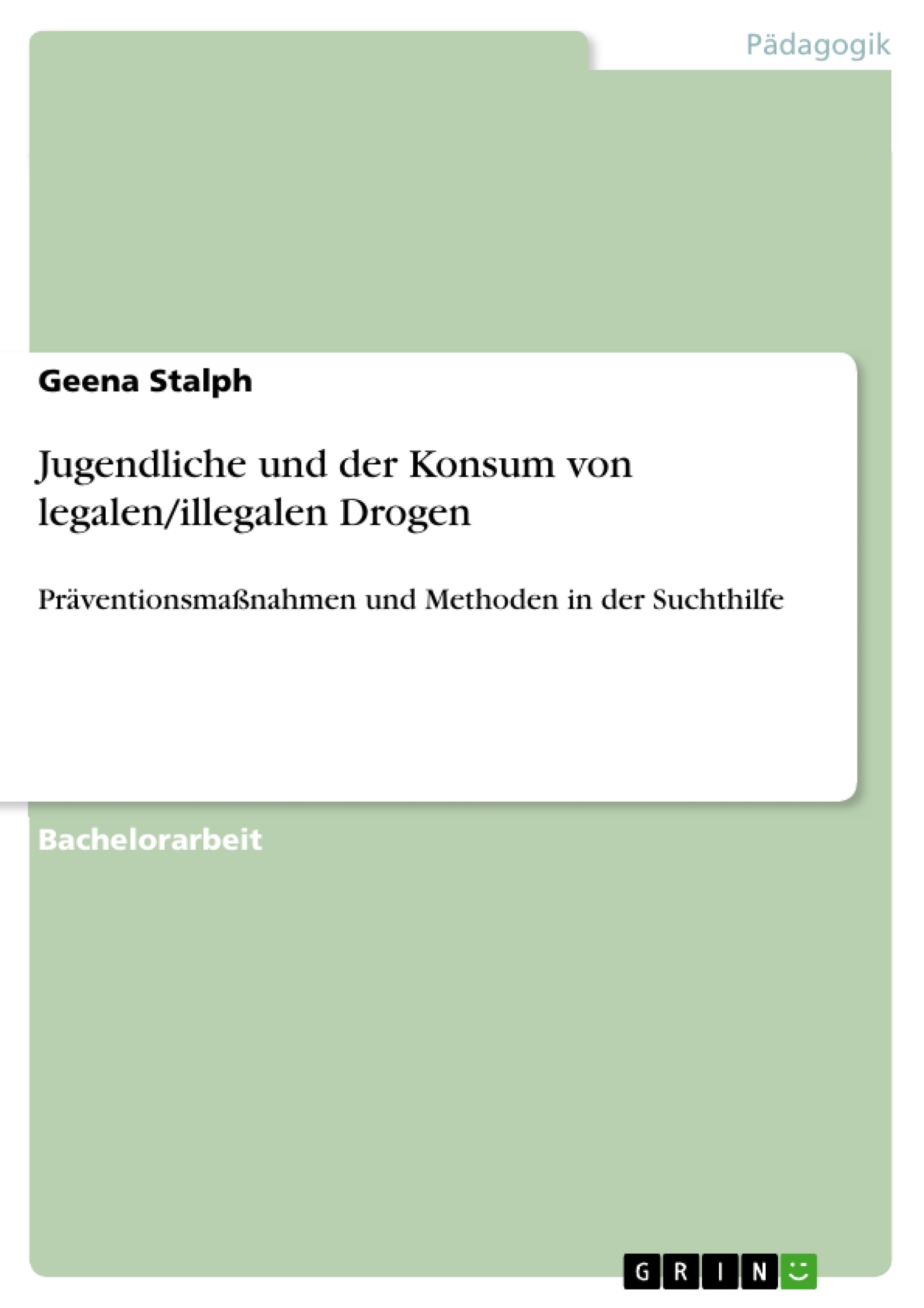Ziel dieser Arbeit ist es, das Konsumverhalten von legalen und illegalen Substanzen bei Jugendlichen darzustellen, die Chancen der Sozialen Arbeit anhand von Präventionsmöglichkeiten und deren Wirksamkeit aufzuzeigen sowie die Methoden und deren Wirksamkeit im Umgang mit Heranwachsenden, die bereits an einer Suchterkrankung leiden.
Berauschende und bewusstseinsveränderte Substanzen werden schon seit Jahrtausenden von der Menschheit genutzt, um gemeinsam einen ritualisierten Rausch zu erleben. Auch heute noch werden Substanzmittel meist gemeinschaftlich konsumiert, um eine Verbesserung der Stimmung, Entspannung, einen Abbau von Angst und Hemmungen oder eine Intensivierung des Erlebens zu erreichen. Doch auch riskante Konsumformen und Substanzabhängigkeiten begleiten die Menschheit durch alle Zeiten und Kulturen. Der Gedanke einer drogenfreien Gesellschaft ist längst nicht mehr tragbar, da beinahe jeder Mensch früher oder später mit Substanzmitteln in Kontakt kommt und sich dazu in Beziehung setzen muss.
Vor allem die Adoleszenz spielt hierbei eine wichtige Rolle. Dieser Lebensabschnitt stellt eine Entwicklung mit besonders großen Veränderungen und Herausforderungen dar, die sich in verschiedenen Bereichen und mit einer relativ schnellen Geschwindigkeit vollziehen. Meist geschieht in dieser Lebensphase auch der erste Kontakt mit Substanzmitteln. Dabei gestaltet sich die Entwicklung eines alltagsentsprechenden Umgangs mit Suchtmitteln und die Kontrolle von suchterzeugenden Verhalten als eine Entwicklungsaufgabe in der Adoleszenz.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Eine drogenfreie Gesellschaft als Utopie?
- 2. Sucht- und Drogenbegriff
- 2.1 Definition und Entstehung von Sucht
- 2.2 Suchtauslösende Substanzen
- 2.2.1 Legale suchtauslösende Substanzen
- 2.2.2 Illegale suchtauslösende Substanzen
- 2.3 Klassifikation einer Suchtstörung
- 3. Jugendliche und Suchtmittelkonsum
- 3.1 Verbreitung des Drogenkonsums im Jugendalter
- 3.1.1 Prävalenz des Konsums legaler Drogen im Jugendalter
- 3.1.2 Prävalenz des Konsums illegaler Drogen im Jugendalter
- 3.2 Konsummuster und Folgen des Substanzmittelkonsums im Jugendalter
- 3.3 Suchtgefährdete Jugendliche
- 3.4 Substanzmittelkonsum im Jugendalter als Entwicklungsaufgabe
- 4. Die Kinder- und Jugendhilfe im Bereich der Suchthilfe
- 5. Suchtprävention
- 5.1 Der Präventionsbegriff
- 5.2 Suchtprävention für Jugendliche in der Praxis
- 5.2.1 Familienbezogene Suchtprävention
- 5.2.2 Suchtprävention im schulischen Setting
- 5.3 Wirksamkeit der Suchtprävention für Jugendliche
- 6. Methoden in der Suchthilfe für Jugendliche
- 6.1 Frühintervention durch motivierende Gesprächsführung
- 6.2 Ambulante Versorgung
- 6.3 Stationäre Therapiemaßnahmen
- 6.4 Wirksamkeit der Maßnahmen in der Suchthilfe für Jugendliche
- 7. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht das Konsumverhalten von legalen und illegalen Substanzen bei Jugendlichen und beleuchtet die Rolle der Sozialen Arbeit in der Prävention und Behandlung von Suchtproblemen. Die Arbeit verfolgt das Ziel, die Chancen der Sozialen Arbeit anhand von Präventionsmöglichkeiten und deren Wirksamkeit aufzuzeigen, sowie die Methoden und deren Wirksamkeit im Umgang mit Jugendlichen, die bereits an einer Suchterkrankung leiden, darzustellen.
- Definition und Entstehung von Sucht
- Verbreitung des Drogenkonsums im Jugendalter
- Präventionsmöglichkeiten und deren Wirksamkeit in der Suchthilfe
- Methoden in der Suchthilfe für Jugendliche mit Suchterkrankungen
- Die Rolle der Sozialen Arbeit in der Prävention und Behandlung von Suchtproblemen bei Jugendlichen
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel beleuchtet den Begriff einer drogenfreien Gesellschaft und zeigt auf, dass dieser aufgrund der langen Geschichte des Drogenkonsums in verschiedenen Kulturen nicht realistisch ist. Der Fokus liegt auf der Rolle des Substanzmittelkonsums in der Adoleszenz, der als Entwicklungsaufgabe betrachtet wird.
Kapitel zwei befasst sich mit dem Sucht- und Drogenbegriff. Hier werden die Definition von Sucht, die Entstehung von Sucht und die Klassifikation einer Suchtstörung vorgestellt. Es werden zudem legale und illegale suchtauslösende Substanzen dargestellt.
Das dritte Kapitel widmet sich dem Drogenkonsum bei Jugendlichen. Es werden die Prävalenzen für den Konsum legaler und illegaler Substanzen im Jugendalter beleuchtet und die verschiedenen Konsummuster und Folgen des Substanzmittelkonsums erläutert. Darüber hinaus werden suchtgefährdete Jugendliche und der Substanzmittelkonsum als Entwicklungsaufgabe in der Adoleszenz thematisiert.
Kapitel vier befasst sich mit der Kinder- und Jugendhilfe im Bereich der Suchthilfe. Es gibt einen Einblick in die Entwicklung der Suchthilfe, die Voraussetzungen der pädagogischen Fachkräfte und die elementaren Aufgaben der Suchthilfe bei Jugendlichen.
Das fünfte Kapitel stellt die Chancen der Sozialen Arbeit im Bereich der Suchthilfe für Jugendliche am Beispiel der Suchtprävention dar. Der Präventionsbegriff wird erläutert, die Praxis der Suchtprävention anhand von familienbezogenen und schulischen Programmen verdeutlicht und die Wirksamkeit der Suchtprävention für Jugendliche untersucht.
Im sechsten Kapitel werden die Methoden der Suchthilfe für Jugendliche, die bereits an einer Suchterkrankung leiden oder bei denen ein Substanzmissbrauch vorliegt, aufgezeigt. Die Frühintervention durch motivierende Gesprächsführung, die ambulante Versorgung, die stationäre Therapiemaßnahmen und die Wirksamkeit verschiedener Methoden werden vorgestellt.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit den Themenbereichen Sucht, Drogen, Jugend, Prävention, Suchthilfe, Methoden der Suchthilfe, Soziale Arbeit, Familienbezogene Prävention, Schulische Prävention, Frühintervention, Motivierende Gesprächsführung, Ambulante Versorgung, Stationäre Therapie.
Häufig gestellte Fragen
Warum wird Drogenkonsum im Jugendalter als „Entwicklungsaufgabe“ gesehen?
Jugendliche müssen lernen, einen kontrollierten Umgang mit Suchtmitteln zu entwickeln und sich in einer Gesellschaft, in der Drogen präsent sind, zu positionieren.
Welche Präventionsmöglichkeiten für Jugendliche gibt es?
Es wird zwischen familienbezogener Prävention und Suchtprävention im schulischen Setting unterschieden.
Was versteht man unter „motivierender Gesprächsführung“?
Eine Methode der Frühintervention, die darauf abzielt, die Eigenmotivation des Jugendlichen zur Verhaltensänderung zu wecken.
Sind legale Drogen für Jugendliche gefährlicher als illegale?
Die Arbeit zeigt, dass die Verbreitung (Prävalenz) legaler Drogen (Alkohol, Nikotin) oft höher ist und diese ein hohes Abhängigkeitspotenzial besitzen.
Welche Rolle spielt die Kinder- und Jugendhilfe in der Suchthilfe?
Sie bietet ambulante und stationäre Therapiemaßnahmen an und unterstützt suchtgefährdete Jugendliche durch pädagogische Fachkräfte.
- Quote paper
- Geena Stalph (Author), 2021, Jugendliche und der Konsum von legalen/illegalen Drogen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1184932