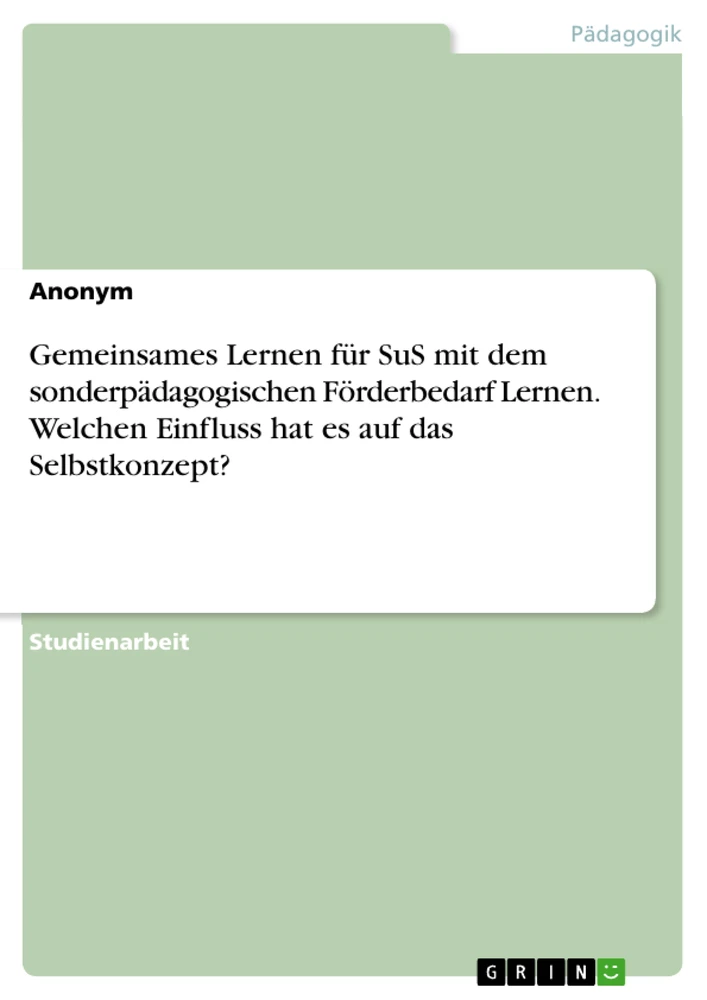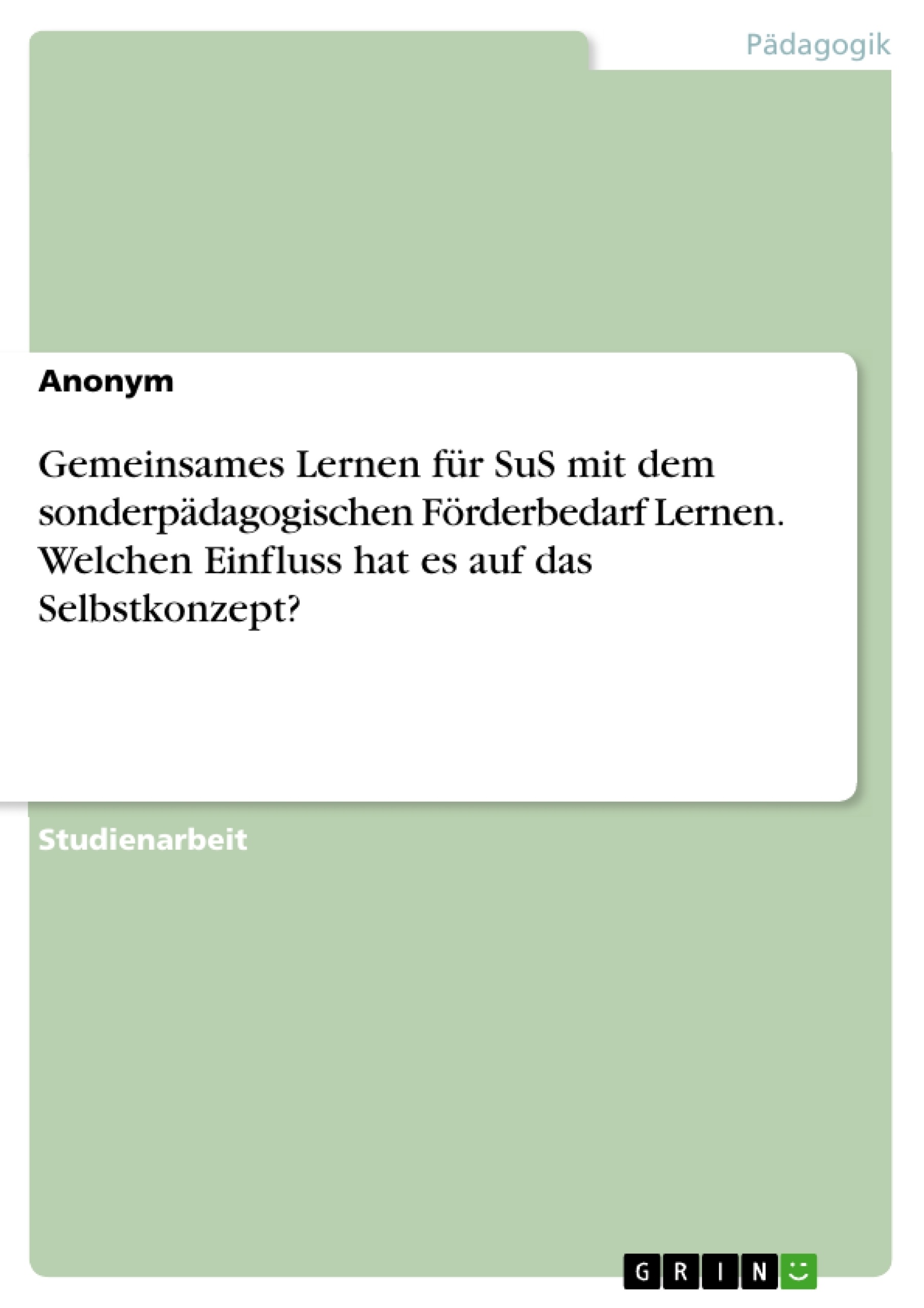In der vorliegenden Arbeit wird zunächst das Selbstkonzeptmodell und dessen einzelne Dimensionen von Shavelson et al. (1976) dargestellt. Daran anknüpfend wird erläutert, anhand welcher konkreten Merkmale die Heterogenität in inklusiven Klassensettings festzustellen ist. Im Anschluss daran soll die zentrale Frage dieser Arbeit beantwortet werden und zwar inwiefern sich das gemeinsame Lernen in inklusiven Klassensettings auf die einzelnen Teilbereiche des Selbstkonzepts von SuS mit Förderbedarf auswirkt. Letztlich werden die erzielten Ergebnisse in einem Fazit zusammengefasst und reflektiert.
Der seit 2011 eingeführte inklusive Unterricht an deutschen Schulen, in dem Schülerinnen und Schüler (kurz: SuS) mit und ohne Förderbedarf in gemeinsamen Klassen lernen, ist immer noch häufige Diskussionsgrundlage in der Bildungspolitik. Die dort vorherrschende hohe Heterogenität, gerade in Bezug auf die Lernvoraussetzungen der Schülerschaft, hat Auswirkungen auf alle Beteiligten. Im Hinblick auf die SuS mit Förderbedarf wird bereits seit einiger Zeit diskutiert, ob der dauerhafte Leistungsvergleich mit den Mitschülern und Mitschülerinnen Auswirkungen auf die Wahrnehmung der eigenen Leistung hat. Dabei stellt sich zum einen die Frage, welche Auswirkungen dieser Vergleich auf die Kompetenzwahrnehmung in den einzelnen Fächern hat und zum anderen, wie sich dieser auch auf soziale Bereiche hinsichtlich der Klassenzugehörigkeit auswirkt. Dabei wird konkret Bezug auf das Selbstkonzept genommen, das das Wissen über die eigenen Stärken und Schwächen in einzelnen Teilbereichen akkumuliert und sich dementsprechend für jedes Individuum differenziert gestaltet.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Das Selbstkonzept nach Shavelson et al. (1976)
- Organisation und Ebenen des Konzepts
- Heterogenitätsmerkmale und Auswirkungen des gemeinsamen Lernens
- Heterogenität in inklusiven Grundschulklassen
- Auswirkungen des Gemeinsamen Lernens auf das Selbstkonzept
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit untersucht den Einfluss von inklusivem Unterricht auf das Selbstkonzept von Schülerinnen und Schülern mit dem Förderbedarf Lernen. Sie beleuchtet, wie die hohe Heterogenität in inklusiven Klassen die Wahrnehmung der eigenen Leistung beeinflusst und welche Auswirkungen dies auf die Kompetenzwahrnehmung in einzelnen Fächern sowie auf soziale Bereiche wie die Klassenzugehörigkeit hat.
- Das Selbstkonzeptmodell nach Shavelson et al. (1976) und dessen Dimensionen
- Heterogenitätsmerkmale in inklusiven Klassensettings
- Auswirkungen von inklusivem Unterricht auf das Selbstkonzept von SuS mit Förderbedarf
- Die Rolle des Leistungsvergleichs im Kontext von inklusivem Unterricht
- Das Fähigkeitsselbstkonzept und dessen Bedeutung für das Lernen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt den aktuellen Stand der Diskussion um inklusiven Unterricht in Deutschland dar und thematisiert die Bedeutung des Selbstkonzepts für die Entwicklung von Schülerinnen und Schülern. Kapitel 2 erläutert das Selbstkonzeptmodell nach Shavelson et al. (1976) und geht auf die Organisation und die einzelnen Ebenen des Konzepts ein. Kapitel 3 widmet sich den Heterogenitätsmerkmalen in inklusiven Klassensettings und beleuchtet die Auswirkungen des gemeinsamen Lernens auf das Selbstkonzept von Schülerinnen und Schülern mit Förderbedarf. Das Fazit fasst die Ergebnisse der Arbeit zusammen und reflektiert deren Bedeutung für die Praxis.
Schlüsselwörter
Inklusion, Gemeinsames Lernen, Selbstkonzept, Heterogenität, Förderbedarf, Fähigkeitsselbstkonzept, Leistungsvergleich, Klassenzugehörigkeit, Entwicklungspsychologie, Pädagogische Psychologie, Inklusiver Unterricht, Shavelson-Modell.
Häufig gestellte Fragen
Welchen Einfluss hat inklusiver Unterricht auf SuS mit Förderbedarf Lernen?
Die Arbeit untersucht, wie sich das gemeinsame Lernen in inklusiven Settings auf die Kompetenzwahrnehmung und soziale Teilbereiche des Selbstkonzepts auswirkt.
Welches Modell wird zur Erklärung des Selbstkonzepts herangezogen?
Es wird das hierarchisch strukturierte Selbstkonzeptmodell nach Shavelson et al. (1976) verwendet.
Was sind die zentralen Dimensionen des Shavelson-Modells?
Das Modell unterscheidet zwischen dem akademischen Selbstkonzept (schulische Leistungen) und dem nicht-akademischen Selbstkonzept (soziale, emotionale und physische Aspekte).
Wie wirkt sich der Leistungsvergleich in inklusiven Klassen aus?
Der dauerhafte Vergleich mit leistungsstärkeren Mitschülern kann die Wahrnehmung der eigenen Kompetenz bei Schülern mit Förderbedarf negativ beeinflussen.
Welche Heterogenitätsmerkmale werden in der Arbeit erläutert?
Die Arbeit beleuchtet insbesondere die unterschiedlichen Lernvoraussetzungen und Leistungspotenziale in inklusiven Grundschulklassen.
Warum ist das Fähigkeitsselbstkonzept für das Lernen wichtig?
Das Wissen über die eigenen Stärken und Schwächen beeinflusst maßgeblich die Motivation, die Ausdauer und den schulischen Erfolg eines Individuums.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2020, Gemeinsames Lernen für SuS mit dem sonderpädagogischen Förderbedarf Lernen. Welchen Einfluss hat es auf das Selbstkonzept?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1185633