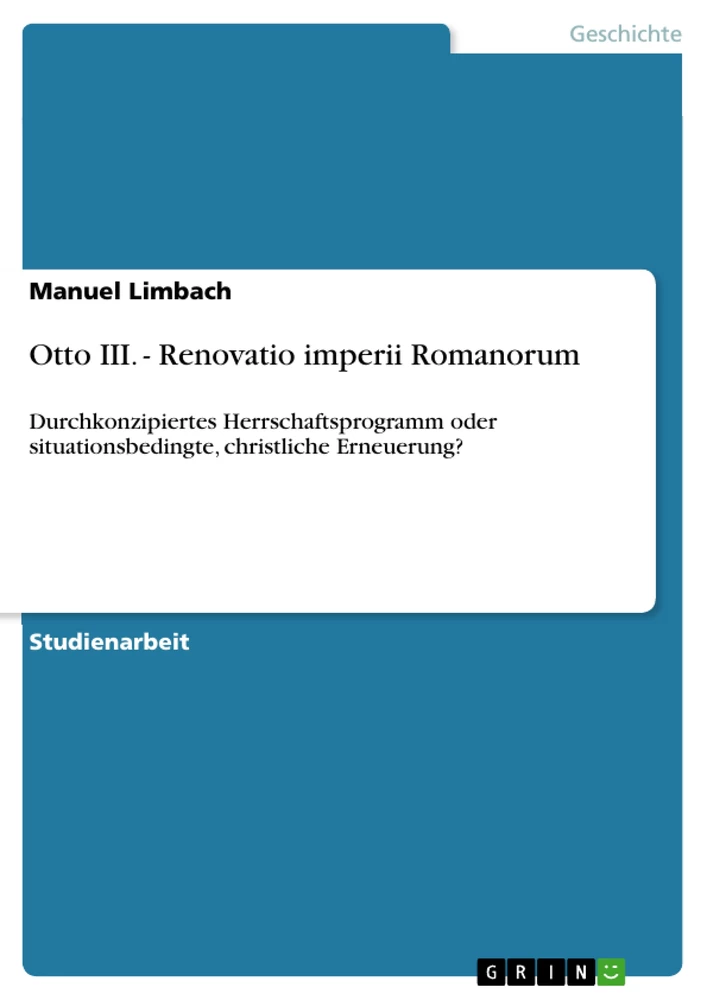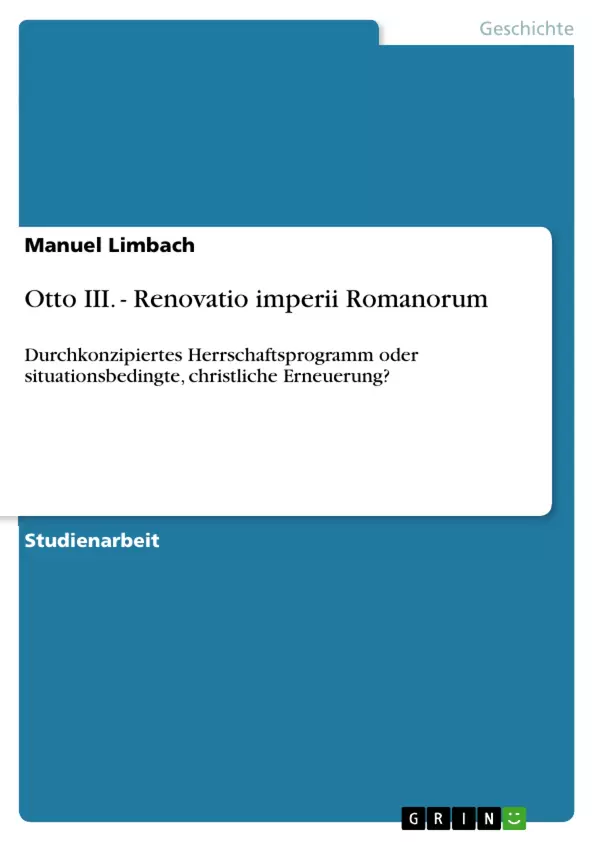Die Seminararbeit ist so aufgebaut, dass im ersten Teil mit den historischen
Grundlagen in das Thema dieser Arbeit eingeführt werden soll. Neben der Entstehung und der
Entwicklung des „Römischen Erneuerungsgedankens“ wird auch auf ein paar wichtige
Lebensdaten Ottos III. hingewiesen werden, die für das weitere Verständnis dieser Arbeit
hilfreich sein werden. Dabei wird im dritten Abschnitt explizit auf die Berater Ottos III.
eingegangen und damit eine Verbindung zwischen Otto III. und dem möglicherweise durch
seine Berater an ihn herangetragenen Römischen Erneuerungsgedanken hergestellt. Während
sich der zweite Teil der Seminararbeit hauptsächlich mit der oben erwähnten Quellenanalyse
und der Darstellung der verschiedenen Interpretationen beschäftigt, soll im dritten Teil
konkret nach Indizien für eine politische Programmatik gesucht werden. Die
Forschungskontroverse, die Görich mit seinem Buch 1993 auslöste und die auch heute noch
nicht beigelegt ist, soll im letzten Teil der Arbeit kurz aufgearbeitet werden. Dabei sollen
auch allgemeine Probleme der Mittelalter-Forschung aufgezeigt werden.
In der anschließenden Schlussbetrachtung sollen die Ergebnisse des Hauptteils noch
einmal zusammengefasst, aufgeworfene Fragen beantwortet und ein Fazit gezogen werden.
[...]
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 1.1 Die Entwicklung des „Römischen Erneuerungsgedankens“
- 1.2 Otto III. (980-1002)
- 1.3 Persönliches Umfeld Ottos III.
- 2. Otto III. und seine Rompolitik in der sächsischen Historiographie
- 2.1 Funktion der Stadt Rom Ende des 10. Jahrhunderts
- 2.2 Ottos III. Verhältnis zu Rom und den Römern
- 2.3 Der Akt von Gnesen
- 2.4 Zusammenfassung
- 3. Hinweise auf eine politische Programmatik?
- 3.1 Politische Initiativen Ottos III.
- 3.1.1 Rom als Hauptstadt mit der Bezeichnung caput mundi
- 3.1.2 Ottos Gnesenfahrt
- 3.2 Überreste der Zeit als Ausdruck politischer Programmatik?
- 3.2.1 Leo von Vercellis „Versus de Gregorio et Ottone augusto“
- 3.2.2 Gerbert von Reims „Nostrum, nostrum est Romanum Imperium“
- 3.2.3 Die Kaiserbullen Ottos III.
- 4. Renovatio imperii Romanorum - Eine Forschungskontroverse
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit untersucht die Rompolitik Ottos III. und die damit verbundene Renovatio imperii Romanorum. Im Mittelpunkt steht die Frage, ob die Renovatio ein durchdachtes politisches Programm oder eine situationsbedingte Reaktion auf die damaligen Verhältnisse in Rom darstellte. Die Arbeit vergleicht die gegensätzlichen Interpretationen von Schramm und Görich und analysiert verschiedene Quellen, um nach Hinweisen auf eine ideologisch motivierte Politik zu suchen.
- Die Entwicklung des „Römischen Erneuerungsgedankens“
- Ottos III. Rompolitik und seine Beziehungen zu Rom und den Römern
- Analyse der Quellen und unterschiedlicher Interpretationen der Historiker
- Suche nach Indizien für eine politische Programmatik in der Renovatio
- Die Forschungskontroverse um die Interpretation der Renovatio
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik ein und stellt die Forschungsfrage nach dem Charakter der Renovatio imperii Romanorum bei Otto III. Sie beleuchtet die unterschiedlichen Interpretationen von Schramm und Görich und skizziert den Aufbau der Arbeit, der sich mit historischen Grundlagen, Quellenanalyse und der Suche nach Indizien für eine politische Programmatik auseinandersetzt. Der Fokus liegt auf der Klärung, ob die Renovatio ein durchdachtes Programm oder eine reaktive Maßnahme war.
1. Historische Grundlagen: Dieses Kapitel beleuchtet die Entwicklung des „Römischen Erneuerungsgedankens“ von der Kaiserkrönung Karls des Großen bis zur Zeit Ottos III. Es analysiert den Begriff „Renovatio“ und untersucht, welche Bedeutung die „Erneuerung“ des römischen Reiches für die fränkischen und sächsischen Könige hatte. Der Abschnitt zeigt die Entstehung des Gedankens auf und seine Bedeutung für die Legitimierung der Herrschaft.
2. Otto III. und seine Rompolitik in der sächsischen Historiographie: Dieses Kapitel analysiert Ottos III. Rompolitik im Kontext der sächsischen Geschichtsschreibung. Es untersucht die Funktion Roms am Ende des 10. Jahrhunderts, Ottos Verhältnis zu Rom und den Römern sowie den Akt von Gnesen. Die verschiedenen Perspektiven der Historiographie werden beleuchtet um ein umfassendes Bild der politischen Lage und der Handlungen Ottos III zu präsentieren.
3. Hinweise auf eine politische Programmatik?: Dieses Kapitel sucht nach Indizien für eine politische Programmatik hinter Ottos III. Renovatio-Politik. Es untersucht politische Initiativen wie die Ausgestaltung Roms als „caput mundi“ und Ottos Gnesenfahrt, sowie zeitgenössische Quellen wie die Werke von Leo von Vercelli und Gerbert von Reims und Kaiserbullen. Die Analyse konzentriert sich darauf, ob diese Indizien eine durchdachte politische Strategie Ottos III. belegen.
4. Renovatio imperii Romanorum - Eine Forschungskontroverse: Das Kapitel behandelt die anhaltende Forschungsdebatte um die Interpretation der Renovatio imperii Romanorum unter Otto III., insbesondere den Gegensatz zwischen den Ansätzen von Schramm und Görich. Es beleuchtet die unterschiedlichen Schlussfolgerungen, die aus denselben Quellen gezogen werden und die Schwierigkeiten der mittelalterlichen Geschichtsforschung auf.
Schlüsselwörter
Otto III., Renovatio imperii Romanorum, Rompolitik, sächsische Historiographie, Kaiserkrönung, politische Programmatik, Quellenanalyse, Forschungskontroverse, Schramm, Görich, römischer Erneuerungsgedanke, Akt von Gnesen, caput mundi.
Häufig gestellte Fragen zur Seminararbeit: Otto III. und die Renovatio imperii Romanorum
Was ist das Thema der Seminararbeit?
Die Seminararbeit untersucht die Rompolitik Kaiser Ottos III. und die damit verbundene „Renovatio imperii Romanorum“ (Erneuerung des römischen Reiches). Im Mittelpunkt steht die Frage, ob diese „Renovatio“ ein durchdachtes politisches Programm oder eine situationsbedingte Reaktion auf die damalige Lage in Rom war.
Welche Quellen werden in der Arbeit verwendet?
Die Arbeit analysiert verschiedene Quellen, um nach Hinweisen auf eine ideologisch motivierte Politik zu suchen. Dazu gehören unter anderem die Werke von Leo von Vercelli („Versus de Gregorio et Ottone augusto“) und Gerbert von Reims („Nostrum, nostrum est Romanum Imperium“), Kaiserbullen Ottos III. sowie die sächsische Historiographie.
Welche Historiker werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit vergleicht die gegensätzlichen Interpretationen der Historiker Percy Ernst Schramm und Wilhelm Görich zur Renovatio imperii Romanorum und analysiert die unterschiedlichen Schlussfolgerungen, die aus denselben Quellen gezogen werden.
Welche Kapitel umfasst die Seminararbeit?
Die Arbeit gliedert sich in vier Kapitel: Eine Einleitung, ein Kapitel zu den historischen Grundlagen (Entwicklung des „Römischen Erneuerungsgedankens“), ein Kapitel zu Otto III. und seiner Rompolitik in der sächsischen Historiographie und ein Kapitel, welches nach Hinweisen auf eine politische Programmatik in Ottos Politik sucht und die Forschungskontroverse um die Interpretation der Renovatio behandelt.
Was ist die Zielsetzung der Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, die Rompolitik Ottos III. im Kontext der „Renovatio imperii Romanorum“ zu untersuchen und zu klären, ob es sich dabei um ein bewusstes politisches Programm oder eine eher reaktive Maßnahme handelte. Sie analysiert verschiedene Quellen und Perspektiven, um diese Frage zu beantworten.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Otto III., Renovatio imperii Romanorum, Rompolitik, sächsische Historiographie, Kaiserkrönung, politische Programmatik, Quellenanalyse, Forschungskontroverse, Schramm, Görich, römischer Erneuerungsgedanke, Akt von Gnesen, caput mundi.
Welche konkreten Aspekte von Ottos III. Rompolitik werden untersucht?
Die Arbeit untersucht unter anderem Ottos Verhältnis zu Rom und den Römern, die Funktion Roms Ende des 10. Jahrhunderts, den Akt von Gnesen, die Ausgestaltung Roms als „caput mundi“ und Ottos Gnesenfahrt.
Wie wird die Forschungskontroverse um die Renovatio dargestellt?
Die Arbeit beleuchtet die anhaltende Debatte um die Interpretation der Renovatio imperii Romanorum unter Otto III., insbesondere den Gegensatz zwischen den Ansätzen von Schramm und Görich, und zeigt die Schwierigkeiten der mittelalterlichen Geschichtsforschung auf.
Welche Bedeutung hat der Begriff „Renovatio“ in diesem Kontext?
Die Arbeit analysiert die Bedeutung des Begriffs „Renovatio“ und untersucht, welche Bedeutung die „Erneuerung“ des römischen Reiches für die fränkischen und sächsischen Könige hatte, und wie dieser Gedanke zur Legitimierung ihrer Herrschaft beitrug.
- Arbeit zitieren
- Manuel Limbach (Autor:in), 2008, Otto III. - Renovatio imperii Romanorum, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/118564